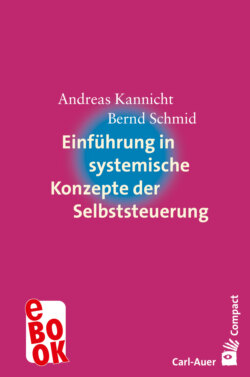Читать книгу Einführung in systemische Konzepte der Selbststeuerung - Andreas Kannicht - Страница 5
1 Einführung 1.1 Steuerung und Selbststeuerung
ОглавлениеDieses Buch handelt von der Steuerung in Beratungen. Dabei könnte man zunächst an Klienten und Beratungsprozesse denken. Doch aus systemischer Perspektive bedeutet Steuerung zuallererst Selbststeuerung des Beraters. Denn sie gestaltet Beratungswirklichkeiten entscheidend mit.
Was ist mit Steuerung gemeint? Von denjenigen, die sich mit dem systemischen Ansatz beschäftigen, kommen die meisten zunächst mit einer Vielzahl von »systemischen« Techniken in Berührung. Wir lernen interessante Fragetechniken kennen, allen voran das zirkuläre Fragen (»Was glauben Sie, welche Beweggründe Ihr Kollege Ihnen unterstellt?«) und lösungsorientierte Fragen (»Wie würde eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Ihnen aussehen?«), die positive Konnotation (»Dieses Zögern kann Sie auch vor überstürztem Engagement bewahren!«), das Arbeiten mit den inneren Anteilen (»Gibt es Seiten in Ihnen, die dem Plan widersprechen wollen?«), hypothetische Fragen (»Angenommen, Sie würden so vorgehen, wie wäre dann Ihre Situation in zwei Jahren?«), die Interventionstechniken und vieles mehr.
Ausgestattet mit solchen Fertigkeiten, verfügen wir über einen reichhaltigen Werkzeugkasten, um mit Klienten zu arbeiten. Damit ist allerdings die Frage nicht beantwortet, wann wir welche Technik einsetzen. Diese Frage klärt sich nicht aus der Technik selbst. Hierzu bedarf es orientierungsgebender Betrachtungen von einer übergeordneten Warte aus. Wann könnte welche Technik Sinn haben? Welche Themen könnten bei einem Klienten relevanter sein als andere? Welche Themen hat er nicht im Blick, obwohl sie für die Lösungsfindung relevant sein könnten? Genau mit dieser Ebene beschäftigen sich die Steuerungskonzepte dieses Buches. Es geht somit nicht um Verfeinerung technischen Vorgehens, sondern um die dahinter stehenden Fragen. Wie kann ein Berater mit einem Klienten einen sinngebenden Dialog erzeugen, der für den Klienten einen Unterschied darstellt: zu seinem bisherigen Selbstverständnis, zur gewohnheitsmäßig erzählten Geschichte seines Lebens, zu den bisherigen Wirklichkeitskonstruktionen und seinen Handlungsoptionen? Hierzu ein Beispiel:
Ein Klient kommt mit der Aussage, er sei ängstlich und habe das Ziel, sein Leben selbstbewusster anzupacken. Als Systemiker werden wir uns zunächst kundig machen, was er unter ängstlich versteht, worin sich dies zeigt und welche Vorstellungen er mitbringt, wie er sein Leben gestalten würde, wenn er selbstbewusster wäre, vielleicht auch, wo es ihm in Ansätzen bereits gelingt.
Wir entfalten somit den Kosmos der Wirklichkeiten des Klienten. Möglicherweise findet der Klient bereits durch unser sorgfältiges Fragen Impulse und Anregungen, bestimmte Aspekte näher und aus anderem Blickwinkel zu betrachten. Dann kann der Berater solchen Pfaden folgen. Aber nicht zwangsläufig führt jeder vom Klienten selbst gefundene Weg zum Ziel. Wenn nicht, helfen Steuerungskonzepte: Welche Fragestellungen gäbe es mit welchen Alternativen noch, die bei Bedarf aufgegriffen werden könnten? Nicht jede dem Klienten und dem Berater zunächst sinngebend erscheinende Hypothese muss relevant sein. So stellt sich der Beratungsprozess als ein Weg mit vielen Ausgangspunkten, Horizonten und Weggabelungen dar.
Traditionellerweise werden im systemischen Feld beispielsweise der lösungsfokussierte Ansatz nach de Shazer und Berg (vgl. de Shazer 1989), das Mailänder Modell nach Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin und Prata (1977), der klassische familientherapeutische Ansatz nach McGoldrick, Gerson und Petry (1990) und die Aufstellungsarbeit (Weber 1993) unterschieden. Diese unterschiedlichen Strömungen und dazugehörenden Methoden stehen oft unverbunden nebeneinander oder werden in Richtungsstreitigkeiten als widersprüchlich gegeneinandergestellt. Mit dem Selbststeuerungskonzept können sie verbunden werden und erscheinen als sich ergänzende Ansätze, die aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt des Klienten und der Beratung blicken.
Steuerungskonzepte helfen also, die notwendige Vielfalt zu sichern. Herausfordernde Situationen können aber auch entstehen, wenn Vielfalt zum Problem wird. Es ist vielleicht in einer Beratung schon eine zu hohe Komplexität entstanden. Klient und Berater fragen sich, wie es nun angesichts der vielen benannten Aspekte weitergehen könnte. Auch für solche Situationen stellen die Steuerungskonzepte eine Hilfe dar, da sie mögliche Fokussierungen erhellen, aus denen der Berater auswählen kann. Oder er stellt solche dem Klienten zur Verfügung, damit dieser entscheiden kann. Ob ein Berater die Auswahl von Fokussierungen selbst trifft oder den Klienten entscheiden lässt, ist übrigens seinerseits ein Vorgang der Selbststeuerung des Beraters.
Was wären nun unterschiedliche Perspektiven auf die Ängstlichkeit des Klienten?
Der Berater könnte beispielsweise darauf fokussieren, wie der Klient die Menschen, mit denen er in Kontakt ist, dazu einlädt, ihn als ängstlich zu erleben, und wie sie wiederum bei ihm auslösen, sich ängstlich zu verhalten. Es würde sich die Frage anschließen können, welche Funktion er in seiner Ängstlichkeit sieht und welchen Nutzen seine Ängstlichkeit aus der Sicht der anderen haben könnte. Welche Neuanpassungen stünden für alle an, wenn diese Ängstlichkeit verflöge? Wäre dies gewollt? Welche Herausforderungen für die Beteiligten, aber auch für die Umwelt würden folgen?
Eine ganz andere Fokussierungsebene würde sich ergeben, wenn wir nach den biografischen Zusammenhängen fragen. In welchen Zusammenhängen hat er gelernt, mit Ängstlichkeit zu reagieren? Sind die Umstände des heutigen Auftretens ähnlich? Inwiefern war Ängstlichkeit sinnvoll? Wurde Ängstlichkeit zur Antwort auf bestimmte Lebensherausforderungen? Inwiefern war dies eine Hilfe? Ist diese Lösungsidee für den Klienten auch heute noch zieldienlich?
Eine dritte Perspektive könnte sich auf die bisherigen Versuche des Klienten richten, sein Verhalten zu ändern. Was hat er bisher unternommen, seine Ängstlichkeit loszuwerden, sie durch andere Modi zu ersetzen? Wann, wo und in welchen Zusammenhängen ist es ihm bereits gelungen, etwas mutiger zu sein als sonst, und wie hat er dies erreicht?
Dies sind nur drei von vielen Fokusebenen, die man für die nähere Beschreibung von und den Umgang mit Ängstlichkeit wählen kann.
Da man nie alle Wege gehen kann, muss immer irgendwie entschieden werden, wo und wie man anfängt, welche man wie weit verfolgt, welche man wieder verlässt, um ganz andere oder naheliegende bessere zu wählen. Dabei weiß man letztlich nie, welche Wege weiterführen und wie lange es Sinn ergibt, sie zu gehen. Hier ist man auf Erfahrung und Intuition angewiesen und auf eine Interaktion mit dem Klienten, aufgrund deren bessere Wege von weniger hilfreichen unterschieden werden können. Es kommt dabei weniger auf den besten Start an als auf das schnelle gemeinsame Lernen unterwegs. Salopp gesprochen: Man darf ruhig dumm anfangen. Hauptsache, man lernt schnell dazu.