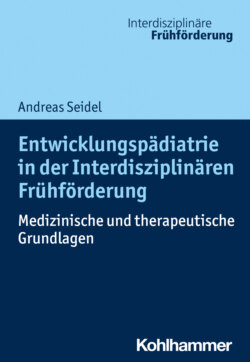Читать книгу Entwicklungspädiatrie in der Interdisziplinären Frühförderung - Andreas Seidel - Страница 10
2.3 Risikofaktoren und Schutzfaktoren in der Kindesentwicklung
ОглавлениеIn der Risikoforschung wird das Ziel verfolgt, Gruppen von Kindern – Risikokinder – zu identifizieren, deren Entwicklung gefährdet ist. Dabei geht es darum, Lebensbedingungen zu ermitteln, die eine Gefährdung der kindlichen Entwicklung darstellen. Risikofaktoren beschreiben eine Bedingung, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Entwicklungsstörung erhöht. Häufig wirken Risikofaktoren kumulativ, das heißt, im Zusammenwirken mehrerer Risikofaktoren steigt das Risiko für eine Entwicklungsstörung deutlich an. Jedoch gibt es auch Kinder, die ohne oder mit wenigen Risikofaktoren eine Störung entwickeln. Umgekehrt gibt es Kinder, die trotz vieler Risikofaktoren keine Beeinträchtigung von Gesundheit und Entwicklung erfahren. Diese Beobachtungen führten zu einer stärkeren Betrachtung nicht nur von Risikofaktoren, sondern auch zur Herausarbeitung von Schutzfaktoren (Übersicht in Lieberz et al., 2011).
Im Zusammenhang mit Risiko- und Schutzfaktoren sind besonders die Konzepte von Resilienz (»psychische Widerständigkeit«) und Vulnerabilität (»Verletzlichkeit«) von Bedeutung, die eine personbezogene Perspektive im Zusammenhang mit Entwicklungsrisiken einnehmen. Am bekanntesten ist im Bereich der Resilienzforschung die Pionierarbeit der amerikanischen Entwicklungspsychologin Emmy Werner mit ihrer Kauai Studie. Emmy Werner und ihr Team untersuchten etwa 700 Kinder über mehrere Jahrzehnte hinweg, die 1955 auf der Hawaii-Insel Kauai geboren wurden. Ca. ein Drittel der untersuchten Kinder wuchsen unter äußerst schwierigen Verhältnissen auf, die durch Armut, niedrigen Bildungsstand der Eltern, Krankheit der Eltern, Vernachlässigung, Gewalt in der Familie und Misshandlung gekennzeichnet waren. Etwa zwei Drittel dieser vorbeschriebenen Risikokinder fielen in den Folgejahren als Jugendliche durch Lern- oder Verhaltensstörungen auf oder wurden sogar straffällig. Gleichzeitig entwickelte sich das andere Drittel dieser Risikogruppe aber erstaunlich positiv. Diese Kinder waren erfolgreich in der Schule, in das soziale Leben integriert und wiesen zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung relevante Verhaltensauffälligkeiten auf. Dies zeigte, dass schlechte Entwicklungsbedingungen nicht zwingend zu Entwicklungsstörungen und Misserfolgen führen müssen. Resiliente Kinder verfügen über bestimmte Eigenschaften und Strategien, die ihnen ermöglichen, an widrigen Lebensumständen nicht zu scheitern (Werner, 1992).
Im Bereich der Medizinsoziologie entwickelte Aaron Antonovsky das Modell der Salutogenese, das wesentlich zur Entwicklung der Gesundheitsförderung (in Abgrenzung zum Präventionsmodell) beigetragen hat (Antonovsky, 1985). Es folgten zahlreiche weitere prospektive longitudinale Studien zum Thema der Risiko- und Schutzfaktoren. Die in Deutschland bekannteste ist die Mannheimer Kohortenstudie.
Die Mannheimer Kohortenstudie beschreibt, dass in der Gesamtgruppe von Risikokindern (im Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe) Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Entwicklung zu beobachten sind und diese bis in das Erwachsenenalter persistieren. Aus diesem Grund ist es bereits diagnostisch bedeutsam, im Sinne einer kontext- und ressourcenorientierten Herangehensweise, Risiko- und Schutzfaktoren von Kindern mit zu erfassen und diese später für die Förder- und Behandlungsplanung zu berücksichtigen (Übersicht in Lieberz et al., 2011).
Tabelle 6 fasst bekannte Risiko- und Schutzfaktoren bei Kindern zusammen.
Tab. 6: Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern
RisikofaktorenSchutzfaktorenKindUmweltKindUmwelt