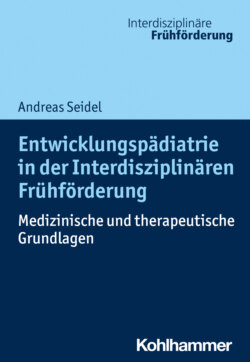Читать книгу Entwicklungspädiatrie in der Interdisziplinären Frühförderung - Andreas Seidel - Страница 9
2.2 Kindesentwicklung und mögliche Störungen der Entwicklung
ОглавлениеDie Entwicklung des Kindes wird in verschiedene Altersstufen eingeteilt:
Neugeborenes (erste 28 Lebenstage)
Säugling (1. Lebensjahr)
Kleinkind (2. bis 5. Lebensjahr)
Schulkind (6. bis 12. Lebensjahr)
Jugendliche (ab dem 13. Lebensjahr).
Die Kindesentwicklung wird von (intrinsischen) genetischen und (extrinsischen) Umweltfaktoren beeinflusst. Lange Zeit wurde darüber diskutiert, ob Entwicklung primär von genetischen oder Umwelteinflüssen geprägt ist.
Das heutige Verständnis von Kindesentwicklung ist geprägt von der Auffassung, dass beide Einflüsse, also Genetik und Umwelt, bedeutsam sind und nicht bei jedem Kind und zu jeder Zeit (und in jeder Altersstufe) anteilsmäßig festzulegen sind. Eine relevante Bedeutung genetischer Einflüsse auf die Kindesentwicklung konnte
Tab. 3: Gegenüberstellung einer biologischen und Umwelttheorie der Kindesentwicklung
Biologische Theorie der EntwicklungUmwelttheorie der Entwicklung
durch Zwillings- und Adoptionsstudien belegt werden. Dabei wurde offensichtlich, dass die Ausprägung von körperlichen Merkmalen (z. B. Körpergröße oder Kopfumfang) und von psychischen Merkmalen (z. B. Temperament, Auftretenswahrscheinlichkeit von hyperkinetischen und Aufmerksamkeitsstörungen, Teilleistungsstörungen, Intelligenz) genetisch wesentlich mitbestimmt wird. Die Genetik beeinflusst die Entwicklung eines Menschen lebenslang, nicht nur in der Kindheit. Die Entwicklung des Kindes unterliegt dabei biologischen Einflüssen und Abfolgen. Diese sind aber durch Umweltfaktoren (in einem unterschiedlichen Grad) veränderbar und somit beeinflussbar. Beim Betrachten der motorischen Entwicklung wird das beispielsweise deutlich. So können sich 95 % aller Kinder am Ende des ersten Lebensjahres, die Schwerkraft überwindend, auf irgendeine Weise fortbewegen (Baumann, 2015). Dabei folgen nicht alle Kinder einer einheitlichen Abfolge von Entwicklungsstufen. Entwicklung wird von Michaelis und Niemann (2017) als adaptive (lebenslange und interindividuell unterschiedliche) Antwort durch Erfahrung und Lernen auf bestimmte, vorgegebene ökologische und soziale Lebensbedingungen verstanden.
Die motorische Entwicklung kann durch Stimulation (und Therapie) gefördert werden; unzureichende Förderung oder ungünstige Entwicklungsbedingungen (im Extremfall: Verwahrlosung) können die Entwicklung beeinträchtigen oder hemmen. Gleiches kann auf andere Entwicklungsbereiche, z. B. die Sprache, das Spielen oder die soziale Entwicklung eines Kindes, übertragen werden. Reifungsprozesse hingegen sind genetisch determiniert und im zeitlichen und funktionellen Verlauf weitgehend festgelegt.
In der Entwicklungspsychologie wird Entwicklung als überdauernde Veränderungen des Erlebens und Verhaltens definiert. Dabei hängt die Entwicklung von den Veränderungen der Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Entwicklungsaufgaben ab. Ein erfolgreiches Bewältigen von Entwicklungsaufgaben führt zur Kompetenzerweiterung des Kindes und dazu, dass zukünftige Probleme und Entwicklungsaufgaben wiederum besser bewältigt werden können. Entwicklungsdefizite können jedoch entstehen, wenn es einem Kind nicht gelingt, seine altersentsprechenden Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen (Übersicht in Siegler et al., 2016).
Dass eine vereinfachte Zweiteilung von Genetik und Umwelt unzureichend ist, zeigt sich beim Thema der Epigenetik. Die Epigenetik beschreibt (Umwelt-) Faktoren, die die Aktivität eines Gens und damit die Entwicklung der Zelle (zeitweilig) festlegen. Dabei kann das Erbgut auf Umwelteinflüsse reagieren und abhängig davon regulieren, wann und in welchem Ausmaß welche Gene ein- und ausgeschaltet werden. Eine solche »Steuerung der Gene durch Umweltfaktoren« kann beispielsweise durch Hungerphasen erfolgen. Es gibt deutliche Hinweise dafür, dass epigenetische Phänomene sogar generationsübergreifend, zum Beispiel durch die Einflüsse des heranreifenden Kindes im Mutterleib, relevant sein können. Durch Epigenetik kann sozusagen Erfahrung vererbt werden. Ein anderes Beispiel für eine Relevanz von epigenetischen Veränderungen sind traumatische Erfahrungen (von Kindern), die auch noch nach Jahrzehnten den Zustand von Körperzellen und damit den Gesundheitszustand von Menschen beeinflussen können. Chronische Gesundheitsstörungen und Erkrankungen sind bei Menschen (Kindern) mit traumatischen Erfahrungen häufiger, z. B. unterschiedliche psychosomatische Beschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder depressive Störungen (O’Donnel & Meaney, 2020).
Schon zum Zeitpunkt der Geburt hat das Gehirn des Neugeborenen eine Neuronenzahl, die in etwa derjenigen von Erwachsenen entspricht. Es werden viele Synapsenverbindungen zwischen den Neuronen (Nervenzellen) gebildet, die im weiteren Verlauf (entwicklungs- und umweltabhängig) verändert und teilweise auch wieder eliminiert werden. Diese Umbauprozesse mit Bildung und Abbau von Synapsen erreichen ihr Maximum in unterschiedlichen Hirnarealen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Eine solche Fähigkeit, Synapsen bilden und eliminieren zu können, ist die Grundlage für eine Plastizität des Gehirns, das sich so auf veränderte Umweltbedingungen einstellen kann. Lohaus und Glüer (2014) unterscheiden dabei zwischen einer erfahrungsabhängigen und einer erfahrungserwartenden Plastizität. Erfahrungsabhängig bedeutet dabei, dass in Abhängigkeit von Umwelterfahrungen des Kindes und den erforderlichen Informationsverarbeitungen im Gehirn Synapsen entstehen oder eliminiert werden können. Erfahrungserwartende Plastizität meint hingegen, dass das Nervensystem in bestimmten Entwicklungsphasen einen spezifischen Reiz benötigt, um sich entsprechend entwickeln zu können.
Findet zum Beispiel in den ersten Lebensjahren kein Kontakt mit Sprache statt, so ist ein vollständiges Erlernen von Sprache anschließend nicht mehr möglich, das Zeitfenster für diesen Bereich der Entwicklung ist dann für immer verschlossen. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Sehentwicklung. Die Fähigkeit der Sehrinde (visueller Kortex) wird irreversibel beeinträchtigt, wenn in den ersten Lebensmonaten keine entsprechende Stimulierung erfolgt. Eine ähnliche Bedeutung erfährt das Thema des Schielens im (frühen) Kindesalter. Auch hier kann es zu bleibenden Sehstörungen (Amblyopie) bei intakten anatomischen Strukturen kommen, wenn eine notwendige Therapie (z. B. Brillenversorgung und/oder Okklusionsbehandlung) unterbleibt (Forsyth & Newton, 2012; Michaelis & Niemann, 2017).
Die Plastizität des Gehirns ist bei jungen Kindern besonders ausgeprägt, weshalb Hirnschädigungen im Vergleich zu Älteren deutlich besser kompensiert werden können. Neuronen (Nervenzellen) haben im Nervensystem verschiedene Funktionen und unterscheiden sich auch strukturell. Besonderes Interesse haben in den letzten Jahren die sogenannten Spiegelneurone erlangt. Dies sind Nervenzellen, die zunächst im Gehirn von Affen beschrieben und beim Betrachten eines Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster zeigten wie bei dessen eigener Ausführung. Auch beim Menschen gibt es mittlerweile Hinweise auf die Existenz dieser Neurone, die möglicherweise für bestimmte Verhaltensmuster, Imitation oder Empathiefähigkeit bedeutsam sein können. Zusammengenommen gibt es also vielfältige Belege, die auf eine Relevanz der genetischen, epigenetischen und neurobiologischen Befunde für die Hirnfunktion und Kindesentwicklung hinweisen (Redcay & Warnell, 2018; Niemann, 2019).
Kommt es zu Beeinträchtigungen der genetischen Regulationen oder biologischen Abfolgen vor der Geburt (also beim Heranreifen während der Schwangerschaft), können daraus angeborene Störungen der Körperfunktionen oder -strukturen resultieren. Zu solchen angeborenen Störungen gehören beispielsweise Fehlbildungen des Gehirns oder genetische Störungen, die meistens mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen einhergehen (zum Beispiel Down-Syndrom oder Fragiles-X Syndrom). Aber auch angeborene Fehlbildungen (zum Beispiel Fehlbildungen der Extremitäten) oder Störungen anderer Organsysteme (zum Beispiel schwere Herzfehler oder Stoffwechselstörungen) können Entwicklungsstörungen verursachen (Michaelis & Neumann, 2017; Niemann, 2019).
Bei den exogenen oder Umweltfaktoren kann zwischen sozialen und materiellen Einflüssen auf die Entwicklung unterschieden werden. Kommt es durch Umwelteinflüsse zu Entwicklungsstörungen, können diese erworbenen Störungen in prä-, peri- und postnatale Ursachen unterteilt werden.
Tab. 4: Mögliche Ursachen für Störungen der Entwicklung
Bei den sozialen Umweltfaktoren sind zunächst die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Der Säugling (und in einem geringeren Ausmaß das junge Kleinkind) ist unselbständig und dadurch von seinen Bezugspersonen vollständig abhängig. Dies ist für mehrere Aspekte der Entwicklung bedeutsam. Zum einen müssen diese Bezugspersonen die Grundbedürfnisse des Kindes befriedigen und in der Lage sein, Bedürfnisse des Kindes zu erkennen sowie in einer angemessenen Weise darauf zu reagieren. Gelingt dies, erlebt ein Kind die Bezugspersonen als zuverlässig. Ein solches Fürsorgeverhalten der Eltern resp. Bezugspersonen scheint evolutionsbiologisch geprägt zu sein. In der Bindungstheorie wird dabei von einem Fürsorgesystem gesprochen, das jedoch gestört sein kann. Diese frühen Interaktionserfahrungen haben Konsequenzen für die Bindungsentstehung. Erleben Kinder die soziale Umwelt als verlässlich, so empfinden sie emotionale Sicherheit. Erleben die Kinder die soziale Umwelt als nicht verlässlich, so wird eine solche emotionale Sicherheit nicht empfunden, was das Bindungsverhalten des Kindes negativ beeinflussen kann. Neben den Bindungs- und Interaktionserfahrungen ist für das heranwachsende Kind das Erziehungsverhalten der Eltern und Bezugspersonen für die weitere Entwicklung von großer Bedeutung. Dabei sind eine angemessene Lenkung, Empathie, emotionale Wärme und Responsivität im elterlichen Erziehungsverhalten für eine positive Kindesentwicklung förderlich (Übersicht in Siegler et al., 2016; Niemann 2019). Tab. 5 veranschaulicht die Bedeutung der Entwicklungsbedürfnisse, sozialen und materiellen Umweltfaktoren für das Kind.
Aber auch die materielle Umwelt hat große Bedeutung für die Kindesentwicklung. So kann eine Mangelernährung der Mutter in der Schwangerschaft die Entwicklung des heranreifenden Kindes relevant und nachhaltig negativ beeinflussen.
Tab. 5: Entwicklungsbedürfnisse des Kindes, soziale und materielle Umweltfaktoren (nach Grey, 2001)
Besonders bei den pränatalen Ursachen ist der Zeitpunkt des Einwirkens einer Schädigung bedeutsam. Während der Embryonalperiode, also bis zum Ende der 8. Schwangerschaftswoche, findet in allen Organsystemen die wesentliche strukturelle Ausgestaltung und Differenzierung statt. Dabei hat der Embryo zum Ende der Embryonalzeit eine Größe von noch nicht einmal 2cm (Scheitel-Steiß-Länge) erreicht.
Als Beispiel für eine pränatale Störung sei die Rötelninfektion (als Erstinfektion der Mutter) in der Embryonalzeit genannt. Dabei kann eine Mitinfektion des Embryos erfolgen. Eine Erstinfektion der Schwangeren mit Röteln kann in der Embryonalzeit zu einer Störung der Organentwicklung mit strukturellen Herzfehlern, Blindheit und Gehirnfehlbildung führen. Hingegen kommt es bei einer Erstinfektion der Schwangeren mit Röteln in der Fetalzeit (ab der 9. Woche) üblicherweise nicht mehr zu strukturellen Fehlbildungen. Ein anderes Beispiel für eine pränatale Störung ist die Einnahme von Alkohol durch die schwangere Mutter. Unter dem Einfluss von Alkohol in der Schwangerschaft kann es in der Embryonalzeit ebenfalls zu (bleibenden) strukturellen Organstörungen kommen sowie bei Einwirkung von Alkohol in der Fetalzeit zu bleibenden Funktionsstörungen, zum Beispiel des zentralen Nervensystems mit Verhaltensstörungen und/oder Intelligenzminderung. Die oben beschriebenen Störungen der pränatalen Kindesentwicklung können auch durch Umweltgifte, Medikamente oder Strahlenschäden verursacht werden. In der Präembryonalphase (bis zur 3. Schwangerschaftswoche) gilt das sogenannte »Alles-oder-nichts-Prinzip«, das heißt, entweder es kommt zu keiner Schädigung oder die befruchtete Eizelle stirbt ab (Michaelis & Niemann, 2017; Kliegman & St. Geme, 2019).
Beispielhaft für eine peripartale Störung sei ein relevanter Sauerstoffmangel unter der Geburt genannt. Ein solcher, relevanter Sauerstoffmangel ist durch eine entsprechende klinische Symptomatik des Kindes (z. B. keine ausreichende Eigenatmung, die Notwendigkeit von Reanimationsmaßnahmen und deutlich auffällige pathologische Vitalzeichen zur Zeit der Geburt des Kindes) gekennzeichnet. Bekannte, und im Untersuchungsheft nachlesbar dokumentierte, Vitalzeichen sind der Apgar-Wert (kritisch wäre eine Summe der Apgar-Werte nach 5 und 10 Minuten von unter 15) oder ein pathologischer Nabelarterien-pH. Hierdurch kann es zu einer schweren Hirnfunktionsstörung und/oder bleibenden (strukturellen) Schädigung (zum Beispiel Zerebralparese) des zentralen Nervensystems kommen. Besonders Frühgeborene sind durch die Unreife der Organsysteme (hier des Gehirns) bei Geburt von peripartalen Komplikationen bedroht. Solche Komplikationen, wie zum Beispiel Hirnblutungen, können dann zu bleibenden Schädigungen der Gehirnstruktur und -funktion führen.
Die häufigsten postnatal erworbenen Entwicklungsstörungen sind heute durch ungünstige Entwicklungsbedingungen der Kinder bedingt. Als materieller Umweltfaktor bleibt die Ernährung auch postpartal relevant. Eine qualitativ hochwertige, alters- und kalorisch angepasste Mischkost ist für Kinder in jedem Entwicklungsalter zu empfehlen. Mit dem Beginn der Ernährung des Kindes nach der Geburt wird schon sehr früh auf Ernährungs- und Essgewohnheiten Einfluss genommen. Diese haben im weiteren Leben eine hohe Stabilität und können im Entwicklungsverlauf das (Gesundheits-) Verhalten relevant beeinflussen (Kliegman & St. Geme, 2019).
Weitere Beispiele für postpartale Störungen sind Zustände nach Unfällen oder nach einer körperlichen Misshandlung. Nach einem Schädel-Hirn-Trauma, insbesondere dann, wenn es bei einem solchen Unfall zu einer relevanten Durchblutungsstörung oder zu strukturellen Hirnschäden gekommen ist, sind nachfolgende Entwicklungsstörungen häufig. Schwere Residualsyndrome, das heißt bleibende strukturelle Körperschädigungen, insbesondere des zentralen Nervensystems, und Todesfälle können nach einem Schütteltrauma (»battered child«), als einer Form einer körperlichen Mißhandlung, auftreten.
Sogenannte akute lebensbedrohliche Ereignisse (Acute Life Threatening Event, ALTE), die als eine »Vorstufe« des plötzlichen Kindstodes (SIDS: sudden infant death syndrome) verstanden werden, können durch eine länger dauernde Kreislaufdeprivation und Funktionsstörung des Gehirns ebenfalls zu bleibenden Schädigungen des zentralen Nervensystems führen (Forsyth & Newton, 2012).