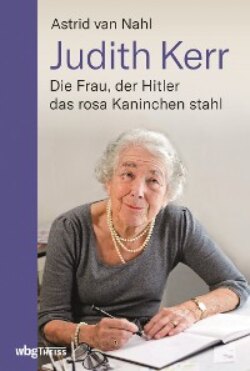Читать книгу Judith Kerr - Astrid van Nahl - Страница 7
Eine Kindheit in Berlin (1923–1933) Unruhige Zeiten
ОглавлениеDer 31. Juli 1919 war ein wichtiger Tag in der Geschichte Deutschlands: Die Nationalversammlung in Weimar, Thüringen, verabschiedete nach dem Ersten Weltkrieg die Verfassung der neuen deutschen Republik, am 11. August 1919 setzte Friedrich Ebert seine Unterschrift darunter. Eine kurze demokratische Phase begann, bekannt unter dem Namen Weimarer Republik und benannt nach dem Ort, an dem eben diese Nationalversammlung getagt hatte.
Vorausgegangen waren dramatische Ereignisse zum Ende des Ersten Weltkriegs. Deutschlands Niederlage war zugleich das Ende des Deutschen Kaiserreichs: Wilhelm II. dankte ab und floh in die Niederlande ins Exil. Aber noch waren die alten monarchischen Eliten des Kaiserreichs mächtig, die nach der „alten Ordnung“ riefen. Die unmittelbaren Folgen und Probleme eines verlorenen Krieges, wirtschaftliche Not, Arbeitslosigkeit, Putschversuche, politische Morde und Wirren einer nachfolgenden Revolution kennzeichnen den Sommer und Herbst 1918 – Bedrohungen, die sich letzten Endes als so groß erwiesen, dass die junge Weimarer Republik ihnen nicht länger als 14 Jahre standhalten konnte. Ahnte Philipp Scheidemann, SPD-Politiker und Symbolfigur der Weimarer Republik, den Ernst der Lage, als er am Nachmittag des 9. November 1918 von einem Balkon des Reichstags die Republik ausrief?
„Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik! Der Abgeordnete Ebert ist zum Reichskanzler ausgerufen worden. Ebert ist damit beauftragt worden, eine neue Regierung zusammenzustellen. Dieser Regierung werden alle sozialistischen Parteien angehören. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin, diesen glänzenden Sieg, diesen vollen Sieg des deutschen Volkes, nicht beschmutzen zu lassen …“. (Von einem, der dabei war)
Es sind vor allem die Namen mancher historischen Persönlichkeiten aus der Weimarer Republik, die heute noch in Erinnerung sind: eben jener Sozialdemokrat Friedrich Ebert, den die Nationalversammlung zum Reichspräsidenten und Staatsoberhaupt wählte; Gustav Stresemann von der Deutschen Volkspartei, der sechs Jahre lang, von 1923 bis 1929, als deutscher Außenminister wirkte; Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, beide ursprünglich vom linken Flügel der SPD, die aufgrund ihrer Aktivitäten rund um die von ihnen gegründete KPD und ihres Engagements 1919 verhaftet und wenig später – es sollte nach einer spontanen Tat Unbekannter aussehen – von Mitgliedern des Freikorps erschossen wurden; Rosa Luxemburgs Leiche wurde in den Berliner Landwehrkanal in der Nähe der heutigen Lichtensteinbrücke geworfen …
Unruhige Zeiten warteten auf die Menschen in vielen Teilen Deutschlands, etwa die kommunistischen Aufstände in Sachsen, Hamburg und im Ruhrgebiet oder die Münchner Räterepublik, die mit der Ermordung ihres Vorkämpfers Kurt Eisner auf offener Straße 1919 blutig niedergeschlagen wurde und 1920 bereits Geschichte war. 1923 unternahm Adolf Hitler am 8./9. November einen Putschversuch, zusammen mit Erich Ludendorff und anderen Putschisten, als sie in München mit einem Marsch auf die Feldherrenhalle die Macht an sich zu reißen versuchten. Im Falle eines Sieges war ein Marsch auf Berlin geplant, sicherlich in Anlehnung an den glorreichen Marsch Mussolinis auf Rom vom 27. bis 31. Oktober 1922, der das Land in die totalitäre Diktatur führen sollte. Hitlers Putschversuch scheiterte; stattdessen kam er für einige Zeit ins Gefängnis und schrieb dort bis zu seiner Entlassung im Dezember 1924 seine politisch-weltanschauliche Schrift Mein Kampf.
Ein historischer Augenblick: der 9. November 1918. Philipp Scheidemann ruft auf dem Balkon des Deutschen Reichstags die Republik aus.
Ähnlich unruhig sah auch in Berlin die Welt aus, in die am 14. Juni 1923 Judith Kerr als zweites Kind des Theater- und Literaturkritikers Alfred Kerr und seiner Frau Julia geboren wurde: eine angespannte, revolutionäre Zeit, die zwischen 1918/19 und Ende 1932 insgesamt 22 verschiedene Regierungen ertrug – untrügliches Zeichen für die Instabilität des politischen Systems. Und doch – trotz aller Wirren der Weimarer Republik: Sie bot auch eine gewisse Sicherheit und Stabilität, allein durch das beginnende Wirtschaftswachstum.
Sicherheit und Stabilität – sie spiegeln sich wider in dem bis heute faszinierenden Begriff der „Goldenen Zwanziger“, den Jahren von etwa 1924 bis 1929, die – wie fast nach jedem Krieg – eine Art kultureller Blütezeit mit sich brachten und Raum boten für die Entwicklung von Kunst, Kultur und Wissenschaft. Dies galt ganz besonders für die Hauptstadt Berlin, die in kurzer Zeit zu einem der weltweit bedeutendsten Zentren auf allen drei Gebieten avancieren sollte.
Auch der Alltag änderte sich nun. Unter dem Stichwort „Der Rundfunk in der Weimarer Republik“ zeugen auf der Webseite des WDR, des Westdeutschen Rundfunks, 34 Schwarz-Weiß-Fotos mit ausführlichen Kommentaren von den Anfängen des Rundfunks nach dem Ersten Weltkrieg: Galten Rundfunkübertragungen bis dahin fast ausschließlich als Kommunikationsmittel des Militärs, wurde nun die drahtlose Sendetechnik erstmals auch privat für die Allgemeinheit genutzt; der öffentliche Rundfunk startete am 29. Oktober 1923 – und etablierte sich bald, wie auch der Film, als Massenmedium.
„Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland zahlreiche Lichtspielhäuser, in denen Stummfilme vorgeführt wurden. In den Jahren der Weimarer Republik konnte sich der Film als einflussreiches Massenmedium etablieren, die Lichtspielhäuser nahmen einen rasanten Aufstieg. Deutschland war der europäische Staat mit den meisten Kinos, deren Anzahl zwischen 1918 und 1930 von 2.300 auf 5.000 anwuchs. Mitte der 1920er-Jahre gingen auf der Suche nach Unterhaltung und Freizeitvergnügen täglich etwa zwei Millionen Menschen in die Kinos. Für ihr Eintrittsgeld bekamen sie neben dem Hauptfilm kurze Vorfilme, gelegentlich Natur- oder Reisefilme und stets die Wochenschau zu sehen.“ (Scriba 2007)
Vor allem die feine Gesellschaft fand hier ihre vergnügliche Ablenkung, zum Beispiel in dem Lichtspielhaus Marmorhaus, wo im Februar 1920 ein Meilenstein der deutschen Filmgeschichte uraufgeführt wurde, Das Kabinett des Dr. Caligari. Oder man besuchte das Varieté im Wintergarten; noch heute wirbt die Webseite des Wintergarten mit den Worten: „Hier trifft sich die Welt in der einzigartigen Atmosphäre aus Spiegeln, edlem Holz, dunkelrotem Samt und dem legendären Sternenhimmel.“
Deutsche Ingenieure hatten Geräte entwickelt, um 1922 den ersten Tonfilm zu präsentieren, und auf der Deutschen Funkausstellung in Berlin 1928 faszinierte die erste Vorführung von Fernsehbildern. Schon zwei Jahre früher, 1926, hatte in Deutschland das erste Selbstwähltelefon ohne „Fräulein vom Amt“ funktioniert – der Beginn einer Kommunikationstechnik, die noch heute zu keinem Ende gekommen zu sein scheint.
Die Wissenschaft blühte, und man tat alles, sie zu befördern; nährte sie doch auch bei den Politikern die Hoffnung, dass gerade die Wissenschaft helfen konnte, das verlorene internationale Ansehen wieder aufzubauen. Schließlich galt es, die vielleicht größte bis dahin bekannte Nachkriegskrise zu bewältigen. Zahlreiche Nobelpreisträger aus Deutschland legten dafür beredtes Zeugnis ab: zwei Friedensnobelpreise, zwei für Medizin, vier für Physik (darunter einer für Albert Einstein), acht für Chemie und ein Nobelpreis für Literatur (Thomas Mann).
Den Spuren der technischen Erfindungen und Entwicklungen der Zeit kann man noch heute in Berlin nachgehen, zum Beispiel im Technik-Museum mit seinen historischen Flugzeugen und Autos. Aber nicht nur in der Technik, auch in der Kunst, in Malerei und Architektur, in Musik und Literatur fand die neue Zeit ihren Ausdruck und wurde vielleicht sogar deutlicher wahrgenommen durch sichtbare Gegensätze, die sich zu formieren begannen. Den Kriegsinvaliden und dem Elend der Armen stand bald eine feinere und vornehmere Gesellschaftsschicht gegenüber; der luxuriöse Lebensstil dieser Hautevolee, der sogenannten besseren Gesellschaft, griff zusammen mit einer Aufbruchs- und Modernisierungsstimmung um sich, besonders in intellektuellen Kreisen.
George Grosz: Republikanische Automaten, Aquarell 1920. New York, Museum of Modern Art.
Vor allem in Berlin erblühte in Abkehr von wilhelminischen Traditionen die Kultur- und Kunstszene auf verschiedenen Ebenen; es war eine innovative Zeit für die Musik, die den Lebensstil vielleicht am sichtbarsten und lautesten prägte, durch improvisierenden Jazz mit der spontanen Erfindung einer Melodie, durch den von Josephine Baker in Europa bekannt gemachten Charleston, der die quirligen Goldenen Zwanziger symbolisierte, oder durch die Zwölftonmusik des Arnold Schönberg mit ihrem Gegensatz von Konsonanz und Dissonanz.
In der bildenden und darstellenden Kunst ging der Expressionismus als „Ausdruckskunst“ seinem Ende entgegen und wurde vor allem in der Malerei zeitnah begleitet, wenn auch nicht ganz abgelöst, durch die sogenannte Neue Sachlichkeit, der in ihrer Entwicklung auch zahlreiche bekannte Maler des späten Expressionismus angehörten; Namen wie Otto Dix, George Grosz, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Emil Nolde – es handelte sich weitgehend um „Männerzirkel“ – verbinden sich damit.
In der Architektur blühte mit seinem Begründer Walter Gropius der Bauhaus-Stil, der eine Verbindung von Handwerk und Kunst anstrebte. Kurz: Kunst war experimentell. Heute erzählt die Berlinische Galerie von der Geschichte der modernen Kunst ab 1870, mit einem Schwerpunkt auf Dada und der Neuen Sachlichkeit, und im Bauhaus Archiv/Museum für Gestaltung kann man die Welt der Architektur und des Designs vor allem in den Plänen und Modellen von Walter Gropius bewundern.
Auch in der Literatur begann etwas wie „Neue Sachlichkeit“. Die Inhalte wurden anti-bürgerlich, politisch, sozialkritisch und sollten nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ab 1933 nicht mehr in deren Bild passen. Wie auch die Bilder etwa eines Emil Nolde sollten etliche Bücher und Beiträge verboten werden. Hier wird später auch Alfred Kerr, der damals vielleicht bekannteste Berliner Theaterkritiker und Vater von Judith Kerr, ins Spiel kommen. Die Personen dieser neuen Romane sind Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose; Durchschnittsmenschen, deren unauffälliges, unaufgeregtes Leben mit seinen Problemen und Alltagssorgen seine Darstellung findet. Die Gesellschaft ist das eigentliche Thema der Romane dieser Zeit, und sie wird in einer schnörkellosen und einfachen Weise beschrieben, in der sich die Alltagssprache samt Dialekten und Mundarten spiegelt. Der 1919 erschienene Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin mit dem Untertitel Die Geschichte vom Franz Biberkopf ist ein Paradebeispiel dafür, erzählt er doch vom Scheitern eines einfachen Lohnarbeiters. Allein die Titel bedeutender Werke verweisen auf ihre Inhalte, wie Kleiner Mann – was nun? von Hans Fallada (1932), der von bedrückenden wirtschaftlichen Verhältnissen des Verkäufers Johannes Pinneberg und seiner Freundin Lämmchen erzählt. Zur Neuen Sachlichkeit gehören ebenfalls Namen wie Hermann Hesse mit seinen Romanen Siddharta (1922) und Der Steppenwolf (1927); Heinrich Mann mit Ein ernstes Leben (1932); Erich Maria Remarque mit Im Westen nichts Neues (1928); Kurt Tucholsky mit Schloss Gripsholm (1931); Vicki Baum mit Menschen im Hotel (1929) und Veza Canetti, deren Romane zu Lebzeiten keinen Verleger fanden.
Viele dieser Autoren haben noch etwas gemeinsam: Sie gingen ab 1933 ins Exil. Aber gehen wir erst wieder einen Schritt zurück in die Gründerzeit, in das letzte Drittel des ausgehenden 19. Jahrhunderts, denn noch sind wir weit entfernt von dem Jahr 1923, als Judith Kerr in Berlin in eine gebildete, wohlhabende Familie hineingeboren wird.