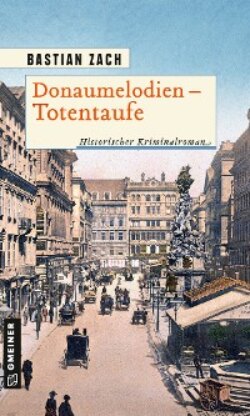Читать книгу Donaumelodien - Totentaufe - Bastian Zach - Страница 13
V
ОглавлениеUnweit jener Stelle, an der sich auf dem weitläufigen Wienerfeld neben Wirtshäusern Leim- und Beinsiedereien angesiedelt hatten, wo die Pottendorfer Bahn in die West-Donaulände-Bahn mündete und sich der Liesingbach idyllisch durch das Blumenthal schlängelte, ragten mehr als drei Dutzend Rauchfänge in den Morgenhimmel. Die Rauchwolken, die sie ausstießen, verdunkelten zuweilen die Sonne, die Fassaden der umliegenden Häuser waren rußgeschwärzt. Selbst das Regenwasser, das sich in Lacken und in Fahrrinnen gesammelt hatte, schimmerte so schwarz wie Erdöl. Ein brandiger Geruch war allgegenwärtig, gleich so, als könnte jeden Augenblick alles um einen herum in Flammen aufgehen. Ein Moloch im Süden der Kaiserstadt …
Und doch wurde hier das Herzstück dessen hergestellt, ohne das es keine Stadterweiterung Wiens und keine Prachtbauten an der neuen Ringstraße geben konnte – der Ziegel.
Nach dem Tod des patriarchalen Unternehmers Alois Miesbach, der 1820 den alten k.k. Fortifikations-Ziegelschlag gepachtet hatte, übernahm dessen Neffe Heinrich Drasche 1857 die Geschäfte. Dank der regen Bautätigkeit, die eine schiere Unmenge an Ziegeln verschlang, erweiterte er kontinuierlich die Fabrik und steigerte die Jahresproduktion auf weit über einhundert Millionen Stück des Baumaterials, was ihm im Volksmund den Spitznamen »Ziegelbaron« einbrachte. Europas nunmehr größte Ziegelfabrik warf enorme Profite ab – mit den Aktien allein vermehrte Drasche sein Vermögen um fast eine halbe Million Gulden pro Jahr. Dennoch ließ er für seine Arbeiter Wohnhäuser erbauen, für die er gar bei der Pariser Weltausstellung 1867 ausgezeichnet wurde, gründete eine werkseigene Versicherung für Invaliden und Pensionisten und spendete große Summen für humanitäre Stiftungen. 1870 wurde er zum Ritter von Wartinberg ernannt.
Trotzdem war die Lage der Arbeiter äußerst prekär. Sie kamen hauptsächlich aus den östlichen Kronländern des Kaiserreiches mitsamt ihren Familien – die »Ziegelbehm«. So säumten einige Kinder die Straße, auf der eine Kutsche mit zwei Fahrgästen unterwegs war, und erbettelten sich ein Zubrot für ihre Familien.
Franz seufzte ob des traurigen Anblicks, dann schnäuzte er sich in die Hand und besah das Ergebnis: ein dunkler, stellenweise schwarzer Schleim.
»Früher haben wir Kathedralen erbaut, um näher am Herrgott zu sein. Heute sind es diese verdammten Schornsteine.«
Hieronymus, der in der Kutsche neben ihm saß, maß ihn argwöhnisch. »Vom Beten allein kommt kein Fortschritt«, und spielte damit auf dessen früheres Leben als Mönch an.
Franz wischte sich die Hand mit einem Fetzen sauber. »Vom Beten allein kam noch nie etwas. Aber mit mehr Respekt gegenüber Mensch und Natur ließe sich etwas erschaffen, was nicht zulasten des einen oder anderen ginge.«
»Du solltest bei der nächsten Aktionärsversammlung als Redner auftreten. Ich bin sicher, die geschätzten Herren verzichten ob solch hehrer Ansinnen gerne auf ihre dicken Dividenden.«
Franz schnaubte verächtlich. »Die würden auf keinen Gulden verzichten, selbst wenn sie daran ersticken würden.«
Hieronymus’ Tonfall wurde lakonisch. »Wo ist die gute alte Zeit, wenn man sie braucht?«
Er griff in seine Westentasche, holte einige Kronen heraus und warf sie Richtung der bettelnden Kinder, die sie kreischend vor Freude einsammelten.
»Füttern S’ doch nicht die Gschropp’n«, echauffierte sich der Kutscher. »Sonst bing’ ma die Böhm gar nicht mehr an! Sie wissen doch, wie’s so schön heißt: Es gibt nur a Kaiserstadt. Es gibt nur a Wien. Die Wiener san draußen, die Böhm, die san drin.«
Hieronymus lachte schallend auf. »Da haben S’ wohl recht«, meinte er und machte eine kurze ernste Pause. »Ich komm übrigens aus Prag.«
Der Kutscher zuckte zusammen, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen.
»Und ich aus Königsberg in Ostpreußen«, setzte Franz nach. »Aber das macht bei Ihnen wahrscheinlich keinen Unterschied, weil ich eh nur ein Krüppel bin.«
»Entschuldigen S’, die Herrschaften, ich wollte nicht –«
»Fahren S’ einfach und halten S’ den Mund«, sagte Hieronymus in scharfem Ton. »Und hoffen S’, dass die Böhm nicht auch noch lernen, wie man eine Kutsche lenkt, sonst sind das bald Ihre Gschropp’n, die um Almosen betteln. Denn im Gegensatz zu Ihnen sind die Böhm fleißig und freundlich.«
Der Kutscher nickte mehrmals und murmelte ein »Sehr wohl, der Herr.«
Die Kutsche bahnte sich ihren Weg durch den kleinen Vorort Inzersdorf am Wienerberg, dessen schmutzig wirkende Häuser sich an die Hauptstraße reihten. Im Osten lag die vor vier Jahren gegründete private »Heilanstalt für Nerven- und Gemüthskranke«, im Westen das Drasche-Schloss mit einer prächtigen Parkanlage. Am Ende der Hauptstraße bog die Kutsche rechts in die Triester Straße ein, wo sie, nachdem sie den Liesingbach und den Gleiskörper der West-Donaulände-Bahn überquert hatte, vor dem schmiedeeisernen Portal der Ziegelwerke anhielt.
Hieronymus entlohnte den Kutscher, nicht ohne sich mit einem freundlichen »Děkuju« zu bedanken. Dann fegte er mit der Handfläche den Staub der Straße von seinem Raglanmantel, setzte sich einen steifen Hut auf, zog sich weiße Handschuhe an und klemmte sich ein Monokel vor das rechte Auge. Mit einer zu allem entschlossenen Miene deutete er mit seinem Flanierstock auf die Einfahrt.
»Wohl an, mein treuer buckliger Gefährte!«
Franz unterdrückte ein Grinsen. »Wen stellen wir denn heute dar?«
»Lass dich überraschen!«
Die beiden Männer durchschritten das schmiedeeiserne Portal, wo sie sogleich von einem dicklichen Portier lautstark in Empfang genommen wurden.
»Habe die Ehre, die Herren! Wen darf ich untertänigst melden?«
Franz sah Hieronymus erwartungsvoll an.
»Vojtěch von Martinic, mein Bester«, schmetterte Hieronymus ohne jede Scham hinaus, einen böhmischen Dialekt intonierend. »Nachlassverwalter derer von Rosenberg. Ich komme, um einen Ihrer Arbeiter aufzusuchen, einen gewissen Leoš Svoboda.«
Der Portier nickte ernst, als wären ihm die genannten Personen von Begriff. »Sehr wohl, Herr von Martinic. So darf ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich keine derartige davon habe, ob der genannte Böhm – ich meine, ob der genannte Herr bei uns unter Lohn steht«, sagte er und beendete die unnötig komplizierte Wortaneinanderreihung samt Korrektur mit einem knechtischen Lächeln, gefolgt von beharrlichem Schweigen.
Hieronymus wartete einen Augenblick, ob er den Portier richtig einschätzte. Dann griff er in die Tasche seines Mantels, holte einen Gulden hervor und drückte diesen dem Mann in die Hand.
»Wohl aber«, fuhr der Portier fort, als wäre nichts gewesen, »führt unsere Schreibstube genauestens über alle Angestellten Buch. Wenn S’ bittschön da nach vorn gehen, ins dritte Gebäude zu Ihrer Rechten, in den zweiten Stock.«
Hieronymus tippte an den Rand seines Hutes und machte sich auf den Weg zum Werksgelände. Franz folgte ihm, ohne dem Portier einen Blick zu schenken.
Je näher sie den Verwaltungsgebäuden der Ziegelfabrik kamen, umso lauter wurde der Lärm, der von den Hallen und Öfen her dröhnte, und umso stickiger wurde die Luft. Doch nun, da Hieronymus und Franz in dem sauber weiß ausgekalkten dritten Gebäude im zweiten Stock standen, drängte sich ihnen der Eindruck auf, sie befänden sich mehr in einem Sanatorium denn auf einem Fabriksgelände. Junge Männer in sauberer dunkler Kleidung eilten die Gänge entlang, schweigend und dienstbeflissen.
»Ich wart besser hier«, meinte Franz mit gedämpfter Stimme. »Die sollen sich auf das besinnen, was du ihnen anschaffst, und nicht auf einen hübschen Lackl8 wie mich.«
Hieronymus nickte knapp. Ohne anzuklopfen, öffnete er die erstbeste Tür und trat in den hellen Raum, in dem sich vier Schreibschränke befanden. An ihnen arbeiteten vier Angestellte emsig, jeder eine Feder in der Hand.
Alle Blicke richteten sich auf ihn.
»Gestatten: Vojtěch von Martinic, Nachlassverwalter derer von Rosenberg«, sprach er in gleicher Manier wie zum Portier und mit dem gleichen böhmischen Dialekt. »Ich bin auf der Suche nach einem Ihrer geschätzten Arbeiter, Leoš Svoboda.«
Die vier Männer wirkten verunsichert. Schließlich stand einer von ihnen auf. »Wissen der Herr zufällig, welche Position der Genannte innehat?«
»Lehmscheiber, wie mir zu Ohren gekommen ist«, antwortete Hieronymus.
»Bitte um einen Augenblick Geduld.« Mit diesen Worten eilte der junge Mann aus dem Raum.
Daraufhin nahmen die restlichen drei Männer ihre Schreibtätigkeiten wieder auf. Alle waren in dunkle Hosen gekleidet, wie Hieronymus bemerkte, in weiße Hemden und dunkle Westen, das Haar mit Pomade gescheitelt. Einer wie der andere, kam ihm in den Sinn, wie Zahnräder in einem Uhrwerk. Funktionierend und austauschbar.
Als einziger Schmuck hingen an einer Wand zwei Bilder, mit kräftigen Farben gemalt. Eines zeigte den Wienerberg, wie er vor einhundert Jahren ausgesehen haben musste, überzogen von üppiger Vegetation. Das zweite zeigte die Ziegelfabrik, umringt von geschönter Flora. Ein eigentlich trauriger Vergleich, sinnierte Hieronymus, vorher und nachher. Und doch erzeugten die beiden Bilder in ihm eine plötzliche Erkenntnis –
In dem Moment kam der junge Mann wieder. Ihm folgte ein vierschrötiger Kerl, der wirkte, als würde er an den Ringöfen arbeiten, nicht in der Verwaltung.
»Konrad Feigl mein Name«, sagte er ohne Umschweife, »Sie suchen einen unserer Arbeiter?«
Hieronymus nickte und wollte gerade Anstalten machen, sich ebenfalls vorzustellen, als der andere bereits wieder sprach. »In welcher Angelegenheit suchen S’ ihn?«
»In einer, die eine gewisse Form der Diskretion erfordert«, antwortete Hieronymus mit Blick auf die vier Schreiberlinge im Raum.
»Folgen S’ mir.«
Nachdem die beiden Männer mehrere Räume durchschritten hatten, die völlig ident wirkten, kamen sie schließlich in ein kleines Zimmer, in dem dicke Bücher in Regalen bis zur Decke gestapelt waren, alle am Rücken mit handschriftlichen Kürzeln versehen. Feigl wies seinem Gast einen Stuhl zu und suchte dann die Regale ab. Irgendwann zog er einen Wälzer heraus, setzte sich an seinen Sekretär und überflog die Seiten darin.
»Svoboda, Svoboda … ah! Hier ist er. Leoš Svoboda, fein säuberlich gelistet im Beschäftigtenverzeichnis. Hat bei uns als Sandler angefangen.« Er blätterte mehrmals vor und zurück, überflog die Spalten voll handschriftlicher Eintragungen. »Mhm … mhm.«
Feigl runzelte die Stirn. Wortlos stand er auf und verließ den Raum.
Hieronymus nahm das Monokel ab und versuchte zu lesen, was die Einträge besagten, konnte aber nicht viel erkennen.
Gleich darauf kam Feigl zurück, ein kleines Buch in der Hand.
»Sie sind mir noch eine Antwort schuldig«, sagte er, während er wieder beim Sekretär Platz nahm. »Was wollen Sie von unserem Arbeiter?«
Hieronymus klemmte sich das Monokel wieder vor das Auge. »Zunächst einmal: Mein Name ist Vojtěch von Martinic, meines Zeichens Genealoge und Nachlassverwalter derer von Rosenberg. Fürst Zdeněk von Rosenberg, Gott möge seiner Seele gnädig sein, ist erst vor Kurzem von uns gegangen. Die Syphilis kannte leider kein Erbarmen. Da er selbst keine Nachkommen hatte, obliegt es nun mir, etwaige Berechtigte bezüglich einer Erbschaft ausfindig zu machen. Und da tauchte, via mütterliche Linie, Leoš Svobodas Name auf.«
Hieronymus machte ein feierliches Gesicht, als hätte er die Bundeslade entdeckt.
Feigl teilte zwar nicht die Begeisterung des anderen, jedoch schien er die Geschichte zu glauben. »Ich wünschte, ich könnte nun sagen, dass ich mich für den Herrn Svoboda freue –« Er machte eine unnötig lange Pause. »Aber das wäre schlicht gelogen.«
Er schlug das mitgebrachte Buch auf, blätterte wieder darin. »Das ist das Arbeitsbuch des besagten Herrn. Hier wird auch jedwedes Vergehen penibel dokumentiert. Und meiner Seel’, das sind derer viele.«
Hieronymus versuchte, überrascht zu wirken, auch wenn er es nicht war.
»Ein Raufbold war er und ein Trangler9.« Feigl schüttelte verständnislos den Kopf. »Manchmal sogar ein Aufrührer.«
»Er war?«
Der Angestellte nickte und las den Eintrag, während er sprach. »Am Ersten des letzten Monats haben wir uns von ihm getrennt. Er war zum wiederholten Male dermaßen trunken, dass er seine Scheibtruhe10 samt Ziegel umkippen ließ, wobei viele der Werkstücke zu Bruch gingen. Ein solches Verhalten ist unentschuldbar.«
Innerlich seufzte Hieronymus tief und schwer. Etwas in der Art hatte er bereits befürchtet. Und nachdem Leoš nicht zu seiner Frau zurückgekehrt war, konnte er Gott weiß wo sein. Äußerlich jedoch war er um Räson bemüht.
»Sie wissen nicht, wo ich den Herrn Svoboda finden könnte?«
Feigl blätterte das Arbeitsbuch durch, schlug es schließlich zu. »Laut eigener Angabe ist er verheiratet, jedoch wohnt seine Familie nicht am Werksgelände. Fragen S’ in der Werkskantine nach. Mehr fällt mir dazu nicht ein.«
Hieronymus erhob sich. »Verbindlichsten Dank, Herr Feigl. Wenn Sie mir das Buch aushändigen könnten, dann –«
»Ist Werkseigentum«, knurrte der Angestellte und gab damit zu verstehen, dass sein Entgegenkommen hier endete.
»Dann danke ich für Ihre Zeit und empfehle mich.« Hieronymus schritt zur Tür, hoffend, dass dem anderen nicht noch die eine oder andere tiefschürfende Frage einfiel.
Die stickige Luft der Werkskantine raubte Hieronymus und Franz beinahe den Atem. Ein Gemisch aus Schweiß und Moder, aus abgestandenem Wein und Ausdünstungen jeglicher Art paarte sich mit dem Brandgeruch aus den Brennöfen. Die Lehmarbeiter, die in der Kantine mehr herumlungerten denn saßen oder standen, wirkten wie Schatten ihrer selbst – ausgelaugt, müde und bar jeder Hoffnung. Ihre Arbeitskleidung, blaue Hose und Janker, schienen sie im Frühjahr angezogen und seither nicht mehr ausgezogen zu haben.
Franz seufzte. »Du bleibst besser draußen. Ich denke nicht, dass auch nur eine Seele hier mit einem Frackträger wie dir sprechen will.«
Hieronymus machte einen Schritt zurück. »Dann werde ich zu Anna Rebiczek fahren, das Foto ihrer Lucie machen.«
»Jessas, Lucie, was für ein Name! Was ist aus einer schönen Adelheid geworden? Einer anmutigen Brunhild?«
Hieronymus klopfte seinem Freund auf die Schulter. »Die sind alle im Mittelalter geblieben und lassen dich herzlich grüßen. Bis später.«
»Ja, bis später«, sagte Franz, in Gedanken längst woanders. Er fuhr fort, mehr zu sich selbst. »Nun heißt es, mit Bedacht vorgehen, sonst gibt’s noch ein Bahöl. Mir deucht, die Männer sind nicht hier, um sich an irgendetwas aus ihrem Leben zu erinnern. Die Männer sind hier, um alles zu vergessen.«
8 Kerl.
9 Säufer.
10 Schubkarren.