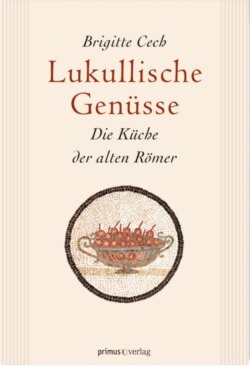Читать книгу Lukullische Genüsse - Brigitte Cech - Страница 10
ОглавлениеI.
Quellen zur
römischen Ess- und
Trinkkultur
1. Literarische Quellen
Die Texte antiker Autoren gewähren reiche Einblicke in die unterschiedlichen Aspekte der Ess- und Trinkkultur im Römischen Reich. Fast jedes Werk enthält Informationen zu unserem Thema, sei es die Gästeliste und Abfolge der Speisen bei einem Festbankett1 oder die Erwähnung des Gerichtes „Tyrotarichum“ in einem Brief Ciceros2, auf dessen Genuss er sich freut und dessen Rezept wir bei Apicius wiederfinden3. Sueton erzählt in seinen Biographien römischer Kaiser von den kulinarischen Ausschweifungen der hohen Herren, und Plutarch verdanken wir die Lebensgeschichte des Lucullus, des wahrscheinlich berühmtesten Gourmets aller Zeiten.
Auch in den Werken der Dichter wird immer wieder auf Essen und Trinken Bezug genommen, teilweise auf sehr heitere und satirische Weise. Martial beispielsweise fordert mit folgenden Worten eine Dame auf, sich den Nachtisch schmecken zu lassen:
„Wenn Du satt werden willst, kannst Du unseren Priapus verzehren; beknabberst Du auch seinen Pimmel, bleibst du doch sauber.“4
Eine der wichtigsten Quellen zu Sitten und Gebräuchen rund um Essen und Trinken ist das um 200 n. Chr. entstandene Werk des Athenaios „Gelehrte beim Gastmahl“. Im Zuge eines fiktiven Festmahles diskutieren 29 Gelehrte sehr unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel, in welchen Werken der altgriechischen Literatur ein Gewürz zum ersten Mal genannt wird, wie Festlichkeiten auszurichten sind, Partyspiele und Darbietungen für Tischgesellschaften, Kochrezepte und vieles mehr.
Ebenso bedeutend sind die im 1. Jh. n. Chr. entstandenen „Moralia“ des Plutarch, eine Sammlung von 78 Essays, in denen neben philosophischen Fragen auch Aspekte des Alltagslebens diskutiert werden.
Die wichtigsten Quellen zur Lebensmittelproduktion sind die Werke der Agrarschriftsteller Cato der Ältere, Varro und Columella, deren Handbücher über Landwirtschaft neben Anleitungen zur Führung von Landgütern ausführliche praxisnahe Ratschläge zu Vieh-, Geflügel- und Fischzucht, Acker-, Obst- und Weinbau sowie zur Konservierung von Lebensmitteln und sogar einige köstliche Kochrezepte beinhalten.
Eine schier unerschöpfliche Quelle zu Lebensmitteln und Getränken ist die „Naturkunde“ Plinius’ des Älteren. Zahlreiche Beschreibungen von Nahrungsmitteln sind eine wichtige Hilfe bei der Identifikation der in Rezepten genannten Zutaten. Daneben informiert er uns unter anderem über berühmte Weinsorten, und in amüsanten Anekdoten erzählt er von den gastronomischen Auswüchsen, deren sich römische Feinschmecker schuldig machten.
Die wichtigste Quelle zur Kochkunst der römischen Kaiserzeit ist de re coquinaria („Über die Kochkunst“), eine Sammlung von Rezepten, als deren Autor ein gewisser Marcus Gavius Apicius genannt wird. Aus den wenigen Quellen, die es zur Person des Apicius gibt, geht hervor, dass er im 1. Jh. n. Chr., zur Zeit der Kaiser Augustus und Tiberius lebte, in gehobenen Kreisen verkehrte, für seine ausschweifenden Gastmähler bekannt war und eine Villa in Minturnae besaß.5
Seneca berichtet über das dramatische Ende dieses dem Luxus ergebenen Menschen:
„Nachdem er hundert Millionen Sesterzen auf die Küche verwendet, nachdem er die zahlreichen Geschenke der Großen und das gewaltige Einkommen vom Kapitol durch eine Reihe von Gelagen vergeudet hatte und sich mit Schulden überladen sah, verschaffte er sich nun zum ersten Mal notgedrungen Einsicht in den Stand seines Haushaltes: die Rechnung ergab, dass ihm zehn Millionen Sesterzen übrig bleiben würden; es kam ihm vor, als sei ihm nunmehr ein bettelarmes Dasein beschieden, wenn er mit zehn Millionen auskommen musste, und so machte er seinem Leben durch Gift ein Ende.“6
Die Tatsache, dass die Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Senatorenstand ein Vermögen von mindestens einer Million Sesterzen war, rückt die „Armut“ des Apicius, die ihn in den Selbstmord trieb, ins rechte Licht.
In der antiken Literatur gilt Apicius als Prototyp des Feinschmeckers, dem der Tafelluxus über alles geht. Der Grammatiker Appion schrieb, wahrscheinlich im 1. Jh. n. Chr., sogar ein Buch mit dem Titel „Die Schwelgerei des Apicius“,7 und Plinius nennt Apicius mehrmals als Erfinder raffinierter Zubereitungsarten.8 Eindeutige Hinweise auf eine literarische Tätigkeit des Apicius selbst fehlen jedoch. Die Autoren und der Zeitpunkt der Entstehung der unter seinem Namen überlieferten Rezeptsammlung sind unbekannt. Das insgesamt 459 Rezepte umfassende Werk ist in zehn auf Griechisch betitelte Bücher gegliedert:
Buch 1 (35 Rezepte): epimeles (sorgsam) – Der sorgsame Wirtschafter
Buch 2 (24 Rezepte): sarcoptes – Gehacktes
Buch 3 (57 Rezepte): cepuros – Gemüse
Buch 4 (54 Rezepte): pandecter – Verschiedenes
Buch 5 (31 Rezepte): ospreon – Hülsenfrüchte
Buch 6 (41 Rezepte): tropetes – Geflügel
Buch 7 (77 Rezepte): politeles – Der Feinschmecker
Buch 8 (69 Rezepte): tetrapus – Der Vierfüßler
Buch 9 (36 Rezepte): thalassa – Das Meer
Buch 10 (35 Rezepte): halieus – Der Fischer
Das sehr praxisnahe Werk enthält nicht nur Kochrezepte, sondern auch, vor allem im 1. Buch, Anleitungen zum Konservieren von Lebensmitteln. Die Ausführlichkeit, mit der die Zubereitung beschrieben wird, schwankt stark. Viele Rezepte bestehen lediglich aus einer Auflistung von Zutaten, andere wieder zeichnen sich durch genaue Beschreibung der Kochvorgänge aus. Mengenangaben sind selten und betreffen, wenn vorhanden, meist nur die Würzmittel. Bei der Lektüre der Rezepte zeigt sich deutlich, dass es sich um eine von Köchen für Köche zusammengestellte Sammlung von Rezepten und Kochtipps handelt.
Die mit Apici excerpta a Vinidario viro illustri („Auszüge aus Apicius vom Edelmann Vinidarius“) betitelte Sammlung von 32 Rezepten wird meist zusammen mit dem Apiciustext herausgegeben, hängt mit diesem aber nicht zusammen und wurde wahrscheinlich in der Spätantike von dem im Übrigen unbekannten Vinidarius zusammengestellt.
2. Epigraphische und ikonographische Quellen
Die bei weitem wichtigste epigraphische Quelle zu unserem Thema ist das auf mehreren Inschriftentafeln in griechischer und lateinischer Sprache erhaltene Höchstpreisedikt Diokletians (siehe Anhang). Ebenfalls zu dieser Quellengattung gehören die zahlreichen Graffiti aus Pompeii und Herculaneum, die einen sehr lebensnahen Einblick in die Lebens- und Denkweise der einfachen Leute geben.
Ikonographische Quellen sind im Wesentlichen Statuen, Reliefs, Wandmalereien und Mosaiken. Zahlreiche Reliefdarstellungen auf Grabsteinen zeigen Bäcker, Fleischer, Weinbauer und andere Lebensmittelproduzenten bei ihrer Arbeit und verhelfen uns so zu einem besseren Verständnis dieser wichtigen Tätigkeiten.
Der hohe Stellenwert, den die Genüsse der Tafel im Römischen Reich hatten, zeigt sich deutlich in den zahlreichen, vor allem in Pompeii und Herculaneum, aber auch in anderen Städten und Villen Italiens und der Provinzen freigelegten Wandmalereien und Mosaiken, auf denen Speise- und Trinkszenen sowie darüber hinaus diverse Lebensmittel dargestellt sind. Diese großteils künstlerisch sehr hochwertigen Darstellungen liefern nicht nur Illustrationen zu unserem Thema, sondern beinhalten unter anderem auch wichtige Informationen zur Ausstattung von Speiseräumen, über Ess- und Trinkgeschirr, aber auch zu Lebensmitteln.
3. Archäologische Quellen
Diese Quellengruppe umfasst alle bei archäologischen Untersuchungen freigelegten Baulichkeiten wie Stadt- und Landhäuser und Militärlager. Besonders reiches Fundmaterial bieten Abfallgruben, aber auch Gräber, gab man doch den Toten auch Speisen und Getränke für die Reise ins Jenseits mit ins Grab. Aus diesen Quellen beziehen wir unter anderem unser Wissen über die Ausstattung von Speiseräumen, Küchen und Wirtschaftstrakten, aber auch über die in den Schriftquellen immer wieder erwähnten Fischteiche. Archäologische Fundstücke wie Bauteile von Mühlen und Pressen, Koch- und Tafelgeschirr, Vorratsgefäße, aber auch Gerätschaften wie Messer und Beile, Siebe, Kochlöffel und Essbesteck gehören ebenfalls zu dieser Quellengattung.
Als archäologische Quelle von großer Relevanz für die römische Lebensmittelproduktion. Backofen und Getreidemühlen in der Bäckerei des Popidius Priscus in Pompeii.
4. Archäozoologische und archäobotanische Quellen
Diese Quellengattungen beinhalten im Zuge archäologischer Grabungen geborgene Reste von Tieren (Tierknochen, Reste von Fischen, Muscheln, Schnecken, Eierschalen) und Pflanzen (Getreidekörner, Samen, Pollen), deren Studium wesentlich zum Wissen über historisch genutzte Tiere und Pflanzen beiträgt. Tierknochen beispielsweise geben Auskunft über die kulinarisch genutzten Tierarten, ihr Schlachtalter und ihre Größe. Schnitt- und Hackspuren an Knochen ermöglichen die Rekonstruktion von Schlachtung, Zerlegung und in Ausnahmefällen auch der Zubereitung. Genetische Untersuchungen an pflanzlichen und tierischen Resten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung von Domestikations- und Verbreitungsgeschichte der einzelnen Tier- und Pflanzenarten.