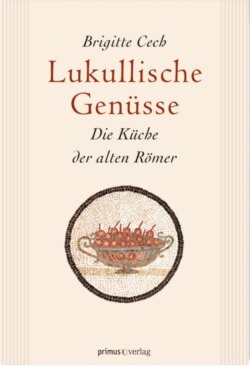Читать книгу Lukullische Genüsse - Brigitte Cech - Страница 15
4. Gastmahl
ОглавлениеNeben der bereits erwähnten cena, dem Abendessen im Familienkreis, zu dem manchmal auch Freunde eingeladen wurden, gab es das convivium, das formelle Gastmahl.
Die ideale Zahl der Teilnehmer an einem Gastmahl richtete sich nach den drei Speisesofas, die im Esszimmer standen. Laut Varro sollten es zwischen drei und neun Personen sein: „Die niedrigste Anzahl müsse bei der Anzahl der Grazien [drei] beginnen und sich höchstens nur bis zur Anzahl der Musen [neun] steigern. […] Denn, mehr Gäste einzuladen, scheint deshalb weniger geeignet, weil eine größere Anzahl meist überlaut lärmt.“17
Bei größeren Gastmählern wurden die Gäste auf mehrere Speisezimmer verteilt. Macrobius berichtet von einem opulenten Festbankett, das im 1. Jh. v. Chr. anlässlich des Amtsantrittes des Lentulus als flamen Martialis (Priester des Mars) stattfand. Die Mitglieder des Priesterkollegiums, dem auch Caesar angehörte, wurden in zwei Speisesälen bewirtet, und in einem dritten Saal speisten vier Vestalinnen – die jungfräulichen Priesterinnen der Göttin Vesta –, die Gattin und die Schwiegermutter des Lentulus sowie eine weitere Frau eines Priesters.18 Von Caesar wird berichtet, dass er Gastmähler in den Provinzen so ausrichtete, dass einerseits seine Offiziere und andererseits römische Bürger und Einheimische getrennt in mehreren Sälen bewirtet wurden.19 Es scheint naheliegend, dass diese Trennung von Offizieren und Zivilisten Konflikten vorbeugen sollte, denn bei einem Gastmahl sollte Harmonie zwischen den Teilnehmern herrschen.
Natürlich konnte sich bei einem formellen Essen nicht jeder Gast dort hinlegen, wo er wollte. Das mittlere Sofa (lectus medius, auch lectus consularis genannt) war für den Ehrengast und seine Begleiter bestimmt, rechts davon war das Sofa für den Gastgeber und seine Familie (lectus imus), und das Sofa links von dem der Ehrengäste war für weitere Gäste vorgesehen (lectus summus).20 Frauen speisten gemeinsam mit den Männern, allerdings saßen sie auf Sesseln. Gemütliches Liegen auf dem Sofa geziemte sich für ehrbare Damen nicht. Erst als man in der Kaiserzeit die Sittenstrenge der Vorfahren ablegte, gesellten sich auch die Ehefrauen zu ihren Männern auf die Speisesofas, etwas, das ursprünglich nur „lockeren Frauenzimmern“ gestattet war.
Manchmal kam es auch vor, dass Gäste Freunde mitbrachten, die nicht geladen waren, die sogenannten „Schatten“ (umbrae). Ein derartiges Verhalten galt nicht als unhöflich, ein guter Gastgeber rechnete sogar damit.21 Ein bequemer Platz auf einem Speisesofa stand den „Schatten“ allerdings nicht zu, sie saßen auf dem Sofa des Gastes, der sie mitgebracht hatte. Aber das sind noch nicht alle Gäste, für die der Gastgeber zu sorgen hatte. Das Gefolge höherrangiger Gäste umfasste nicht nur die „Schatten“, sondern auch seine persönlichen Sklaven, wie zum Beispiel Leibwächter, Leibsklaven und Sekretäre, die natürlich auch, dem sozialen Stand ihres Herrn entsprechend, bewirtet werden mussten. Ein hoher Besuch war für den Gastgeber zwar eine große Ehre, stellte ihn jedoch oft vor nicht unbeträchtliche organisatorische Probleme und belastete den Geldbeutel, wie wir aus einem Brief Ciceros an seinen Freund Atticus erfahren.22 Im Dezember 45 v. Chr. bereiste Caesar die Städte Kampaniens und gab Cicero die Ehre, eine Nacht in dessen Villa in Puteoli zu verbringen. Der Diktator reiste mit großem Gefolge, zu dem neben 2000 Soldaten, die auf freiem Feld ihr Lager aufschlugen, auch zahlreiche Sklaven und Freigelassene gehörten: „Außerdem wurde sein Gefolge in drei Speiseräumen sehr anständig aufgenommen. Schon den weniger vornehmen Freigelassenen und den Sklaven fehlte es an nichts; die angeseheneren wurden geradezu exquisit bewirtet. Kurz und gut: Ich glaube, in Ehren bestanden zu haben“, berichtet der geplagte Gastgeber.
Der Speiseraum der Römer, das Triklinium, bot Platz für mehrere Gäste. Rekonstruktion im Museum von Zaragoza, dem römischen Caesaraugusta in Nordspanien.
Das Essen bestand, wie bei der cena, aus Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen, wobei es im Allgemeinen wesentlich reichhaltiger war als bei einem Abendessen im Familienkreis. Die Üppigkeit des Gastmahls war abhängig vom Kreis der Eingeladenen, dem Anlass des Gastmahls und natürlich von den finanziellen Möglichkeiten und der gesellschaftlichen Stellung des Gastgebers und seinem Verlangen nach Selbstdarstellung.
Macrobius überliefert die Speisenfolge des bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnten Gastmahls zu Ehren des Lentulus: „Vorspeisen: Seeigel, rohe Austern, so viel man wollte, Riesenmuscheln, Lazarusklappen, Drosseln auf Spargeln, Masthähnchen, Auflauf aus Austern und Riesenmuscheln, schwarze Seemuscheln, weiße Seemuscheln, noch einmal Lazarusklappen, Gienmuscheln, Seeanemonen, Feigendrosseln, Eier, Filets von Zicklein und vom Eber, mit Mehl paniertes Mastgeflügel, Feigendrosseln, Stachelschnecken und Purpurschnecken. Hauptspeisen: Milchleisten von Säuen, geräucherter Eberkopf, Fischauflauf, Auflauf von Milchleisten von Säuen, Enten, gesottene Kriechenten, Hasen, gebratenes Mastgeflügel. Nachspeisen: Mehlspeise, Picenisches Brot.“23 Ein wahrhaft opulentes Mahl!
Unabhängig davon, wie reichhaltig das Essen war, auf keinen Fall gehörte es sich, gesellschaftlich höhergestellte Gäste besser zu bewirten als die übrigen. Heftig kritisiert Plinius der Jüngere einen seiner Gastgeber: „Sich und einigen wenigen setzte er allerhand Delikatessen vor, den übrigen billiges Zeug und in kleinen Portiönchen.“24
Zu einem gelungenen Gastmahl gehörten nicht nur leibliche Genüsse, sondern auch angeregte Gespräche und ein Unterhaltungsprogramm, wobei beides die breite Palette zwischen kultiviert und ausgesprochen vulgär umspannte. Beliebt war Musikuntermalung während des Essens. In den Pausen zwischen den einzelnen Gängen gab es verschiedenartige Darbietungen: Dichterlesungen, bei denen es peinlich werden konnte, wenn der Gastgeber seine eigenen poetischen Ergüsse zum Besten gab,25 Schauspieler, die kurze Szenen aus Komödien aufführten, aber auch Vorführungen von Akrobaten, Gauklern und Tänzerinnen, anspruchslose Unterhaltung, die nicht jedermanns Sache war. Schon im Voraus versichert der Dichter Martial seinen Gästen, dass es bei seinem Gastmahl sehr kultiviert zugehen wird:
„Weder wird der Hausherr einen dicken Wälzer vorlesen,
noch werden Mädchen aus dem verruchten Gades,
während sie endlos aufgeilen,
die lasziven Hüften in kundigem Zittern kreisen lassen.
Doch was weder lästig noch reizlos sein dürfte:
Die Flöte des kleinen Condylus wird ertönen.“26
Und wer seinen Gästen etwas ganz Besonderes bieten wollte, bedachte sie mit einem Geschenk zum Mitnehmen. Trimalchio, der neureiche Freigelassene im „Satyricon“ des Petronius, lässt sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen: Er verlost die Geschenke zum Mitnehmen im Rahmen einer Tombola.27
Neben privaten und offiziellen Gastmählern gab es bei bestimmten Anlässen auch öffentliche Bewirtungen, die in der Republik von Politikern zu bestimmten Anlässen veranstaltet wurden. Natürlich rechnete der Veranstalter bei den nächsten Wahlen mit dem positiven Einfluss seiner Freigiebigkeit dem Volk gegenüber. Hatte man sich einmal dazu entschlossen, das Volk einzuladen, war Sparsamkeit nicht am Platz. Ein gewisser Quintus Tubero, der für seine altväterliche Strenge bekannt war, sollte im Jahr 129 v. Chr. für das öffentliche Gastmahl anlässlich der Begräbnisfeierlichkeiten für seinen Schwager Scipio Africanus, den Eroberer Karthagos, das Essgeschirr und die Speisesofas bereitstellen. Aus Geiz oder aus übertriebener Abneigung gegen jeden Luxus ließ er das Volk auf mit Bockfellen bedeckten Pritschen aus minderwertigem Tafelgeschirr speisen. Das Volk rächte sich für diese schäbige Behandlung und ließ ihn bei der Wahl zur Prätur prompt durchfallen.28
Caesar hingegen wusste um die Propagandawirkung großzügiger Veranstaltungen für das Volk sehr genau Bescheid und ließ im Jahr 46 v. Chr. im Anschluss an seine vier Triumphzüge über Gallien, Ägypten, Pontus und Africa 20.000 Speisesofas auf den Straßen und Plätzen Roms aufstellen und bewirtete die Bewohner der Hauptstadt aufs Fürstlichste.29 In der Kaiserzeit fanden öffentliche Bewirtungen in anderer Form statt. Die Herrscher verköstigten die Besucher der Theater oder der Arena direkt vor Ort. Jeder Besucher erhielt einen wohlgefüllten Geschenkkorb.30 Wer es geschickt anstellte, trat nach der kaiserlichen Ausspeisung mit mehreren Körben bepackt den Heimweg an.31