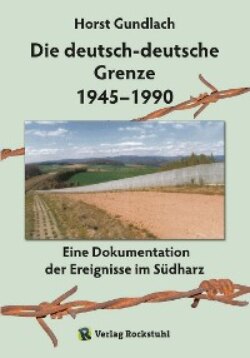Читать книгу Die deutsch-deutsche Grenze 1945–1990 - Dr. Horst Gundlach - Страница 14
Juliushütte und Wiedigshof
ОглавлениеDie beiden zu Walkenried gehörenden Örtlichkeiten „Juliushütte“ und „Wiedigshof“ spielten in den ersten Nachkriegsjahren für viele Grenzgänger eine wichtige Rolle, da sie auf dem Weg zwischen dem Bahnhof Walkenried und dem Bahnhof Ellrich unmittelbar an der Demarkationslinie lagen. Es erscheint daher angebracht, zu diesen beiden nachstehend einige Informationen zu geben.
Hilfreiche Unterstützung beim Gepäcktransport über die Grenze (Foto: E. Meyer)
Die Juliushütte, die ihren Namen dem Fabrikanten Julius Bergmann verdankte, der etwa um 1884 unmittelbar vor den Toren Ellrichs eine Gipsfabrik errichtet hatte, war bis Kriegsende zu einer kleinen Siedlung mit Produktionsgebäuden, Wohnhäusern, Schuppen und Stallungen angewachsen. Es lebten dort zeitweilig über 100 Menschen. Die meisten der dort ansässigen Familien waren in der Holzmehlfabrik von Armin Trinks beschäftigt, die dieser nach Einstellung der Gipsproduktion in den verlassenen Gebäuden des früheren Gipswerkes etwa um 1936 gegründet hatte. 1944 mussten die Wohngebäude der Juliushütte für die Wachmannschaften des dort neu entstandenen, unmittelbar angrenzenden Konzentrationslagers „Erich“ geräumt werden. Erst nach Kriegsende konnten die Familien in ihre früheren Wohnungen zurückkehren. Nach dem Rückzug der Amerikaner aus Thüringen besetzten die Sowjets für mehrere Wochen die Juliushütte, mussten sich dann aber hinter die vereinbarte Demarkationslinie zurückziehen. Den Bewohnern der Juliushütte, die sich im nahegelegenen Ellrich mit allem Lebensnotwendigen versorgten und deren Kinder dort zur Schule gingen, wurden diese Möglichkeiten durch die entstandene Demarkationslinie genommen.
Grenzgänger am Tunnel. Sammlung Horst Gundlach
Für viele der zahlreichen Grenzgänger war die Juliushütte oftmals der erste Rastplatz auf Westgebiet vor dem beschwerlichen drei Kilometer langen Fußmarsch zum Bahnhof Walkenried. Gegen ein geringes Entgelt, aber oft auch kostenlos, brachten die Bewohner der Juliushütte Gepäckstücke der Grenzgänger zum Bahnhof Walkenried. Wegen der zahlreichen Grenzgänger wurde vom Landespolizeiposten Walkenried schon im Januar 1946 ein Hilfspolizist auf der Juliushütte eingesetzt, der unter anderem auch die Kontakte von Bewohnern der Juliushütte mit sowjetischen Soldaten an der nahen Grenzlinie unterbinden sollte.
Da als Folge der Grenzziehung die verbliebenen etwa 100 Bewohner der Juliushütte auch von der Bahnverbindung nach Walkenried abgeschnitten waren, wurde am 27. Juni 1946 vom Bahnhof Walkenried ein Pendelverkehr zu einer provisorischen Haltestelle an der Juliushütte, die nur etwa 300 m von der Demarkationslinie entfernt lag, eingerichtet.
Am 4. August 1955 brannte die Holzmehlfabrik ab. Da an einen Wiederaufbau nicht zu denken war, verließen die letzten verbliebenen Bewohner von 1960 an die Juliushütte und fanden im Ort Walkenried neue Unterkünfte. Die Gebäude verfielen allmählich und ihr trostloser Anblick wurde in den folgenden Jahren öfters von den Medien der DDR zur Propaganda gegen die BRD genutzt. Im Juni 1964 wurden dann auf Initiative der Bundes- und der Landesregierung die drei noch vorhandenen Wohngebäude, drei Fabrikschornsteine und die anderen Gebäudereste von der Bundeswehr gesprengt und das Gelände nach Beseitigung der Trümmer renaturiert.
Wiedigshof, 1990 (Foto: H. Gundlach) Die Juliushütte um 1960 (Foto: P. Schmelter)
Wiedigshof, 1990 (Foto: H. Gundlach) Die Juliushütte um 1960 (Foto: P. Schmelter)
Der heutige Ortsteil von Walkenried „Wiedigshof“ hat seinen Ursprung in dem zur ehemaligen Domäne Walkenried gehörenden, gleichnamigen Vorwerk, das ungefähr drei Kilometer von Walkenried entfernt, direkt an der braunschweigisch-preußischen Grenze lag. Die entlang der alten Landesgrenze gezogene Demarkationslinie grenzte von 1945 an somit unmittelbar an das Gelände des Wiedigshofes. Für zahlreiche Grenzgänger war der Hof daher häufig Ausgangs- oder Zielpunkt für die illegale Grenzüberschreitung. In den ersten Nachkriegsjahren war der Hof öfters auch das Ziel von Übergriffen der in unmittelbarer Nähe stationierten sowjetischen Posten. In den Jahren 1953 bis 1956 wurde das Vorwerk des Stiftsgutes zusammen mit diesem aufgesiedelt; auf den ehemaligen Gutsflächen entstanden landwirtschaftliche Betriebe für Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten.