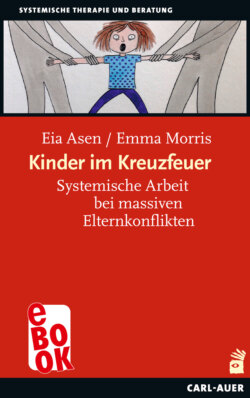Читать книгу Kinder im Kreuzfeuer - Eia Asen - Страница 10
1.2Elterliche Trennung und ihre Auswirkungen auf Kinder
ОглавлениеDie Trennung der Eltern verursacht bei Kindern normalerweise starke Gefühle, die von Kummer bis hin zu Angst und von Traurigkeit bis hin zu Wut reichen können (Kelly a. Emery 2003). Häufig werden Kinder von den Eltern über eine bevorstehende Trennung oder Scheidung und die Gründe dafür unzureichend informiert, und ihnen wird nur wenig über die langfristigen Implikationen für die zukünftige Familienstruktur und für Kontakt- und Wohnregelungen mitgeteilt – meist weil sich die Eltern darüber selbst nicht im Klaren sind. Zieht ein Elternteil aus dem Heim der Familie aus, kann es sein, dass der zurückbleibende Elternteil den Auszug des Expartners anders darstellt als derjenige, der das Heim verlässt. Die Kinder wissen dann oft nicht, welche Darstellung die »richtige« ist. Vom Zeitpunkt der physischen Trennung an ist es oft so, dass die Kinder den Elternteil, der sich entfernt hat, seltener und manchmal wochenlang gar nicht sehen.
Es ist gut belegt, dass Zwistigkeiten und erbitterte Konflikte zwischen Eltern meist negative Auswirkungen auf die Kinder und ihre psychosoziale Entwicklung haben (Barletta a. O’Mara 2006; Holmes 2013; Bernet et al. 2016; Harold a. Sellers 2018) und dass dies so häufig der Fall ist, dass im DSM-5 (2013) die diagnostische Kategorie »Kindliche Beeinträchtigung aufgrund von Beziehungsproblemen der Eltern« (Z62.898) eingeführt wurde. Dabei geht es nicht um die Trennung selbst, sondern um den destruktiven Konflikt zwischen den Eltern, der häufig zu einer schlechten psychosozialen Anpassung der Kinder in den Jahren nach der Trennung führt (Emery 1982; Kline et al. 1991), wobei auch eine Rolle spielt, wie stark die Kinder in die Konflikte hineingezogen werden (Davies a. Cummings 1994; Buchanan a. Heiges 2001; McIntosh 2003) und ob sie das Gefühl haben, sie selbst hätten die schlechte Beziehung ihrer Eltern zueinander verschuldet (Harold et al. 2007). Obzwar einige Kinder stärker beeinträchtigt werden als andere, beinhaltet das wiederholte und längerfristige direkte Miterleben elterlicher Konflikte und Streitigkeiten grundsätzlich für alle Kinder ein beträchtliches psychisches Risiko. Dieses kann sich in Form von Angst und Depression niederschlagen sowie in Form von Verhaltensproblemen, darunter aggressiven und feindseligen Verhaltensweisen (Johnston et al. 1987; Buchanan a. Heiges 2001; Grych a. Fincham 2001; Cummings a. Davies 2002; McIntosh 2003; Harold a. Murch 2005; Jenkins et al. 2005; Holt et al. 2008; Pinnell a. Harold 2008), Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen (Bolgar et al. 1995), Loyalitätskonflikten und kognitiven Dissonanzen (Amato a. Afifi 2006) sowie starken psychosozialen Anpassungsschwierigkeiten (Kline et al. 1991). Außerdem haben betroffene Kinder später im Leben häufiger Schwierigkeiten mit dem Aufbau und der Erhaltung von Vertrauensbeziehungen.
Wenn getrennte Eltern sich in einem Dauerstreit befinden, kann sich das negativ auf ihre emotionale Offenheit ihren Kindern gegenüber auswirken, weil viele ihrer Aktionen und Reaktionen mit den laufenden Konflikten zusammenhängen, also nichts direkt mit den Bedürfnissen ihrer Kinder zu tun haben. Jeder Elternteil mag für sich in Anspruch nehmen, dass es ihm nur um das Wohl der Kinder geht, macht aber gleichzeitig dem anderen Elternteil Vorwürfe; hingegen fällt es meist beiden schwer, den eigenen Anteil an der verbitterten Atmosphäre zu erkennen. Häusliche Gewalt setzt sich nicht selten auch nach der Trennung von Eltern fort, wobei die Kontakte der Kinder zu dem Elternteil, der das Heim der Familie verlassen hat, zum Fokus weiter eskalierender Konflikte zwischen den Eltern werden. Das beeinflusst nicht nur die Kindesbeziehung zum »entfremdeten« Elternteil, sondern zu beiden Eltern negativ.