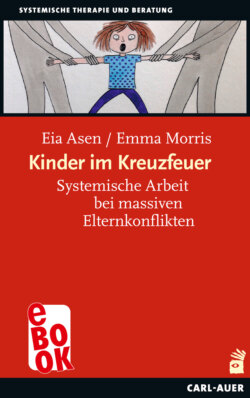Читать книгу Kinder im Kreuzfeuer - Eia Asen - Страница 11
1.3Die Debatte über Eltern-Kind-Entfremdung
ОглавлениеDer Begriff »Elternentfremdung« – »Parental Alienation Syndrome« (PAS), Gardner 1985) – bezeichnet die (augenscheinlich) ungerechtfertigte und dauerhafte Zurückweisung und Herabsetzung eines Elternteils durch ihr Kind (bzw. ihre Kinder), ausgelöst und gefördert durch die Indoktrinierung des betreuenden Elternteils, der dem anderen bewusst Liebe und Respekt des eigenen Kindes vorzuenthalten versucht (Lowenstein 2007). Das Kind entwickelt mit dem Elternteil, bei dem es wohnt, eine starke Koalition und lehnt eine Beziehung zum »zurückgewiesenen« Elternteil »ohne plausible Begründung« ab (Gardner 1998). Die Diagnose des »Elternentfremdungssyndroms« (Gardner 1985) bleibt umstritten, weil sie impliziert, dass das Kind infolge absichtlicher oder unbewusster Indoktrinierung durch einen »entfremdenden« Elternteil eine »Störung« entwickelt, oft verbunden mit allem Anschein nach banalen, falschen oder unbelegten Anschuldigungen dem entfremdeten Elternteil gegenüber. Bestätigungen der Auffassung, dass Kinder die falschen Anschuldigungen, die sie gegen den Elternteil, den sie zurückweisen, erheben, lassen sich aus einem beträchtlichen Fundus an Untersuchungen herleiten, die unter anderem auch zeigen, dass Erinnerungen leicht verzerrt und dass »falsche Erinnerungen« eingepflanzt werden können (Loftus 1997; Bruck a. Ceci 1999; Schacter 2001; Tavris a. Aronson 2007; Lilienfeld et al. 2010).
Man hat festgestellt, dass bei Kindern von stark zerstrittenen getrennten Eltern typischerweise bestimmte Verhaltensweisen zu finden sind (Baker a. Darnall 2006; Baker 2007; Baker a. Chambers 2011; Ben-Ami a. Baker 2012). Darnall (1998) unterscheidet drei Kategorien von »entfremdenden Eltern«:
1.»Naive Entfremder« verhalten sich der Beziehung der Kinder zum anderen Elternteil gegenüber weitgehend passiv und sagen oder tun nur gelegentlich etwas, das einen Entfremdungsprozess initiieren kann.
2.»Aktive Entfremder« wissen, dass das, was sie tun, falsch ist, wirken aber trotzdem entfremdend, um mit ihrer persönlichen Verletztheit und Wut fertigzuwerden – aufgrund ihrer eigenen emotionalen Verletzlichkeit oder ihrer mangelnden Impulskontrolle.
3.»Besessene Entfremder« fühlen sich im Recht, wenn sie den anderen Elternteil verletzen und die Beziehung des gemeinsamen Kindes zu ihm zerstören, und lassen nur selten Selbstkontrolle oder Einsicht erkennen.
Weitere, einander überschneidende Begriffe und Kategorien existieren, die erklären sollen, warum Kinder sich auf die Seite eines Elternteils schlagen und den anderen ablehnen. Der Begriff »zu rechtfertigende Entfremdung« (siehe Bala a. Hebert 2016; Whitcombe 2017) wurde geprägt zu dem Zweck, die »verständliche Zurückweisung« eines misshandelnden oder vernachlässigenden Elternteils durch sein Kind zu charakterisieren. Von »hybriden Fällen« wird gesagt, sie würden »Entfremdung« und »zu rechtfertigende Entfremdung« kombinieren, um die Zurückweisung eines Elternteils zu legitimieren (Friedlander a. Walters 2010). Andere Begriffe und Konzepte wie »Ausgrenzung von Familienmitgliedern« (Scharp a. Dorrance 2017) und »kontraproduktives schützendes Elternverhalten« (Drozd a. Williams Olesen 2004) oder unfaire Verunglimpfung eines Elternteils durch den anderen werden ebenfalls zur Beschreibung dessen, was dazu geführt hat, dass ein Kind einen Elternteil nicht sehen will, benutzt. Kelly und Johnston (2001) haben versucht, das »Elternentfremdungssyndrom (PAS)« umzuformulieren und sich auf das »entfremdete Kind« zu konzentrieren, und in diesem Zusammenhang haben sie untersucht, warum und wie die Beziehungen von Kindern zu ihren Eltern nach deren Trennung beeinflusst werden. Das Konzept der »unversöhnlichen Feindseligkeit« (Sturge a. Glaser 2000) ist ein weiterer Versuch, die starke und nicht nachlassende Feindseligkeit zu erfassen, die oft zwischen dem Elternteil, dem das Sorgerecht für das Kind zugestanden worden ist, und dem anderen Elternteil besteht. Das letztgenannte Konzept hat insofern Schwächen, als man denken könnte, es würde implizieren, dass es unmöglich wäre, die Situation zu verbessern – was davon abhalten könnte, veränderungsfördernde Interventionen auch nur auszuprobieren.
Es wurde und wird weiterhin viel darüber diskutiert, ob Elternentfremdung tatsächlich ein Syndrom ist (siehe hierzu beispielsweise Andre 2004; Bernet et al. 2010; Rand 2011; Gottlieb 2012; Baker et al. 2016; Cantwell 2018). Nach unserer Auffassung hat das Konzept der Entfremdung zwar einige Vorzüge, aber andererseits auch Grenzen, da es einen in eine Richtung verlaufenden linearen und kausalen Prozess postuliert, der bewirken soll, dass sich Kinder in die verbitterte Beziehung ihrer Eltern hineingezogen fühlen und aufgrund dessen einem Elternteil gegenüber eine Abneigung entwickeln. Zwar erkennen wir an, dass in sehr extremen Fällen ein Elternteil bei der Unterminierung der Beziehung eines Kindes zum anderen Elternteil die treibende Kraft ist, doch sind in den meisten Fällen umfassendere und komplexere Dynamiken – wie »Triangulierungsprozesse« und Loyalitätskonflikte – im Spiel, die ein differenzierteres Verständnis und entsprechende Formulierungen erfordern.
Fidler und Bala (2010) zitieren zahlreiche Studien, die potenziell negative Auswirkungen von Entfremdungsprozessen auf die betroffenen Kinder thematisieren. Dabei kann es um folgende Aspekte gehen:
•Mängel der Realitätsprüfung
•unlogische kognitive Operationen
•übermäßig vereinfachende und starre Informationsverarbeitung
•unzutreffende oder verzerrte interpersonale Wahrnehmungen
•gestörte und beeinträchtigte interpersonale Funktionsfähigkeit
•Selbsthass
•schwaches oder übertrieben starkes Selbstwertgefühl oder sogar Allmachtsgefühle
•Pseudoreife
•Probleme hinsichtlich der Geschlechtsidentität
•Schwierigkeiten mit Grenzziehungen, wie z. B. »Verstrickung«
•Aggression und Störungen des Sozialverhaltens
•Ablehnung von sozialen Normen und Autoritäten
•mangelnde Impulskontrolle
•emotionale Einengung, Passivität oder Abhängigkeit
•Mangel an Reue oder Schuldgefühlen.
Retrospektive qualitative Untersuchungen an Erwachsenen, die in ihrer Kindheit Entfremdungsprozessen ausgesetzt waren, stehen mit den beschriebenen Erkenntnissen in Einklang (Baker 2007; Verrocchio et al. 2018). Die meisten Betroffenen berichten, sie könnten sich zwar deutlich daran erinnern, in ihrer Kindheit erklärt zu haben, sie hassten oder fürchteten den zurückgewiesenen Elternteil und hätten oft negative Gefühlen ihm gegenüber gehabt, hätten sich aber nicht gewünscht, dass er sich seinerseits von ihnen distanziert hätte, und hätten sogar insgeheim gehofft, irgendwann wäre jemandem klar geworden, dass sie das tatsächlich Gesagte nicht so gemeint hätten. Diese Erkenntnisse sind keineswegs neu, denn schon vor fast drei Jahrzehnten berichteten Clawar und Rivlin (1991), 80 % der Kinder ihrer Stichprobe hätten erklärt, sie wünschten sich, der Entfremdungsprozess werde entdeckt und gestoppt.