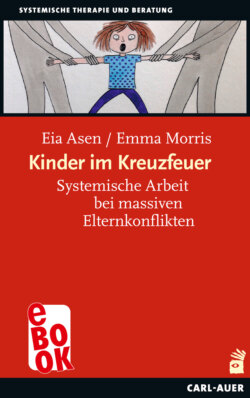Читать книгу Kinder im Kreuzfeuer - Eia Asen - Страница 12
1.4Familienbindungen und Triangulierungsprozesse
ОглавлениеDem Family-Ties-Modell gemäß ist der Prozess des Hineingezogenwerdens der Kinder in anhaltende elterliche Konflikte – die »Triangulierung« – der Grund für die spezielle Art von Beziehungen, die man in Familien vorfindet, in denen nach der Trennung der Eltern starke Konflikte bestehen bleiben. Im Gegensatz zum psychoanalytischen Konzept der »frühen Triangulierung« (Abelin 1975) handelt es sich bei systemisch begründeten Triangulierungsprozessen darum, dass Kinder in die Streitigkeiten von Erwachsenen hineingezogen werden und aufgrund dessen zusammen mit einem Elternteil eine problematische Allianz gegen den anderen Elternteil entwickeln. Das ist keineswegs ein neues Konzept, denn schon Bowen (1966) beispielsweise spricht von der »pathologischen Triangulierung«: einer generationenübergreifenden Koalition, in der ein Elternteil das Kind als Vertrauensperson benutzt und den anderen Elternteil ausschließt und herabwürdigt. Das »perverse Dreieck« (Haley 1985) ist eine weitere Beschreibung des Prozesses, wie ein Elternteil sein Kind für ein verdecktes Bündnis vereinnahmt, um den anderen Elternteil zu isolieren; dadurch gerät das Kind in eine »No-win«-Situation, in der die Einwilligung in die Wünsche des einen Elternteils den Verlust der Liebe des anderen nach sich zieht. Selvini Palazzoli et al. (1992) beschreiben spezielle »Familienspiele«, denen Kinder und Jugendliche zum Opfer fallen und die schwerwiegende psychische Störungen verursachen können. Boszormenyi-Nagy und Spark (1973) verweisen auf die »unsichtbaren Loyalitäten« und die »Rollenkorruption«, die Kinder in Szenarien dieser Art erleiden und welche oft zu den von Minuchin (1977) so genannten »dysfunktionalen Machthierarchien« und »verstrickten« Eltern-Kind-Beziehungen führt. In Szenarien dieser Art befinden sich Kinder verstärkt in Gefahr, »adultifiziert«, »parentifiziert« oder »infantilisiert« zu werden (Garber 2011).
Abb. 1.1: Triangulierungsprozesse
Triangulierung beinhaltet drei unterschiedliche und einander überschneidende Distanzierungs- und Entfremdungsprozesse, die man zum Verständnis grafisch repräsentieren (siehe Abbildung 1.1) und auch therapeutisch nutzen kann, um die verschiedenen eigenen Sichtweisen jedes Elternteils und des Kindes darzustellen. Die Distanzierung eines Elternteils vom Kind ist der erste dieser Prozesse, den man mit dem Ausmaß in Verbindung bringen kann, in dem der eine Elternteil die laufende Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil unterstützt. Eltern, die trotz ihrer Wut oder Aufgebrachtheit dem früheren Partner gegenüber die Beziehung ihres Kindes zum anderen Elternteil bedingungslos unterstützen, sind am einen Ende eines Spektrums zu positionieren, auf dem sich auch die indirekte und unbeabsichtigte Unterminierung dieser Beziehung verorten lässt und an dessen entgegengesetztem Ende die absichtliche, permanente und konsistente Unterminierung der Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil und dessen Herabwürdigung zu lokalisieren ist. Ein zweiter Faktor, der zur Triangulierung beiträgt, ist das Ausmaß, in dem das Kind dem elterlichen Konflikt ausgesetzt ist und in ihn einbezogen wird. Am einen Ende des Spektrums kann das Kind völlig von den Konflikten seiner Eltern abgeschirmt sein, während es am anderen Ende des Spektrums permanent den feindseligsten Interaktionen seiner Eltern ausgesetzt ist und oft direkt in ihre Dispute verwickelt wird.
Ein dritter Triangulierungsfaktor, der zu Distanzierungs- und Entfremdungsprozessen beiträgt, betrifft die tatsächliche physische und emotionale Nähe zwischen Kind und Eltern. Am einen Ende des Spektrums liegt eine sehr nahe und abhängige Beziehung zwischen Kind und Eltern, am anderen Ende befindet sich die völlige Unabhängigkeit des Kindes von den Eltern. Welche Position in diesem Spektrum für die Beziehung eines Kindes zu einem Elternteil optimal ist, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise vom realen Alter, vom Entwicklungsstadium, von den geltenden gesellschaftlichen Normen sowie von den situativen, sozialen und kulturellen Umständen, unter denen die Familie lebt. Wird ein Kind von seinen Eltern in eine Triangulierung hineingezogen, ist seine Nähe zu dem Elternteil, bei dem es lebt, oft größer und die zum anderen Elternteil geringer, als es für eine gesunde psychosoziale Entwicklung optimal wäre.
Ist ein Kind tatsächlich von einem Elternteil erheblich misshandelt oder vernachlässigt worden, macht das eine gewisse physische oder emotionale Distanzierung von diesem Elternteil nicht nur verständlich, sondern liegt gewöhnlich auch im wohlverstandenen Interesse des Kindes – insbesondere wenn weiterhin die reale Gefahr der erneuten emotionalen oder physischen Schädigung des Kindes besteht. Diese Dynamik unterscheidet sich von der als »Triangulierung« bezeichneten Verstrickung in die elterlichen Konflikte, weil wir von »Triangulierungsprozessen« nur sprechen, wenn sich ein Kind von einem Elternteil emotional und/oder physisch distanziert, da die Beziehung durch den anderen Elternteil unterminiert wird und/oder da das Kind dem Konflikt zwischen den Eltern ausgesetzt ist – es also nicht um einen Schaden geht, den das Kind in der Obhut des distanzierteren Elternteils erlebt hat.
Die entstehenden Dynamiken und Prozesse lassen sich vielleicht am besten erörtern und entflechten, wenn man die Sichtweisen und Haltungen aller an dem Dreieck Beteiligten zu verstehen versucht: die des Elternteils, mit dem das Kind die meiste Zeit verbringt (den wir von nun an den »näheren Elternteil« nennen werden); die des Elternteils, bei dem das Kind weniger oder keine Zeit verbringt (den wir von nun an als den »distanzierteren Elternteil« bezeichnen werden); und die des betroffenen Kindes.