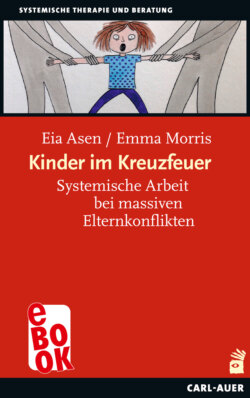Читать книгу Kinder im Kreuzfeuer - Eia Asen - Страница 5
Inhalt
Оглавление1 Chronische Elternkonflikte: Der familiäre Kontext
1.1 Hochstrittige Eltern und resultierende Familiendynamiken
1.2 Elterliche Trennung und ihre Auswirkungen auf Kinder
1.3 Die Debatte über Eltern-Kind-Entfremdung
1.4 Familienbindungen und Triangulierungsprozesse
1.5 Die Konzepte des näheren und distanzierteren Elternteils
2 Konzeptueller Rahmen und Forschungsstand
2.4 Elterliche Verbitterung und die Veränderung von Bindungsrepräsentationen
2.5 Widerstreitende Narrative und Bindungsverhalten
2.6 Mentalisierungsbasierte Konzepte
2.7 Kognitive, behaviorale und psychoedukative Rahmen
2.8 Zentrale Annahmen des Family-Ties-Ansatzes
2.10 Evaluierung von positiven Veränderungen
3 Gesetzlicher Rahmen und Planung der Arbeit
3.1 Chronische Streitigkeiten
3.2.1 Anschuldigungen und Anhörungen zur Tatsachenuntersuchung
3.7 Vorgehensweise und Arbeitsplanung
4 Untersuchung der Eltern und ihrer Elternkompetenzen
4.1 Anhören der elterlichen Narrative
4.2 Die Eltern der Eltern – gelernte oder nicht gelernte »Lektionen«?
4.3 Das elterliche Vermögen, die eigenen Kinder zu mentalisieren
4.4 Die Fähigkeit zur Selbstreflexion
4.4.1 Beurteilung der Kompetenz bei der Erfüllung elterlicher Aufgaben
4.5 Emotionale und behaviorale Selbstregulation
4.5.1 Die Beurteilung der Existenz von Triangulierungsprozessen
4.6 Die Darstellung des anderen Elternteils
4.7 Beurteilung der psychischen Gesundheit der Eltern
4.8 Persönlichkeitsstörungen und spezifische Persönlichkeitsmerkmale
4.9 Narzisstische Persönlichkeitsstörung und narzisstische Persönlichkeitszüge
4.10 Borderline-Züge und die Borderline-Persönlichkeitsstörung
4.11 Fingierte oder induzierte Krankheiten (Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom)
4.12 Angst, Depression und Reaktionen auf erlebte Traumata
5 Untersuchung und Beurteilung von Kindern
5.2 Erstgespräche und weitere Treffen
5.3 Die feststellbaren Wünsche und Gefühle des Kindes
5.5 Der Strange-Situation-Test
5.6 Erzählungsstämme (Story Stems)
5.7 Das Child-Attachment-Interview
5.9 Beurteilung von Misshandlungsvorwürfen und anderen Beschuldigungen
5.10 Beurteilung des Kindeswillens und Mitspracherechts
5.11 Sammeln zusätzlicher Informationen über das Kind
5.12 Missbrauch von Diagnosen durch Eltern
6 Therapeutische Untersuchung von Familienbeziehungen und Interventionsplanung
6.1 Therapeutische Begutachtung
6.2 Vorbereitung der Eltern auf eine Begegnung mit dem Expartner
6.3 Das »Muster als Übeltäter«
6.4 Umgang mit affektiver Erregung und Eskalationsdynamiken
6.5 Vorbereitung der Eltern auf die Wiederherstellung des Kontakts zu ihrem Kind
6.7 Exploration der elterlichen Paarbeziehung
6.8 Beobachtung und Bewertung von Kind-Eltern-Interaktionen
6.9 Das umfassendere System: Erweiterte Familie und Kultur
6.10 Integration der Befunde und Interventionsplanung
6.10.1 Verstrickung des Kindes in Triangulierungsprozesse
6.10.2 Die elterliche Fähigkeit, die primären Bedürfnisse Kindes zu erfüllen
7 Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Kontakts
7.1 Desensibilisierung und abgestufte Exposition
7.2 Indirekte abgestufte Exposition
7.3 Abgestufte direkte Exposition
7.4 Umgang mit spezifischen Ängsten und Vorbehalten
7.5 Hinterfragen verzerrter Repräsentationen
7.7 Komponenten kohärenter Narrative
7.9 Weitere Arbeit mit dem Elternpaar und dem umfassenderen familiären und professionellen Netzwerk
7.10 Rückfallprävention und frühes Erkennen problematischer Interaktionsmuster
8.1 Das Management von Risiken
8.2 Einverständnis mit der Zielsetzung und Umgang mit »Doppelbotschaften«
8.5 Co-Working und andere Formen der Zusammenarbeit
9 Frühe Interventionen zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
9.1 Letzter Versuch oder Trennung?
9.2 Entwickeln eines gemeinsamen »Mantras« zum Schutz der Beziehung der Kinder zu beiden Eltern
9.3 Aufrechterhaltung des gemeinsamen Mantras
9.4 Proaktive Unterstützung von Kontakt
9.6 Einbeziehung des umfassenderen familiären Netzwerks
9.7 Stärkung und Koordinierung spezifischer Elternkompetenzen
9.8 Frühes Erkennen und Ansprechen problematischer Co-Parenting-Muster