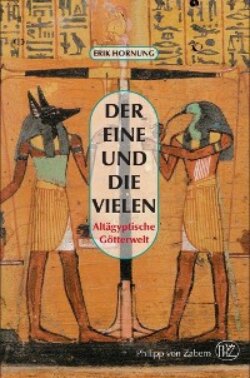Читать книгу Der Eine und die Vielen - Erik Hornung - Страница 6
ERSTES KAPITEL
Einführung:
Der Streit um den Einen und die Vielen
ОглавлениеFrüh, schon in der Antike, regten sich Befremdung, Abneigung und spöttische Ablehnung angesichts der scheinbar so abstrusen Göttergestalten Ägyptens. Die verwirrende Fülle seltsamer Gestalten, die ungewohnten Mischwesen aus Menschenleib und Tierkopf waren für die einen symbolische Einkleidung bedeutungsvoller Mysterien, für die anderen ein ärgerlicher Widerspruch zu ihrer vermeintlich „erhabenen“ Vorstellung von einer Gottheit. Beide Haltungen stellt Lukian im 2. Jahrhundert n. Chr. einander im Dialog gegenüber; dabei macht sich Momos, „der Tadel“, zum Sprecher der Ablehnung:
MOMOS: Du aber, hundsgesichtiger und in Leinen gekleideter Ägypter, wer bist du eigentlich, mein Bester? Wie kommst du Wauwau dazu, ein Gott sein zu wollen? Und was denkt sich erst dieser gescheckte Stier aus Memphis, der sich göttlich verehren läßt, Orakel erteilt und Propheten hat? Ich schäme mich ja, von Ibissen, Affen, Ziegenböcken und anderem noch viel Lächerlicheren zu sprechen, das – ich weiß nicht wie – aus Ägypten in den Himmel hineingeschleust wurde. Wie könnt ihr Götter es geduldig mit ansehen, daß diese in gleichem Maß oder gar noch höher als ihr verehrt werden? Oder du, Zeus, wie erträgst du es, wenn sie dir Widderhörner wachsen lassen?
ZEUS: Fürwahr, was du da über die Ägypter bemerkst, klingt häßlich; aber dennoch, Momos, enthält das meiste davon eine geheimnisvolle Symbolik, und ein Uneingeweihter sollte sich keinesfalls darüber lustig machen.
MOMOS: Wir brauchen wahrhaftig Mysterien, um Götter als Götter und Hundsköpfe als Hundsköpfe zu erkennen!1
Seinen Spott schüttet auch Iuvenal in der 15. seiner Satiren über „die Fratzen, die das tolle Ägypten verehrt“ aus – „Wer weiß nicht, welche Ungeheuer Ägypten in seinem Wahn verehrt? ... Ein Flußfisch oder ein Hund gilt dort als Gott“, und Properz sieht den „kläffenden Anubis“ (latrator Anubis) als negatives Gegenbild zum erhabenen Jupiter; ähnlich spricht Vergil in seiner Aeneis (8, 698) vom „greulich Göttergemeng zusamt dem Kläffer Anubis“. Über die Kirchenväter2 und die mittelalterlichen Reisenden hat sich diese Abneigung bis in die Neuzeit gehalten, doch immer wieder ergänzt und ausgeglichen von dem Glauben an geheimnisvolle Mysterien im Hintergrund der ägyptischen Religion. Osiris und Isis sind selbst für das Mittelalter respektable Figuren, und der Apis-Stier kommt in der Renaissance als Wappentier der Borgia zu neuen Ehren. Für John Milton (Paradise Lost I 477ff.) in der Mitte des 17. Jahrhunderts sind Osiris, Isis und Horus „names of old renown“, aber ihr Gefolge, wobei er sicher auch an Anubis denkt, zeigt „monströse Gestalten“ und „viehische Formen“ (brutish forms), so wie eine Inschrift aus dem Jahre 1651 an der Basis des römischen Obelisken auf der Piazza Navona von den „schuldbeflekkten Götzen der Ägypter“ spricht (noxia Aegyptiorum monstra).3
Damit blieb die ägyptische Gottheit in ihrer Erscheinung ein verwirrendes „Stückwerk aus Tierköpfen und Menschen-Torsos“ (Jean Paul4), und Goethe verlieh seiner Abneigung heftigen Ausdruck:
Nun soll am Nil ich mir gefallen,
Hundsköpfige Götter heißen groß:
O wär ich doch aus meinen Hallen
Auch Isis und Osiris los!
Wir wissen zwar, daß sich dieses Zahme Xenion von 1820 nicht geradezu gegen die ägyptischen Götter, sondern gegen eine zeitgenössische Zeitschrift namens „Isis“ gerichtet hat,5 daß es mithin der modernen Ägyptomanie und ihren Auswüchsen gilt, die unter den Gestalten ägyptischer Götter ihre eigenen, oft allzu ungereimten Ideen verbirgt. Aber die Verse über die „hundsköpfigen Götter“ und vorher über den indischen „Affen Hanuman“ lassen doch, über den äußeren Anlaß hinaus, eine tiefere Ablehnung dieser Art von Göttergestaltung erkennen. So haben es Goethes Zeitgenossen auch verstanden, und Schelling hat in seinen Vorlesungen über „Philosophie der Mythologie“ Goethes Urteil über die indischen Götter bereits entgegengehalten: „mit einem bloßen Geschmacksurtheil sind sie nicht hinwegzuschaffen; abscheulich oder nicht, sie sind einmal da, und weil sie da sind, müssen sie erklärt werden“.6
Dieser treffliche Einwand gilt nicht nur am Ganges, sondern auch am Nil, aber das geforderte „Erklären“ wird zusehends schwieriger – je tiefer wir in die Welt dieser Urbilder eindringen, desto unerklärlicher wird uns, was ein Gott ist. Die Gestaltung dieser Urbilder ist auch in Ägypten nicht frei von ästhetischen Kategorien und Maßstäben gewesen, das wird uns Kapitel IV in aller Deutlichkeit lehren. Aber entscheidend ist doch, und das hat Schelling klar erkannt, nicht die wechselnde Gestalt, sondern das Dasein der Götter.
Die Ägyptologie hat mit dem Dasein der ägyptischen Götter, wie es ihr in den Texten und Darstellungen der alten Nilkultur entgegentrat, lange Zeit wenig anzufangen gewußt. Auf weiten Strecken ihrer Geschichte hat sie unter dem Zwiespalt gelitten, der zwischen dem kulturellen wie ethischen Hochstand Altägyptens und den vielfach als „unwürdig“ empfundenen Gottesvorstellungen aufzubrechen scheint. In einer Zeit beginnender innerer Begegnung mit Ägypten und seinen Göttern, wie sie zunächst Rilke und später Thomas Mann verkörpern, in einer Zeit, da der Dichter „das Gewaltige jener von Göttern einst durchwachsenen Länder“ spürt und seiner Zeit warnend zuruft:
Keiner der Götter vergeh. Wir brauchen sie alle und jeden,
jedes gelte uns noch, jedes gestaltete Bild,7
in einer solchen Zeit hat Adolf Erman, nachdem er die Hauptgottheiten der Ägypter aufgezählt hat, in seinem Standardwerk Die ägyptische Religion keinen anderen Kommentar für seine Leser bereit, als beschämt einzugestehen:
An den angeführten Göttern mag mancher Leser reichlich genug haben und doch bilden sie erst einen kleinen Teil von allen denen, die man in Ägypten verehrte.8
Wir dürfen sicher sein, daß Erman mit dieser Meinung nicht allein stand und daß er mit solchen Formulierungen den Beifall der meisten Leser gefunden hat. Seine Haltung ist bereits das Ergebnis einer längeren Entwicklung und Auseinandersetzung innerhalb der Wissenschaft, ist Antwort auf erste Versuche, die verwirrende Vielzahl der Gottheiten als „vordergründig“ und unwesentlich gegenüber dem „monotheistischen“ Kern der ägyptischen Religion zu erweisen.
Damit sind wir dem zeitlichen Ablauf in der Geschichte unseres Problems vorausgeeilt und müssen zunächst die Bemühungen des 18. und 19. Jahrhunderts betrachten, die alten Ägypter vom Vorwurf eines primitiven Götzendienstes reinzuwaschen und sie als Träger einer frühen Stufe der Hochreligionen, ja sogar eines monotheistischen Glaubens zu erweisen.
Frühe Ansätze dazu finden sich in dem Einweihungsroman Séthos des Abbé Jean Terrasson von 1731, der auf das Freimaurertum und andere geistige Strömungen des 18. Jahrhunderts großen Einfluß ausübte. Dort heißt es: „Alle Völker der Welt stimmen überein in der allgemeinen Idee eines Ersten Wesens, Schöpfer und Erhalter der Natur“.9 Ähnlichen Vorstellungen neigte Voltaire zu, und die Idee eines „reinen Monotheismus, der sich äußerlich durch einen symbolischen Polytheismus ausdrückt“, stand bereits an der Wiege der Ägyptologie, bei Champollions Bruder artikuliert.10 Dabei hatte sich schon 1775 Christoph Meiners gegen die im 18. Jahrhundert sonst allgemein vorherrschende Idee eines Urmonotheismus gewandt – er läßt ihn höchstens bis zu Noah gelten. Weit verbreitet war daneben die Meinung, die auch Schiller teilte, wonach das einfache Volk zwar die Vielzahl lokaler Gottheiten verehrt, die Weisen sich aber stets an den einen Gott gehalten hätten.
Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts vertrat der damals führende französische Fachgelehrte Emmanuel de Rougé sehr entschieden die Überzeugung, daß die ägyptische Religion ursprünglich und im Kern eine monotheistische sei. Für ihn ist „le fond sublime et persistant“ dieser Religion die Einheit eines Höchsten Wesens, seine Ewigkeit und Allmacht,11 die niemals durch den Polytheismus „erstickt“ worden seien.12 In einem Vortrag erklärte de Rougé 1869:
Ich sage „Gott“, nicht „die Götter“, denn der Haupt- und Grundzug der ägyptischen Religion ist die Einheit Gottes, welche in höchst entschiedener Weise also ausgesprochen wird: „Gott der Eine, der Einzige, der Alleinige, der keine andern neben sich hat. – Er hat alles erschaffen und ist der einzig Unerschaffene ...“. Eine Idee beherrscht die ganze Religion: Es gibt einen einzigen uranfänglichen Gott. Immer und überall ist er der Eine, der durch sich selbst besteht und ein unnahbarer Gott ist.13
De Rougé stützt sich hier auf wörtliche Formulierungen ägyptischer Texte, die unleugbar „monotheistisch“ klingen und die Lehren späterer Religionsstifter vorwegzunehmen scheinen. Seine Argumente und die Autorität seiner Meinung bestätigten die unter den Gebildeten des 19. Jahrhunderts weitverbreitete Meinung, wonach der Monotheismus dem Polytheismus vorausgehe – sofern eine solche Meinung, für Schelling „im ungestörten Besitz einer vollkommenen und allgemeinen Zustimmung“,14 weiterer Bestätigung bedurfte. Die Ägyptologie erweist sich hier, wie so oft, abhängig von den Fragen und Antworten ihrer Zeit, ihre Geschichte spiegelt die allgemeine Geistesgeschichte des Abendlandes.
Zu dieser gehört neben der wissenschaftlichen auch die literarische Begegnung mit dem alten Ägypten. Edgar Allan Poe gibt die These vom Urmonotheismus in seiner Erzählung Some Words with a Mummy (1845) eher ironisch wieder, aber der Held Pentaur in Georg Ebers’ Roman Uarda (1877) glaubt fest an den Einen, „der ein Gott ist, zu dem die erhabene Neunzahl der großen Götter wie elende Bettler hilfebedürftig betet“. Monotheistisch ist Ägypten auch in Th. Gautiers Roman de la momie von 1857.
Der englische Ägyptologe und Religionshistoriker Sir Peter Le Page Renouf hat in seinen „Vorlesungen über Ursprung und Entwickelung der Religion der alten Aegypter“15 die Auffassung von de Rougé mit wenigen Einschränkungen übernommen. Nach seiner Meinung könnten einige der von de Rougé angeführten Textstellen zwar anders gedeutet werden, „aber die Thatsachen, auf die er (de R.) seine Ansicht stützt, sind unwiderlegbar ... Es ist im Gegentheil erwiesen, dass die edlern und erhabeneren Theile der ägyptischen Religion die ältesten sind.“ (S. 85f.)
Mit den Prädikaten „edel“ und „erhaben“ meint Sir Peter den Monotheismus, der für ihn ganz selbstverständlich die höchste Form der Religion darstellt. Hinter der erhabenen, uranfänglichen Größe dieses Glaubens an den Einen und Einzigen treten für ihn die nach ihren Eigenschaften wie nach ihren Gestalten „unwürdigen“ Götter des ägyptischen Polytheismus – eben die „Hundsköpfe“ Lukians – als spätere Entartung zurück. Es geht also primär nicht darum, die ägyptischen Texte auf ihre Aussagen über Gott und Götter hin zu befragen, sondern um eine Wertung des ägyptischen Gottesglaubens, um eine Apologie gegenüber der frühen Abwertung dieses Glaubens; bei dieser Wertung erhalten alle monotheistischen Züge und Tendenzen ein positives, alle polytheistischen ein negatives Vorzeichen, und der Wertende geht von vorgefaßten, sehr konkreten Vorstellungen darüber aus, wie ein Gott eigentlich zu sein habe.
Le Page Renouf hat die Deutung der ägyptischen Religion als eines primären Monotheismus mit eindrücklicher Klarheit und methodischer Überlegung artikuliert. Darin war er der bedeutendste, aber bei weitem nicht der einzige Fortsetzer de Rougés. In den 70er Jahren vertrat die gesamte französische Ägyptologie, mit geringfügigen Variationen des Themas, einhellig die „monotheistische“ Deutung der ägyptischen Religion. Eugène Grébaut schreibt 1870, daß dieser Monotheismus „incontestable“ sei;16 etwas vorsichtiger erwägt Edouard Naville in seiner Erstausgabe der Sonnenlitanei (1875), ob die alten Ägypter unter dem Schleier eines „groben und bizarren Polytheismus“ doch die Idee eines „einzigen und persönlichen Gottes“ bewahrt hätten.17
Paul Pierret überschreibt 1879 das erste Kapitel seines „Essai sur la mythologie égyptienne“ mit dem Titel „Le monothéisme égyptien“. Polytheistisch in ihrer Erscheinung, ist die ägyptische Religion für ihn „wesensmäßig“ monotheistisch, und es darf nicht anders sein, denn „Gott ist Einer, oder es gibt ihn nicht“ (Dieu est un ou il n’est pas: S. 6) – der Polytheismus wäre daher eine Verneinung Gottes, wenn man ihn nicht als rein symbolisch und die Götter als verschiedene Rollen oder Funktionen des höchsten, einzigen und verborgenen Gottes sieht (S. 7), für den die religiösen Texte Ägyptens ja eine Fülle von scheinbar „monotheistischen“ Prädikationen bieten. Auch für François Joseph Chabas sind die vielen Götter nur Aspekte des Einen,18 während Auguste Mariette an der Spitze des ägyptischen Pantheons einen einzigen, unsterblichen, ungeschaffenen, unsichtbaren und verborgenen Gott „für die Eingeweihten“ annimmt.19
Die großen Gelehrten der nächsten auf de Rougé, Pierret und Mariette folgenden Generation stehen in ihren ersten Arbeiten noch ganz unter dem Eindruck dieser Auffassung, die ihren Lehrern selbstverständlich war. So spricht Gaston Maspero, Mariettes Nachfolger als Direktor der ägyptischen Altertümerverwaltung, in einer frühen Vorlesung über die religiöse Literatur der alten Ägypter von einem „Dieu immatériel“, der erst sekundär in den vielerlei Gottheiten „Fleisch wird“;20 Eugène Lefébure hat noch lange an einem ägyptischen Monotheismus festgehalten, ihm allerdings eine mehr pantheistische Färbung gegeben.21
Wie verbreitet diese Schau der ägyptischen Götterwelt um 1880 gewesen ist, zeigt eine Stelle in Le Page Renoufs Vorlesungen (S. 83):
Viele der ausgezeichnetsten Gelehrten behaupten, obwohl ihnen alles, was für die entgegengesetzte Meinung gesagt werden kann, bekannt ist, die Religion Aegyptens sei wesentlich monotheistisch, und nach ihnen soll die Vielheit der Götter nur aus der Personification der Eigenschaften, Eigenthümlichkeiten und Kräfte des Wesens des einen höchsten Gottes ihren Ursprung ableiten.
Zu diesen „ausgezeichnetsten Gelehrten“ gehörte Heinrich Brugsch, damals neben Lepsius der führende deutsche Ägyptologe. 1885 erschien der erste Band seines Standardwerkes Religion und Mythologie der alten Aegypter, in welchem er sich (S. 90) zu der Überzeugung bekennt, daß die Ägypter „bereits zu den frühsten Zeiten den einen, namenlosen, unerfaßlichen, ewigen Gott in seiner höchsten Reinheit“ verehrt hätten. In der Nachfolge Schellingscher Ideen über die Abfolge der Götter spricht Victor von Strauß und Torney noch 1889 (in „Der altägyptische Götterglaube“, Bd. I) von einem „mythologischen Monotheismus“ mit dem Gott Nun am Beginn der ägyptischen Religionsgeschichte.
In dieser Übersteigerung ließ sich die Behauptung eines anfänglichen reinen Monotheismus bei den Ägyptern aber nicht lange halten. Schon kurz vor dem Erscheinen von Brugschs großem Werk, das weithin maßgebend für die Darstellung der ägyptischen Religion blieb, hatte J. Lieblein (Egyptian Religion, 1884) erste Kritik an der verbreiteten Lehrmeinung geübt. Maspero hat sich bereits 1880 sehr kritisch zu Pierret und dessen monotheistischem „Vorurteil“ geäußert; der Monotheismus wird dort zu einer sekundären Erscheinung, als „résultante d’un polythéisme antérieur“. Seit 1888 gibt Maspero zu, daß ihn das selbständige Studium der ägyptischen religiösen Texte zur Aufgabe seiner früheren Meinung über den ägyptischen Monotheismus – wie sie Brugsch immer noch festhält – geführt habe. In den ausführlichen Besprechungen, die er dem Werk seines deutschen Kollegen gewidmet hat, lehnt er die bisherige Auffassung in aller Deutlichkeit ab, und wir wollen ihn im originalen Wortlaut zitieren:
Je crois, contrairement à ce qu’il dit, que les Égyptiens ont été polythéistes avant tout, et que s’ils sont arrivés à la conception d’un dieu un, ce n’était pas un dieu exclusif et jaloux ... (La religion égyptienne ...) je la prends pour ce qu’elle se donne, un polythéisme avec ses contradictions, avec ses redites, avec ses dogmes parfois indécents, parfois cruels, parfois ridicules pour un moderne ...
In Deutschland schreibt Alfred Wiedemann 1890 (Die Religion der alten Ägypter, S. 62f.):
Man hat ... aus Stellen, in denen es heißt, Gott bzw. ein Gott ... wird gelobt, Gott kennt den Bösen, Gott giebt ein Feld, Gott liebt den Gehorsamen u. s. f. oft geschlossen, es sei darunter der wahre, ewige Gott zu verstehen. Dies ist jedoch nicht ohne weiteres möglich; dieselben Texte, die diese Angaben machen, sprechen daneben von einzelnen Gottheiten und zeigen, daß der Schreiber bei dem Worte Gott nur an seinen eigensten Gott dachte, an den Gott seines Nomos, ... der für ihn eine alles umfassende Macht war, die aber darum das Bestehen anderer, für andere Menschen wichtiger höherer Mächte nicht ausschloß ... Wenn aber derartige Ausdrücke an und für sich keinen Beweis darbieten können für eine ursprüngliche und von Zeit zu Zeit dem ägyptischen Volke wieder zum Bewußtsein kommende reine, monotheistische Gotteserkenntnis, so kann man ebenso wenig aus den Inschriften den Beweis erbringen, daß eine solche nicht vorhanden gewesen ist.
Wiedemann erläutert diese besonnene Zurückhaltung mit dem Hinweis, „daß erst ein kleiner Teil des aus dem alten Ägypten erhaltenen Materiales vorliegt“. Er hütet sich also, das Kind mit dem Bade auszuschütten; es genügt ihm, die Problematik der seit de Rougé zum Erweis eines ägyptischen Monotheismus herangezogenen Quellen aufzuzeigen. Seine klare Argumentation hätte noch manchen modernen Verfechter eines ägyptischen Monotheismus vor haltlosen Schlüssen bewahren können, aber Wiedemanns Stimme wurde in den Auseinandersetzungen kaum gehört.
Das folgende Jahrzehnt brachte, vor allem durch die Grabungen von Amélineau und Petrie in Abydos, die Entdeckung der ägyptischen Frühzeit. Seit 1893 lag auch die erste, von Gaston Maspero besorgte Herausgabe der Pyramidentexte aus der 5. und 6. Dynastie abgeschlossen vor. Weder in dieser ältesten, seit 2350 v. Chr. aufgezeichneten großen Spruchsammlung, noch in den Inschriften und Darstellungen der Vor- und Frühgeschichte ließ sich der a priori angenommene, ursprüngliche und „reine“ Glaube eines ägyptischen Monotheismus greifen, vielmehr steht gerade in diesen frühen Quellen die Göttervielfalt eindrucksvoll im Vordergrund. Zusammen mit der vorangegangenen Kritik an der Methode bewirkte diese entscheidende Vermehrung unserer Quellen, daß die so lange selbstverständliche Lehrmeinung über einen primären Monotheismus der Ägypter stillschweigend fallengelassen wurde; sie ist auch durch den Babel-Bibel-Streit von 1902 nicht neu belebt worden.
Die ägyptologische Literatur der folgenden Jahrzehnte erweckt den Eindruck, daß mit der alten Lehrmeinung auch das Interesse an einer Bestimmung der ägyptischen Gottesvorstellung dahinfiel. Der positivistische Blick auf das „Tatsächliche“, auf die im Vordergrund stehenden Fakten des ägyptischen Götterglaubens, ließ sich von Streitfragen um Monotheismus/Pantheismus/Polytheismus nicht mehr ablenken. Adolf Erman setzte mit seiner Darstellung der ägyptischen Religion, deren erste Auflage 1905 erschien, ein neues Vorbild, das zur Richtschnur für die folgende Generation wurde. Der Götterglaube im alten Ägypten von Hermann Kees, 1941 als Krönung einer langen Forschungstätigkeit veröffentlicht, ist für die äußeren Formen und Tatsachen dieses Glaubens die immer noch maßgebende Darstellung, ohne die Frage nach der Wesensbestimmung des untersuchten Götterglaubens aufzuwerfen; in dieser Tradition steht noch die Ancient Egyptian Religion von Jaroslav Cerny (1952). Die Abstinenz eines halben Jahrhunderts hat unsere Frage jedoch auf ihre Weise gefördert – wir müssen dankbar anerkennen, daß in dieser Zeit die wesentlichen Fakten zusammengetragen und gesichert wurden, auf die sich heute neue Wesensbestimmungen des Götterglaubens stützen können.
Die wenigen, die in diesem Zeitraum die Frage nach der ägyptischen Gottesvorstellung aufgreifen, distanzieren sich in aller Klarheit von der monotheistischen Deutung und neigen eher dazu, in der ägyptischen Religion pantheistische Züge zu sehen, wie etwa Breasted. Daneben taucht nun immer häufiger der Begriff des Henotheismus auf (vgl. Kap. VII). Nur E. A. Wallis Budge hält an der Meinung fest, „foolish priests“ hätten den „reinen“ monotheistischen Glauben verdunkelt, der in Ägypten seit frühester Zeit bestanden hat und den er vor allem in den Weisheitslehren zu finden meint; so nimmt Budge, ähnlich wie Mariette, eine Zweigleisigkeit des ägyptischen Götterglaubens an, die sich bis heute für viele seiner Nachfolger als einfache – allzu einfache! – Lösung des Problems darstellt: der Eine für die Weisen, die Vielen für die Menge. Gegen einen solchen „Monotheismus für Eingeweihte“, wie man ihn nennen könnte, hat sich bald darauf Wiedemann mit guten Gründen gewandt, doch hat das die gleich zu besprechende „neomonotheistische“ Schule nicht daran gehindert, an diese Vorstellung von Budge anzuknüpfen.
Wiedemann zeichnet für den Artikel „God“ (Egyptian) im 6. Band von Hastings Encyclopaedia of Religion and Ethics (1913) verantwortlich – eine glückliche Wahl der Herausgeber, denn Wiedemann gibt hier auf wenigen Seiten einen gut durchdachten, ausgewogenen Überblick über die wesentlichen Fragen der ägyptischen Gottesvorstellung. Einen eigenen Abschnitt (S. 275–277) widmet er unter der Überschrift „Monotheism or henotheism?“ der bisherigen Hauptfrage und wendet sich hier entschieden gegen die Annahme eines ursprünglichen Monotheismus wie gegen die Behauptung eines monotheistischen Gottes für „Eingeweihte“ in den Weisheitslehren. Die Formulierungen ägyptischer Quellen, auf die sich de Rougé und seine Zeitgenossen gestützt hatten, bedürfen einer anderen Erklärung: „The apparently monotheistic expressions on Egyptian monuments rest in reality upon henotheistic modes of thought“ (S. 276). Ähnlich, wenn auch in anderen Formulierungen, betrachtet G. Roeder in einem nahezu gleichzeitig erschienenen Aufsatz über „Das ägyptische Pantheon“ unsere Frage: Er lehnt die Theorie eines ursprünglichen Monotheismus ebenso entschieden ab wie Wiedemann und rechnet damit, daß in der Mannigfaltigkeit der ursprünglichen Gottheiten eine „Auslese“ stattfindet, die er mit dem damals populären „Kampf um das Dasein“ bei den Lebewesen vergleicht.
Die großen Gottheiten werden vielseitig, erhalten zahlreiche Namen und Eigenschaften, und ihre Verehrer können zu der Meinung gelangen, als sei ihr Gott der einzige und ein allmächtiger. So kommt erst durch die sekundären Identifikationen ein monotheistischer Zug in die ägyptische Theologie, der aber nirgends das polytheistische Gebäude umgeworfen hat.22
Dieses neue Stichwort vom „monotheistischen Zug“ sollte sich noch als verhängnisvoll erweisen, da es vielfach zur Verschwommenheit der Begriffe und damit des ganzen Problems beitrug. Zunächst aber schien die Frage nach der ägyptischen Gottesvorstellung keiner weiteren Diskussion mehr zu bedürfen, wenn wir von der Dissertation Gerardus van der Leeuws (1916) absehen, die sich speziell mit den Gottesvorstellungen in den Pyramidentexten beschäftigt, also gerade mit der ältesten damals greifbaren Quellengruppe. Die Untersuchung des großen holländischen Religionshistorikers stützt und ergänzt die neue polytheistisch/henotheistische Interpretation, wie wir sie schon bei Wiedemann und Roeder gefunden haben. In der ältesten greifbaren Gottesvorstellung der Ägypter kann van der Leeuw nirgends monotheistische oder Hochgott-Züge entdecken, sondern vergleicht sie mit dem von Preuss erarbeiteten Gottesbegriff der Cora-Indianer. Auch von einem „transzendenten“ Gott kann im Ägypten der Pyramidenzeit keine Rede sein, eher von einem „pantheistisch gefärbten“ Vertrauen auf den Fortbestand des Seienden. Mit seiner Kennzeichnung einer gewissen „vaagheid“ in der ägyptischen Gottesvorstellung zeigt van der Leeuw einen wichtigen Aspekt auf, der uns noch beschäftigen wird, während die zeitbedingte Frage nach Monismus oder Dualismus, der er breiten Raum widmet, für unser Problem weniger fruchtbar scheint.
Unfruchtbar blieb auch die in der „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft“ 1916–1920 ausgefochtene Polemik zwischen Karl Beth und Hermann Grapow – ein Musterbeispiel dafür, wie der Religionshistoriker und der Philologe aneinander vorbeireden können, ohne von den Methoden und Fragestellungen des Partners eine rechte Vorstellung zu haben. Die Gelegenheit, aus seiner Kenntnis der „tausende von Belegstellen für ntr“ im Berliner Wörterbuch Klärendes und Wesentliches zur Bedeutung von netjer („Gott“) zu sagen, hat Grapow sich in seiner Kritik an Beth entgehen lassen, unwesentliche Details genügten ihm als Zielscheibe. Aber auch Beths Vergleiche von netjer mit el und wakonda bleiben für den Ägyptologen unbefriedigend, mit der Annahme eines besonderen netjer in den Weisheitslehren (S. 180ff.) oder eines „großen All-Neter“ (S. 182) folgt er eingefahrenen Geleisen. Mit dem weiteren Überblick des Religionshistorikers formuliert Beth jedoch eine Einsicht, die den Fachgelehrten verschlossen blieb:
Monotheismus oder Polytheismus – das war die große Streitfrage der Ägyptologie seit Entdeckung der ersten ägyptischen Texte. Der hier gegebene Durchblick zeigt, daß beide Antworten ihr gutes Recht haben, und er zeigt ebenso, daß jede der beiden Antworten diese Begriffe wie Schlagworte verwendet und die wirkliche Eigenart der Religion der alten Ägypter nicht auszudrücken vermag. (S. 183)
Das hat zur gleichen Zeit auch Dimitri Mereschkowskij empfunden, wenn er schreibt:
Sie (die Forscher) streiten noch alle herum, ob in Ägypten der Monotheismus bestand, ob die Ägypter an viele oder an Einen Gott geglaubt haben. Ein seltsamer Streit! Natürlich an viele und natürlich zugleich an Einen ... Destilliertes Wasser gibt es nur in Apotheken und nicht in lebendigen Quellen; ebenso gibt es den vollkommenen Monotheismus nur in der reinen Vernunft, aber nicht in lebenden Herzen.23
Damit war die Diskussion zunächst an einem toten Punkt angelangt, und es mußte sinnlos scheinen, sie ohne die Eröffnung von neuen Zugängen zur „wirklichen Eigenart der Religion“ nochmals aufzugreifen. Neue Impulse für die Beschäftigung mit der ägyptischen Gottesvorstellung gingen erst wieder von Hermann Junker aus, der in der Zeit nach 1930 einem vermeintlichen alten Hochgott, dem „Großen“ (Wer), nachspürte und dabei in die gedankliche Nähe des „Urmonotheismus von Pater Wilhelm Schmidt geriet. Da es sich hier um isolierte Betrachtung eines göttlichen Beinamens handelt, werden wir auf die Gedanken Junkers erst im Abschnitt über die göttliche Eigenschaft der Größe zurückkommen.
Die Neubelebung einer monotheistischen Deutung der ägyptischen Gottesvorstellung ist wiederum von der französischen Ägyptologie ausgegangen; den Anstoß gab der Abbé Etienne Drioton, damals einflußreicher Generaldirektor der ägyptischen Altertümerverwaltung. Während die erste und zweite Auflage (1938 bzw. 1946 erschienen) des Bandes „L’Égypte“, den Drioton und Vandier in der Reihe CLIO als grundlegende Darstellung der politischen wie der Geistesgeschichte Ägyptens herausgegeben haben, über einen ägyptischen Monotheismus kein Wort verlieren, steht er in der dritten Auflage (1952) im Vordergrund des Abschnitts über die Religion Ägyptens.24
Schon 1948 hatte Drioton seine Gedanken in einem Aufsatz „Le monothéisme de l’ancienne Égypte“25 entwickelt und die Behauptung aufgestellt, der Monotheismus sei in Ägypten schon lange vor den Reformen Echnatons dagewesen. Die entscheidende Quelle dafür sind ihm die Weisheitslehren mit ihrem „dieu des sages“, von dem er schon in einem früheren Aufsatz spricht.26 Obgleich sich Drioton auch auf H. Junker beruft, nimmt er einen zwar sehr alten, aber nicht ursprünglichen Monotheismus an; für die neue Lehrmeinung ist der ägyptische Monotheismus sekundär, auf dem Boden des Polytheismus erwachsen. Das vorherrschende Bestehen des Polytheismus zu allen Zeiten der ägyptischen Geschichte kann nicht mehr in Frage gestellt werden, so daß der behauptete Monotheismus notwendig einer für „Eingeweihte“ sein muß, wie schon Mariette und Budge und lange vor ihnen Schiller und die Aufklärung angenommen hatten.
Obgleich es an kritischen Stimmen und methodischer Besinnung nicht gefehlt hat,27 ist die französische Ägyptologie eine Weile der Anziehungskraft von Driotons Formulierungen weitgehend erlegen. Die monotheistische Deutung ägyptischer Gottesvorstellungen fand auch außerhalb Frankreichs erneuten Anklang; in dem von G. Posener herausgegebenen „Lexikon der ägyptischen Kultur“ spricht S. Sauneron ganz unproblematisch von einer „Namenlosen göttlichen Macht hinter den Göttern“,28 und E. Otto nimmt in einem Aufsatz „Zum Gottesbegriff der ägyptischen Spätzeit“ an, daß die Ägypter der Spätzeit „die Vielheit der Gotteserscheinungen als mögliche Vergegenwärtigung eines dahinterstehenden anonymen Göttlichen erlebt“29 haben. Für J. Spiegel ist sogar ein „reiner Monotheismus ... die beherrschende Form aller ägyptischen Religiosität seit dem Beginn der historischen Zeit Ägyptens“.30
Noch entschiedener sah Siegfried Morenz in den ägyptischen Theologen direkte Vorläufer moderner, aus der Offenbarung gespeister Theologie. Auch sie schon hätten „Gottes große und eine Wirklichkeit hinter der Fülle seiner Erscheinungen“ gesucht,31 und damit kann diese Fülle, also die bunte Vielfalt des Polytheismus, als vordergründig beiseite geschoben werden. Alle Fluchtlinien enden „im tiefen Grund der einen göttlichen Wesenheit“, hinter allen historischen Kulissen steht, quer zur Geschichte, der eine und einzige Gott der Offenbarung.
Es mag faszinierend sein, das ägyptische Pantheon in dieser Weise dreidimensional zu ordnen und den Einen als Fluchtpunkt zu setzen, aber dahinter steht das alte apologetische Bemühen, die ägyptischen Götter für uns glaubhafter zu machen und den Nachweis zu führen, daß auch die ägyptische Religion dem einzig anerkannten Adel des „von Gott“ angehört. Damit wird man jedoch dem Wesen, der Wirkung und Bedeutung ägyptischer Gottheiten und ihrer Vielgestalt nicht gerecht, und es bleibt die Frage, wie der altägyptische Mensch selber seine ihm eigenen Götter gesehen und gedeutet hat.
Mit dem Titel „Der Eine und die Vielen“ für mein Buch habe ich versucht, die Spannweite des Problems anzudeuten. Unmittelbaren Anstoß gab die kritische Auseinandersetzung mit zwei Büchern, die Eberhard Otto und Siegfried Morenz, unabhängig voneinander, im Laufe desselben Jahres (1964) unter dem gleichen Haupttitel „Gott und Mensch“ veröffentlicht hatten.32 Beide Autoren haben den Singular „Gott“ mit Bedacht gewählt, obwohl niemand leugnen kann, daß die Ägypter über Jahrtausende hinweg mit einer Vielzahl von Gottheiten gelebt haben. Wir müssen uns davor hüten, einen der beiden Pole ganz auszublenden, auch wenn wir damit in sehr komplexe Gedankenbahnen eintreten.
Wenn wir beide Pole stehen lassen, machen wir den Weg frei für eine differenziertere Betrachtung ägyptischer Gottesvorstellungen, die dem „Denken des Einen“ (W. Beierwaltes) durchaus Raum gibt, aber die Vielfalt der Erscheinungen nicht aufzulösen sucht. Bemühungen, hinter dieser Vielfalt den Einen zu finden, verstärken sich nach Echnaton und führen zur Vorstellung eines Weltgottes, der den ganzen Kosmos ausfüllt und doch in die Verborgenheit entrückt ist.
Diesen „Kosmotheismus“ der Ramessidenzeit habe ich in der ersten Fassung des Buches zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat Jan Assmann ein eindrückliches Bild dieses neuen Ringens um eine Einheit des göttlichen Wesens entworfen,33 und Reinhold Merkelbach hat damit den Weltgott verglichen, der in den griechischen Zauberpapyri aus Ägypten angerufen wird.34 Die Größe dieser Gottesgestalt sprengt alle Grenzen: Die Flut ist sein Ba, seine beiden Augen sind Sonne und Mond, sein Kopf der Himmel, seine Füße die Unterwelt; er ist Herr von Raum und Zeit, aber auch der Nothelfer des einzelnen Menschen. Nach Assmann entfaltet sich dieses „Denken des Einen“ in drei Phasen: von der Primat-Theologie der 18. Dynastie über die monotheistische Licht-Theologie Echnatons zum Kosmotheismus der Ramessiden. Gerne würde man dieser einfachen und klaren Linie folgen, wenn es nicht zu viele gegenläufige Tendenzen gäbe. Bereits gegen den Primat des Sonnengottes regen sich Widerstände, vor allem unter Amenophis III. Neben dem einen, allumfassenden Weltgott der Hymnen und magischen Texte steht die „Reichstriade“ (Kap. VII), steht das gedankliche Ringen um eine Einheit von Re und Osiris und steht die Hinwendung zur Vielfalt der Götter, wie sie sich in den Tempeln und Gräbern gerade der Ramessidenzeit immer stärker entfaltet; im Königsgrab werden von Regierung zu Regierung weitere Gottheiten in das Bildprogramm aufgenommen, zuletzt auch solche von nur lokaler Bedeutung, von einer Tendenz zur Verehrung des Einen ist hier nichts zu spüren. Der Verborgenheit dieses Einen stellt man in den Beamtengräbern und auf Totenbuch-Papyri seinen sichtbaren Lauf in immer neuen, bildfreudigen Varianten gegenüber, und dazu tritt noch die Vielgestalt des Tierkultes.
Mein Anliegen war die Frage, wie die Menschen Altägyptens sich Götter oder einen einzelnen Gott vorgestellt haben, ob und in welcher Form sie neben oder hinter der bunten Palette ihrer Göttergestalten eine unpersönlich-anonyme Macht sahen oder verehrten, ob sie mithin als Vorläufer monotheistischer Religion gedeutet werden dürfen. Das waren sie wohl nicht, aber wir stoßen in der ägyptischen Religionsgeschichte immer wieder auf ein komplexes Wechselspiel zwischen Einheit und Vielheit, und dabei ist das „und“ entscheidend. Wir hoffen am Horizont unseres Weges auch weiterhin die Frage im Auge zu behalten, die weit über Ägypten hinaus für das Selbst- und Weltverständnis des Menschen von Bedeutung ist: Was ist das eigentlich, ein Gott? Was bedeutet er dem Menschen, der an ihn glaubt? Was tritt dem Suchenden in dieser so persönlichen Form als ein antwortendes Du gegenüber, in einem Dialog, der das Dasein bestimmt?
Dabei brauchen wir in keine Glaubensfragen um die Existenz oder Nichtexistenz Gottes oder der Götter einzutreten. Es geht auch nicht um eine Kritik am Monotheismus oder um eine Überwindung der „Mosaischen Unterscheidung“ (J. Assmann) von wahrer und falscher Religion. Allein durch die Tatsache, daß die Ägypter jahrtausendelang mit ihren Göttern gelebt, mit ihnen in einem lebendigen Dialog gestanden haben, ist die geschichtliche Wirklichkeit der ägyptischen Götter gegeben. Sie sind legitime, ja notwendige Objekte wissenschaftlicher Bemühung, die nicht nach ihrem Sein und ihrer „ontischen Gegebenheit“ fragt, sondern nach ihrer Erscheinung und Bedeutung für den Glaubenden, für die von Menschen im Glauben an Götter gestalteten Kulturen.