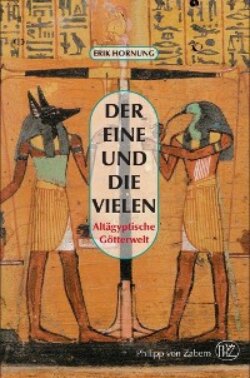Читать книгу Der Eine und die Vielen - Erik Hornung - Страница 7
ZWEITES KAPITEL
Was ist ein Gott?
Ägyptische Gottesbezeichnungen netjer und seine Grundbedeutung
ОглавлениеDa jede Untersuchung der ägyptischen Gottesvorstellungen die Ägypter selbst in ihren textlichen und bildlichen Zeugnissen befragen muß, hat sie von der Terminologie auszugehen, welche die Ägypter in ihrer eigenen Sprache verwandt haben. Diese methodische Forderung hat bereits Le Page Renouf (Vorlesungen S. 87) in aller Schärfe und Deutlichkeit aufgestellt:
In der gesammten ägyptischen [d. h. ägyptologischen] Literatur findet sich keine Thatsache, welche fester stünde, als die, dass dieselben Menschen an der Lehre von einem Gott und von einer Mehrzahl von Göttern hingen, und die andere, dass es Niemand einfiel, einen Widerspruch in diesen Lehren zu finden. Wenn nun das Wort Gott für die Ägypter dieselbe Bedeutung als für uns besass, so kann natürlich nichts alberner und ungereimter sein. Desshalb sehen wir uns veranlasst, vor allen Dingen festzustellen, was die Ägypter eigentlich mit dem Worte nutar, das wir mit Gott übersetzen, ausdrücken wollten.
Da wir die Kenntnis der ägyptischen Sprache hier nicht voraussetzen können, wollen wir versuchen, dabei mit so wenig Philologie als möglich auszukommen. Das ägyptische Wort, das wir mit „Gott“ wiedergeben, erscheint bei Le Page Renouf und anderen älteren Ägyptologen in der Form nutar. Nach unserer heutigen Umschrift lautet es ntr, wobei t einen präpalatalen Verschlußlaut meint, der gewöhnlich durch č umschrieben wird. Da unsere Umschrift nur das Konsonantengerippe der ägyptischen Wörter wiedergibt, ist damit über die Aussprache noch nichts gesagt. Wir verbinden, um ein Gebilde wie ntr überhaupt aussprechbar zu machen, die Konsonanten mit einem -e- und sprechen netscher (oder netjer). Die wirkliche Aussprache ägyptischer Wörter kann mit Hilfe keilschriftlicher, griechischer, koptischer und anderer voll vokalisierter Formen nur allmählich erschlossen werden und lautete in unserem Falle etwa natschir (Femininum natscharat „Göttin“).1
Abb. 1. Die Gotteshieroglyphe „Umwickelter Stab“.
Zeichnung A. Brodbeck nach Newberry, JEA 33, 1947, 90
Geschrieben wird netjer mit einem Hieroglyphenzeichen, das in seiner gewöhnlichen Form wie in Abb. 1a aussieht. Da es in der älteren Zeit gelegentlich eine spitz zulaufende Variante wie in Abb. 1b zeigt, ist es von Champollion2 und einigen späteren Ägyptologen als Axt gedeutet worden. Aber ägyptische Äxte haben ein ganz anderes Aussehen3 und zeigen nicht, wie unser Zeichen, eine Umwicklung des ganzen Schaftes. So ist die Deutung als Axt bereits 1892 von Petrie4 zu Recht ausgeschlossen worden, doch hielten noch Jahrzehnte später manche Gelehrte an dieser alten Deutung fest.5
Die ältesten, zum Teil noch vorgeschichtlichen Formen des Zeichens6 gehören zum Typus der Abb. 1c, zeigen also wohl einen Stab mit Bändern. Die Zahl der Bänder, die bis in die 3. Dynastie hinein deutlich getrennt gezeigt werden, schwankt zwischen zwei und vier. Erst in der Pyramidenzeit gewinnt das Zeichen seine endgültige Gestalt (Abb. 1a), mit einem Tuchfetzen statt der Bänder; sorgfältig ausgeführte Zeichen lassen die Umwicklung des ganzen Stabes erkennen. Entsprechend lauten die neueren Definitionen des Zeichens, am genauesten bei Newberry7: „a pole wrapped round with a band of cloth, bound by a cord, the end projecting as a flap or streamer.“ Kürzer fassen sich z. B. das Wörterbuch der ägypt. Sprache (II 357, 12): „Stab, der mit Zeug umwickelt ist“ oder Gardiner in seiner Zeichenliste8: „cloth wound on a pole“.
Daß diese neuere Deutung des Zeichens im Prinzip richtig ist, dürfte zur Zeit unbestritten sein. Auch die Ägypter selbst scheinen das netjer-Zeichen in dieser Richtung gedeutet zu haben, wenn die Belege dafür auch erst aus der Spätzeit oder frühestens aus dem Ende des Neuen Reiches stammen, kaum vor 1200 v. Chr. In der „aenigmatischen“, besonders verschlüsselten Hieroglyphenschrift, findet sich für das Zeichen auf einer Reihe von Skarabäen der Lautwert w, den Drioton9 von wt, „einwickeln, umwickeln“, ableitet. wt ist seit alter Zeit auch der Titel des Balsamierers und die Bezeichnung der Mumienbinden. Diese können, allerdings erst in der Spätzeit, auch netjeri heißen (Wb II 365, 14; vgl. auch II 363, 19), und der gleichfalls späte Zeichenpapyrus aus Tanis erklärt das netjer-Zeichen als jw. f qrsw, „Es ist bestattet“10 .
Auf diese Zusammenhänge hat bereits Newberry11 verwiesen, und die seit alter Zeit belegte Bezeichnung der Verstorbenen als netjeru, „Götter“, erhielte im Lichte dieser Verbindungen einen sehr konkreten Hintergrund: Durch seine Einwicklung, die zeitlich schon vor der eigentlichen Mumifizierung belegt ist, würde der Verstorbene zu einem netjer im Sinne des gewickelten Zeugfetisches, den das Zeichen darstellt. Dem Ägypter, der in Anspielungen lebte, sind solche Beziehungen ohne Zweifel sehr gegenwärtig gewesen; für uns aber sind sie einstweilen zu vage und hypothetisch, um uns in dieser Richtung über das Aufzeigen von Möglichkeiten hinauszuwagen. Es kommt hinzu, daß wir, wenn wir diese Spuren weiter verfolgen, zwar wesentliche Einsichten in das Wesen der Mumifizierung, aber kaum in das Wesen der ägyptischen Gottesvorstellung erwarten können.
Für die abschließende Deutung des Zeichens stellt sich die Alternative „Kultfahne“ oder „gewickelter Fetisch“. Als „eine Art Fahne“ hat unter anderen Kurt Sethe 1930 das Zeichen erklärt12; auch der Religionshistoriker K. Goldammer deutet es in der bisher umfassendsten Studie über die Gotteshieroglyphe13 als „Kultfahne“ bzw. als „Zeug- oder Flaggenfetisch“ (so S. 16). In diesem Zusammenhang wird stets auf die hohen, den Eingangsturm (Pylon) überragenden Flaggenmasten vor ägyptischen Tempeln verwiesen, die mit ihren flatternden Tuchstreifen an die älteste Form der Gotteshieroglyphe erinnern (Abb. 1) und vielleicht schon vor den Heiligtümern der Frühzeit gestanden haben14. Sie standen auch vor den Aton-Tempeln Echnatons und vor den kleinen privaten Heiligtümern in seiner Residenz. Aus ptolemäischer Zeit sind Masten mit weißen, grünen und roten Wimpeln überliefert;15 die gleiche Farbenkombination begegnet einmal unter Amenophis III.,16 während wir sonst in farbigen Darstellungen des Neuen Reiches nur weiße und rote Bänder finden.17
Mehrfach18 wurde auf ethnologische Parallelen verwiesen: In ganz Nordostafrika und im Sudan werden bis in jüngste Zeit vor dem Eingang heiliger Gräber Flaggenmasten errichtet, offensichtlich in einer jahrtausendealten Tradition, die ihren sichtbaren Ursprung im alten Ägypten genommen hat. Bezeichnend ist dabei, daß die Fahne mit dem Numen selbst, dem „Schêch“, identifiziert werden kann, wie es Blackman für die Nubier von Derr überliefert; hier ist das Zeichen wieder zum Fetisch geworden. Allerdings hat J. Baines in einer neueren Untersuchung zur Symbolik und Verwendung des Zeichens berechtigte Zweifel an der Deutung als Fetisch angemeldet, da es weder als Kultobjekt noch als Amulett bezeugt ist,19 und für J. Assmann ist es „ein sakrales Symbol allgemeinster Bedeutung“ (Artikel „Gott“ im LÄ). Zeugstreifen finden sich noch bei anderen kultisch bedeutsamen Objekten der Ägypter. Auf den bereits in vorgeschichtlicher Zeit häufig dargestellten Traghölzern mit heiligen, machtgeladenen Gegenständen („Standarten“) fehlen kaum je die Tuchstreifen, die, gewöhnlich in der Zweizahl, vom Tragholz herabhängen. Auch an den heiligen, mit dem Osiriskult verbundenen Djed-Pfeiler und an die Säulen, die in Darstellungen des Neuen Reiches den Kiosk des thronenden Königs oder den Schrein von Göttern tragen, sind solche Tuchstreifen angebunden. In diesem Zusammenhang muß man auch die flatternden Bänder des Königsornates einordnen, die vor allem die Darstellungen der Amarnazeit beleben, sowie die zahllosen, lang herabhängenden Bänder, die in der Tracht von Göttern, Königen und Privatleuten begegnen.20 Alle diese Zeugstreifen haben sicher eine wichtigere Aufgabe, als nur der „Verzierung“ zu dienen. Dazu tritt noch die überragende Bedeutung, die Stoffe als Beigaben in Begräbnissen und in Grundsteindepots besitzen. Auf die Bedeutung der jenseitigen Versorgung mit Stoffen und Kleidern weist das Amduat in der achten und neunten Nachtstunde hin.
Die Deutung der Gotteshieroglyphe als „Kultfahne“ o. ä. und die Heranziehung paralleler Verwendungen von Zeugstreifen im Rahmen des ägyptischen Kultes verwischt jedoch einen bezeichnenden Unterschied. Bei den Flaggenmasten der Tempel, den „Standarten“ und den Säulen haben wir es mit einem Stab, Pfeiler oder Pflanzenelement zu tun, an das zumeist oben21 die Zeugstreifen angebunden sind. Bei der Gotteshieroglyphe ist dagegen der ganze Stab umwickelt, wie genaue Darstellungen des Zeichens deutlich zeigen. Es besteht daher die Möglichkeit, daß die „Kultfahne“ etwas Sekundäres, Abgeleitetes darstellt und daß wir es primär mit einem umwickelten, d. h. bekleideten und damit machtgeladenen Stab zu tun haben, der vor dem Auftreten anthropomorpher Gottheiten das Numinose schlechthin verkörpert hat – neben den Tiergestalten, von denen vielleicht keine repräsentativ genug war, um bei der Schrifterfindung allgemein den Begriff „Gott“ zu verkörpern. Im Unterweltsbuch Amduat wird der Name der Gottes-Hieroglyphe (netjerit) mit dem Stab-Zeichen determiniert,22 also in die Gruppe der heiligen Stäbe und Szepter eingeordnet. Auch Goldammer rechnet offenbar mit der Möglichkeit, daß die „Kultfahne“ sekundär ist: „Wahrscheinlich ist die Fahne hervorgegangen aus dem umwickelten Stab“ (a. a. O., S. 39). Sie ist nicht mehr der Gott selbst, sondern sein Attribut, ein Signal, das den Aufenthaltsort des Gottes anzeigt (S. 32)23. Fraglich scheint mir, ob man die heilige Fahne und ihren Vorläufer in eine Zweiheit von Stange und Gewebe mit jeweils eigener Bedeutung zerlegen darf; Goldammer (S. 27 und 38) folgt hier zum Teil M. A. Murray24, welche die Fahnen- und netjer-Stange in den Zusammenhang der Baumkulte, der in Ägypten reichbezeugten Verehrung heiliger Bäume stellen will. Doch bildet das netjer-Zeichen mit seiner durchgehenden Umwicklung eine Einheit, die auch als Einheit gedeutet werden muß.
Die gebräuchlichste ägyptische Gotteshieroglyphe kann somit als Zeugnis für die Heiligkeit „unbelebter“ Gegenstände gesehen werden, dessen direkte Abkömmlinge wahrscheinlich die Fahnen und die sonstigen im Kult verwendeten Tuchstreifen sind, bis hin zur heutigen Nationalfahne. Im Schema einer ägyptischen Religionsgeschichte, wie es Gustave Jéquier in seinen „Considérations sur les religions égyptiennes“ (1946) gezeichnet hat, vertritt der Fetischismus die älteste, primitivste Stufe, auf welche die höheren Stufen der Zoolatrie (Verehrung tiergestaltiger Gottheiten) und des Anthropomorphismus (Verehrung der Gottheiten in Menschengestalt) folgen. Es ist ein bezeichnendes Zusammentreffen, daß die beiden anderen ägyptischen Gotteshieroglyphen der älteren Zeit diesen beiden „höheren“ Stufen angehören. Das eine dieser beiden Zeichen, das vorwiegend in der kursiven Schrift der Ägypter (Hieratisch) als Deutzeichen Verwendung findet, seltener in der monumentalen Hieroglyphenschrift und nur gelegentlich als Ideogramm für netjer „Gott“ begegnet, zeigt einen Falken auf einer Tragstange (Abb. 2a), also eine der wichtigsten tiergestaltigen Verkörperungen göttlichen Wesens. Als Hieroglyphe ist das Zeichen keineswegs jünger als die Kultfahne, sondern gehört wie dieses der ägyptischen Schrifterfindung um die Wende von der vorgeschichtlichen zur geschichtlichen Zeit an.25 Später entspricht ihm das Zeichen der Kobra hinter dem Namen von Göttinnen.
Eindeutig jünger ist das dritte, anthropomorphe Gotteszeichen, das einen hockenden Gott mit ungegliedertem Körper und dem umgebundenen Zeremonialbart der Götter zeigt (Abb. 2b). Als bildliche Darstellung schon zu Beginn des Alten Reiches belegt, wird das Zeichen erst gegen Ende dieser Epoche als Deutzeichen für Gottesnamen in die Hieroglyphenschrift aufgenommen;26 vereinzelt findet es auch als Ideogramm für netjer „Gott“ Verwendung.27
Abb. 2. Andere Gotteshieroglyphen.
Zeichnung A. Brodbeck nach N. de G. Davies, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh (London 1900), Plate VII, 87 und Plate IV, 11
Neben diesen drei allgemeinen Gotteshieroglyphen gibt es eine ganze Reihe von Bildzeichen (die Gruppe C der Zeichenlisten) für bestimmte tier- und menschengestaltige Gottheiten, die vor allem in ramessidischer Zeit (19. und 20. Dynastie) als Abkürzung der ausführlichen Gottesnamen beliebt sind (Abb. 3). Für unsere Frage nach der ägyptischen Gottesvorstellung können wir von diesen speziellen Zeichen jedoch absehen. Erst spät, in der ptolemäisch-römischen Zeit, wird auch die Stern-Hieroglyphe (N 14) zu einem häufigen Bildzeichen für „Gott“, wohl im Zusammenhang mit der zunehmenden Gestirnsverehrung in dieser Zeit; davor gibt es, seit der 19. Dynastie, nur vereinzelte Beispiele für diesen Gebrauch.28 Der Falke kann in den späten Tempeln auch durch andere Vögel oder durch andere göttliche Tiere wie Schakal oder Krokodil ersetzt werden.
Abb. 3. Hieroglyphen-Gruppe C.
Nach A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, Third Edition, London 1964, S. 544
Als Ergebnis halten wir zunächst fest: In der ägyptischen Schrift erscheinen Gottheiten in menschlicher, tierischer und in „Fetisch“-Gestalt. Die menschliche Gestalt ist um einige Jahrhunderte jünger, während Tier und Fetisch zum ältesten Bestand der ägyptischen Schrift gehören; eine Priorität des Fetischismus vor der Zoolatrie, wie sie das Schema von Jéquier annimmt, ist somit aus der Schriftentwicklung nicht zu erweisen und auch sonst am ägyptischen Material nicht wahrscheinlich zu machen. Allerdings ist auch ein Gegenbeweis nicht möglich. Das häufigste Gotteszeichen stellt einen „Fetisch“ in der Gestalt eines umwickelten Stabes dar; es lehrt uns damit eine für den vor- und frühgeschichtlichen Ägypter wichtige und typische Erscheinungsweise göttlicher Macht kennen, sagt aber über das Wesen der ägyptischen Gottesvorstellung nichts weiter aus.
Besseren Aufschluß könnten wir aus der Etymologie des Wortes netjer, „Gott“, erwarten, wenn sie geklärt wäre; aber wie beim sumerischen dingir und beim semitischen el sind die bisherigen Versuche, die Bedeutung von netjer etymologisch zu bestimmen, nicht überzeugend. Die älteste, von de Rougé29, Pierret und vielen anderen als selbstverständlich vorausgesetzte Etymologie „verjüngen, sich erneuern“ würde zur ägyptischen Gottesvorstellung hervorragend passen; aber die Schreibung von netjer mit der „Jahresrispe“, auf die sie sich stützt, hat rein lautliche Gründe (Lautwert tr) und ist daher für eine Etymologie unbrauchbar. Le Page Renouf hat sich nach seinem so vorbildlich klaren, methodischen Anfang völlig festgerannt, weil er das Wort von einem Adjektiv netjeri ableiten wollte, das wir noch besprechen werden und das gegenüber dem Substantiv netjer eindeutig sekundär ist.
Zu keinem brauchbaren Ergebnis hat auch der zuletzt von F. W. von Bissing unternommene Versuch geführt, netjer von „Natron“ (ein altägyptisches Wort!) abzuleiten und daher mit der kultischen Reinheit zu verbinden.30 Noch unwahrscheinlicher ist die Erklärung des Wortes als „He of the Poplar-Tree“, die Margaret A. Murray gegeben hat.31 Murray möchte in der ägyptischen Gottesbezeichnung eine Ableitung von dem Baumnamen tjeret, „Weide“, sehen und daher mit dem Baumkult verbinden, der für Ägypten zwar gut bezeugt ist, aber zu keiner Zeit derart im Vordergrund der Gottesvorstellung gestanden hat, wie es die Hypothese von Murray annimmt.
Die Versuche, durch Wortvergleichung innerhalb der afroasiatischen Sprachgruppe eine einleuchtende Etymologie für netjer zu finden, sind bisher nicht erfolgreicher gewesen. Die Parallele zu einem Wort inkirāoder enkerā mit der Bedeutung „Seele, Leben, Dämon“ (in Kuschitensprachen32) nützt uns wenig; der zeitliche Abstand ist zu groß, und es könnte eine sekundäre Ableitung vorliegen. Ähnliches gilt für Verbindungen mit anderen afrikanischen Sprachen.33
Schließlich wird auch behauptet, netjer bezeichne ursprünglich nicht Gottheiten, sondern die Verstorbenen34 oder noch spezieller den toten König35. Es trifft zu, daß der lebende und vielleicht auch der tote König schon in der frühdynastischen Zeit als netjer bezeichnet werden können, doch wäre es ein voreiliger Kurzschluß, die ägyptische Gottesbezeichnung für die Vor- und Frühgeschichte auf diese einzige Verwendungsweise einzuschränken. Aus den frühgeschichtlichen Quellen, die uns in Personennamen und Titeln vorliegen, läßt sich eine generelle Gleichsetzung von netjer mit den Verstorbenen oder dem toten König nicht ableiten.
Wir können uns der Einsicht kaum entziehen, daß sich weder Etymologie noch „ursprüngliche Bedeutung“ des Wortes netjer klären lassen, so daß wir von dieser Seite, wie schon von der Schreibung her, keinen Aufschluß über das Wesen der ägyptischen Gottesvorstellung gewinnen. Wir müssen diese Fragen auf sich beruhen lassen und uns der Verwendung des Wortes zuwenden, um mehr Klarheit zu gewinnen.