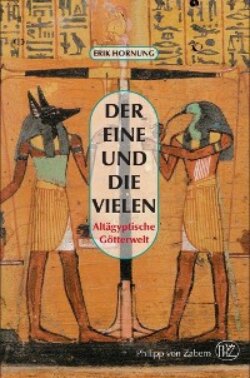Читать книгу Der Eine und die Vielen - Erik Hornung - Страница 9
Weitere elementare Begriffe für göttliche Mächte
ОглавлениеDa das Wort netjer bereits der ältesten für uns faßbaren Gestalt der ägyptischen Schriftsprache angehört, sind ältere Bezeichnungen göttlicher Mächte nicht nachzuweisen und bleiben daher, wo sie vermutet werden, im Bereich der Hypothese. So hat z. B. Helck54 in dem Wort ba’u eine ältere Bezeichnung der Lokalnumina sehen wollen, ausgehend von dem Gebrauch des Wortes, den wir in der Erwähnung der ba’u (gewöhnlich als „Seelen“ übersetzt) von Buto, Hierakonpolis, Heliopolis oder Hermopolis haben.
Diese „Seelen“ oder besser „Mächte“ haben unterschiedliche Deutung gefunden. Sethe wollte in ihnen die alten, verstorbenen Könige dieser Orte sehen,55 während Kees sie für „gewisse sehr alte, zahlen- und artmäßig nicht begrenzte Götterkreise eines Ortes“ hält,56 die Bezeichnung also nicht auf Könige allein einengen will; auch neuere Deutungen der „Mächte“ schwanken zwischen diesen beiden Polen, doch dürfte die Deutung von Kees den Quellen besser gerecht werden. Schon in den Pyramidentexten (§ 1689) scheinen die „Beiden Götterneunheiten“ einen Teil der „Seelen“ von Heliopolis zu bilden, und die Mächte werden auch direkt als netjeru bezeichnet (§ 478f.); in den Sargtexten werden wohlbekannte Götter den verschiedenen „Seelen“ zugerechnet. Wir können in den ba’u, wo sie als Personen auftreten, „göttliche Wesen“ im allgemeinsten Sinne sehen, die gelegentlich völlig den „Göttern“ entsprechen,57 in Pyr. § 1549c allerdings den netjeru nachgeordnet werden, worauf K. Koch hingewiesen hat.58 Älter ist eine andere Verwendung des Wortes ba’u, die sich bereits in Eigennamen der Frühzeit und häufiger im Alten Reich belegen läßt. Hier werden Aussagen über einen abstrakten Begriff ba’u gemacht, und zwar über den ba’u bestimmter Götter (Chnum, Ptah, Sokar) und Göttinnen (Hathor, Sachmet), ferner über den ba’u des Ka und des Königs. Dieser ba’u kann „in Erscheinung treten“ (chai) und bedeutet in allen deutlichen Belegen eine ausstrahlende Wirkung der Gottheit, die anfangs ganz in positivem Sinn, später mehr und mehr auch negativ auf den Gang der Welt einwirkt. Der Verfasser der „Admonitions“ spürt im allgemeinen Umsturz den ba’u des Schöpfergottes nicht mehr, ein Expeditionsleiter der 11. Dynastie schreibt seinen Erfolg dem ba’u des Min zu;59 im Neuen Reich dagegen verursacht der ba’u Gottes ein verheerendes Unwetter, über das König Ahmose auf einem Denkstein berichtet.60 Der ba’u Echnatons steht im Gegensatz zu seiner „Gunst“,61 und auch der „Zorn“ eines Privatmannes kann damit gemeint sein.62 In der Spätzeit bezeichnet ba’u ganz konkret den „Zorn“ oder die „Wut“ einer Gottheit,63 im Koptischen schließlich „Gewalttat, Verbrechen“.64
Die ursprüngliche Bedeutung von ba’u muß konkreter gewesen sein, als es die Wiedergabe durch „Ruhm“ oder „Ansehen“ erkennen läßt. Wahrscheinlich wird es, wie in vielen anderen Fällen, unmöglich sein, ein wirklich entsprechendes Wort in unserer Sprache zu finden. Übersetzungen wie „Macht“, „Wille“ oder auch „Tatkraft, Gestaltungsvermögen“ (Wolf-Brinkmann) passen nicht an allen Stellen. Sicher scheint, daß ba’u immer eine aktive und sichtbare Seite der göttlichen Person meint, als Träger und vielleicht auch Ursache der Wirkung von Göttern, so wie die sichtbare Aktivität auch ein Kennzeichen der Ba-Vorstellung bildet – in den Unterweltsbüchern ist es der Ba des Verstorbenen, der aktiv und sichtbar handelt, etwa mit dem Sonnengott Zwiesprache hält, sich in das Gottesgefolge einreiht oder den Leichnam aufsucht.
Als Antwort auf Echnaton bildet sich eine „Ba-Theologie“ heraus, die in Naturphänomenen oder in heiligen Tieren den Ba eines Gottes wirksam sieht. Eine kleine Liste dieser Ba-Verkörperungen findet sich bereits im „Buch von der Himmelskuh“ aus der Zeit Tutanchamuns; sie gipfelt in der Aussage, daß der Ba des Sonnengottes Re durch die ganze Welt wirkt (Vers 286).65 Wie die Seele im Leib, verkörpert sich der Schöpfer als Ba in der Welt, die er geschaffen hat, wobei schon die Unterweltsbücher betonen, daß er als Ba jede Nacht in die Unterwelt hinabsteigt.
Die Gleichsetzung von Wirkung und Person, die Bezeichnung von Gottheiten als ba’u, steht sicher nicht am Anfang der Wortgeschichte, ist aber früh bezeugt. Vergleichbar wäre die Entwicklung des Begriffs za, „magischer Schutz“, der im Alten Reich eine Wirkung von Gottheiten,66 auf den „Zauberstäben“ des Mittleren Reiches aber die schützenden Dämonen selbst meint,67 im Austausch mit netjeru, „Götter“. Daß in den Kreis der austauschbaren Begriffe auch Bezeichnungen für Verstorbene wie achu, „Verklärte“, oder datiu, „Unterweltliche“, einbezogen sind, kann nicht überraschen, da die Toten seit früher Zeit als „Götter“ gelten. Ein eigenes Wort für „Dämonen“ fehlt in der älteren Sprache; von der Funktion her aber könnte man viele Wesen der Unterwelt als Dämonen ansprechen.
Die bedeutsamste ägyptische Gottesbezeichnung neben netjer ist ohne Zweifel sechem, das gewöhnlich als „Macht“ übersetzt wird, also Assoziationen mit dem „Numen“ der Religionswissenschaft nahelegt und zur vielumstrittenen Frage „Mächte vor Göttern“ führt.68 Auch diese Frage läßt sich von der Terminologie her nicht klären: wie ba’u und netjer gehört sechem im besten Fall zum ältesten greifbaren Bestand der ägyptischen Schriftsprache, ist also gegenüber den anderen Begriffen nicht als älter zu erweisen. Die spätere Bedeutungsentwicklung, die erst im Laufe des Neuen Reiches zur Bedeutung „Bild (eines Gottes)“ führt, habe ich an anderer Stelle69 untersucht. In den ältesten deutlichen Belegen scheint auch sechem eine ausstrahlende Wirkung von Gottheiten zu meinen, ein Charisma, personifiziert dann eine „unpersönliche Kraft“,70 die mit jeder konkreten Gottheit verbunden werden kann und überdies im sechem-Szepter sichtbar wird. Indem der Verstorbene zu einem „Gott“ wird, erlangt er auch die Eigenschaft des sechem-Seins (Pyr. 752). Die Pyramidentexte geben häufig parallele Aussagen über den Ba und die sechem-„Macht“71. Die Göttin Sachmet ist von ihrem Namen her die „Mächtigste“, später erhält Amun als höchster Gott einen ähnlichen Superlativ („Mächtigster der Mächtigen“) als Beiname72, während sich die gleiche Kraft beim feindlichen Gott Seth negativ auswirkt.73 Da die sechem-Eigenschaft allen Gottheiten zukommt, kann der Plural des Wortes mit dem Plural „Götter“ ausgetauscht werden,74 erst in ptolemäischer Zeit wird er offenbar nur auf eine bestimmte, lokal gebundene Gruppe von Gottheiten angewandt.75
Eine Fülle weiterer Bezeichnungen ist für die Bilder von Gottheiten in Gebrauch und daher an dieser Stelle nicht zu besprechen.