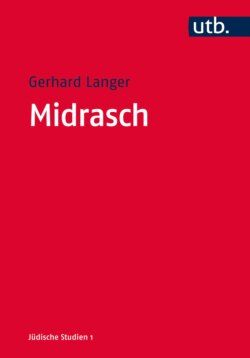Читать книгу Midrasch - Gerhard Langer - Страница 12
3. Eine kurze Begriffsgeschichte von darasch/Midrasch
ОглавлениеDer mit dem Stichwort Daraschdarasch verbundene Dialog mit Gott beginnt bereits in der Bibel. Wie Gerleman/Ruprecht (drš) zeigen, macht die Bedeutung des Begriffes darasch schon hier eine Entwicklung durch. In profaner Verwendung meint er zumeist ein sich |23|Erkundigen nach der Beschaffenheit einer Sache, aber auch das Streben und Trachten (vgl. z.B. Jes 1,17; 16,5; Am 5,14; Est 10,3) und sich um etwas Kümmern (vgl. Jer 30,14; Ps 142,5; Spr 31,13; 1 Chr 13,3). In der wesentlich häufigeren Verwendung im religiösen Kontext bedeutet darasch ein Fordern von Blut (z.B. Gen 9,5), eines Gelübdes (Dtn 23,22), Opfers (Ez 20,40) u.ä., vor allem aber die Befragung GottesBefragung Gottes durch einen Gottesmann, Seher, Propheten (u.a. in 1 Sam 9,9; 1 Kön 14,5; 22,7; 2 Kön 22,13). Auch fremde Götter oder Totengeister werden befragt (Dtn 18,11; Jes 8,19; 19,3; 2 Kön 1,2). Gerleman/Ruprecht konstatieren eine Veränderung der Bedeutung in der Exilszeit zu einem „Habitus des Frommen“ (Sp. 464). Dieser entsteht aus der Entwicklung von der aufgrund einer Notlage notwendigen Befragung, der Klage des Einzelnen (vgl. u.a. Ps 22,27; 34,5; 69,33; 77,3) und des Volkes (vgl. Jes 58,2) hin zu einem Habitus des sich an Gott Haltens. „Dieser Übergang ist vollzogen in der deuteronomistischen Theologie, wo Umkehr und neues Halten der Gebote auf Seiten des Menschen Voraussetzung wurde für Gottes Hören der Klage (vgl. z.B. 1 Sam 7,3–4; ferner Dtn 4,29; Jes 55,6f.; 58; Jer 29,13; 2 Chr 15,2 und 4)“ (Sp. 465–466). Diese Haltung steht in einem Gegensatz zum Götzendienst (Jes 65,1.10; Jer 8,2; Zef 1,6 u.a.). darasch wird geradezu zum Synonym für „die Gebote halten“ oder „den Willen Gottes erfüllen“ (1 Chr 22,19; 2 Chr 14,6; 31,21; Ps 14,2; 119,2.10). „An einigen späten Stellen können sogar die Gebote Objekt von drš sein (Ps 119,45.155; 1 Chr 28,8), in der späten Glosse Jes 34,16 sogar »die Schrift«“ (Sp. 466). Im letztgenannten Text geht es aber offensichtlich um mehr als nur ein Befolgen der Schrift, sie muss befragt werden, womit wieder der Aspekt der Gottesbefragung auftritt, der am Anfang der Bedeutungsgeschichte von darasch stand. Die Schrift ist Gegenstand der göttlichen Offenbarung. Die Befragung, ursprünglich vermittelt durch einen Propheten und direkt an Gott gerichtet, geschieht hier mittels der Lektüre und Analyse der Schrift. Dies ist noch kein Midrasch im späteren rabbinischen Sinn, wohl aber ein Schritt dorthin.
In biblischer Zeit und während der Epoche des Zweiten Tempels tritt der Begriff darasch nicht in einem hermeneutischen Sinn, also als Auslegung von Schrift auf (vgl. dazu Mandel, Legal Midrash). Vielmehr ist es vor allem der Aspekt der Lehre, der im Vordergrund steht. Unter darasch ist zumeist eine (oft öffentliche) Instruktion von RechtInstruktion von Recht gemeint. In diesem Zusammenhang ist an die Institution des Schreibers, des Sofer, zu erinnern, die mit dem akkadischen tapschurru bzw. aramäischen safar in Verbindung gebracht werden kann, was Personen bezeichnet, die sich mit göttlichen Omina beschäftigten oder auch als Übersetzer/Vermittler tätig waren. In diesem Sinne ist |24|auch der jüdische Sofer als Übersetzer und Vermittler der göttlichen Botschaft zu deuten. In Einklang mit dieser Erkenntnis muss man Esr 7,10 wohl so übersetzen: „Denn Esra war von ganzem Herzen darauf aus, die Tora JHWHs zu vermitteln (li-drosch) und danach zu handeln und sie als Satzung und Recht in Israel zu lehren“. Bei Tora ist dabei eher von einem vorausgehenden autoritativen Text auszugehen als nur von mündlicher Übereinkunft. Die Vermittlung ist natürlich gleichzeitig eine Interpretation, eine Über-Setzung.
Zweimal verwenden die ChronikbücherChronikbücher den Ausdruck Midrasch. In 2 Chr 13,22 ist davon die Rede, dass die „übrige Geschichte Abijas, sein Leben und seine Reden im Midrasch des Propheten Iddo aufgezeichnet sind“. 2 Chr 24,27 heißt es über König Joasch: „Weitere Nachrichten über seine Söhne, über die vielen Prophetensprüche gegen ihn und über die Wiederherstellung des Hauses Gottes sind aufgezeichnet im Midrasch zum Buch der Könige. Sein Sohn Amazja wurde König an seiner Stelle.“ Beide Male wird ein schriftliches Dokument als eine Sammlung von prophetischen Beschreibungen der jeweiligen Zeitepoche suggeriert, das mit großer Wahrscheinlichkeit von den Chronisten erfunden wurde, um ihre eigene „Wiedergabe“ der Geschichte als aus prophetischem Munde kommend zu etablieren.
Im umfangreichen Textkorpus aus QumranTextkorpus aus Qumran tritt darasch in vielen Belegen auf, die hier nicht alle wiedergegeben werden können (vgl. dazu Maier, daraš, midraš). Nur wenige wichtige seien genannt. In 1QS VI.6 heißt es, dass an jedem Ort, wo es zehn Männer gibt, keiner fehlen soll, der doresch in der Tora Tag und Nacht. Maier deutet dies auf einen, „der bereit steht, um Rechtsbelehrung zu erteilen und Fragen zu entscheiden. Meist wird jedoch (wenig wirklichkeitsnah) an ein ununterbrochenes Torastudium gedacht“ (Sp. 733). Steven Fraade (Legal Midrash. In: Legal Fictions, S. 154) hält auch eine liturgische Funktion für möglich.
Der Doresch ha-toradoresch ha-tora taucht als wahrscheinlich priesterlicher Begleiter des messianischen „Sprosses Davids“ auf; es könnte aber auch ein Toraprophet gemeint sein (4Q174 3.11; CD 7.18). In CD 6.2–11wird Num 21,18 („über den Brunnen, den Heerführer gruben, den die Edlen des Volkes aushoben mit dem Zepter – bimchoqaq“) ausgelegt, der Brunnen auf die Tora und das Zepter auf den doresch ha-tora gedeutet. Die Wurzel chqq bedeutet einschreiben/einhauen, anordnen. Der doresch ha-tora ist damit entweder einer, der ein Gesetz erteilt, oder vielleicht eher noch einer, der die Tora verkündet und vermittelt (vgl. Mandel, Legal Midrash; Origins).
Begegnet Tora als Obj. von darasch, handelt es sich um judikativ-administrative Vorgänge bzw. Funktionen, d.h. es wird keine neue Tora erteilt und keine höchstgerichtliche Entscheidung verkündet, es geht vielmehr |25|um Rechtsfindung und Rechtspflege auf Grund geltender Tora […] „Gott suchen“ heißt demnach: eine zuständige Instanz befragen. (Maier, Sp. 734)
Im Unterschied zur Selbsteinschätzung der Gruppe als dorsche ha-tora (4Q 177 10–11,5), als Sucher/Darleger von Tora, welche die richtige Meinung vertreten, werden manche Gegner als Dorsche ha-chalaqotdorsche ha-chalaqot, als „Sucher/Darleger von Glattheiten“ (Maier, Sp. 735) abgekanzelt. Damit könnten die Pharisäer gemeint sein (vgl. Schiffman, Pharisees). Auch hier ist weniger an eine geistige Durchdringung als an konkrete Auslegung und Lehre gedacht (vgl. etwa die Beschreibung in Jes 30,10: „Sie sagen zu den Sehern: Seht nichts!, und zu den Propheten: Erschaut für uns ja nicht, was wahr ist, sondern sagt, was uns schmeichelt, erschaut für uns das, was uns täuscht“).
Der Begriff Midrasch begegnet als Midrasch ha-toraMidrasch ha-tora in der Gemeinderegel Serech le-ansche-ha-jachad 1QS VIII.15 (VIII.12: doresch) und der Damaskusschrift (CD 20.6); dort auch Perusch (Darlegung) ha-toraperusch (Darlegung) ha-tora (6.14; 13.6), Serech (Regel, Ordnung) ha-toraserech (Regel, Ordnung) ha-tora (7.8). 1QS VI.24 ist von einem Midrasch jachad die Rede, einer „gemeinschaftlichen Untersuchung“ (Maier, Sp. 736).
Das Ergebnis, die Verkündigung des Urteils bzw. des Beschlusses, wird 1QS 8,25f. (4QSd 7,1) bemerkenswerterweise mit wa-jidroschu ha-mischpat „und verkünden das Urteil“ bezeichnet, und es wird vorausgesetzt, dass einer nach Verbüßung der Strafe in die Institutionen der Sitzung, Rechtsfindung (midrasch) und Beratung zurückkehren darf. (Maier, Sp. 737)
Die zur Gemeinderegel gehörigen Fragmente 4Q256 (4QSb) Col. IX (Frg. 4) und 4Q258 (4QSd) Col. I (Frgs. 1a i,1b) beginnen mit: „Midrasch für den MaskilMidrasch für den Maskil (Lehrer) in Bezug auf die Männer der Tora, die sich selbst verpflichtet haben, von allem Bösen umzukehren und sich streng an alles zu halten, das er angeordnet hat […]“. Dies ist eine Variante zu 1QS V.1, wo vom serech für den maskil bezüglich der Männer der Gemeinschaft die Rede ist. Maier vermutet, da serech „term. techn. der Kult- und Militärsprache“ sei und eine „festgelegte bzw. niedergeschriebene Ordnung“ bezeichne (Sp. 736), dass mit Midrasch eine Niederschrift gemeint sei. In 4Q 174 (4QFlor) 1.14 ist in einer Überschrift zum gesamten Abschnitt (vgl. Steudel, Eschatologie, S. 46) die Rede von einem Midrasch zu Ps 1,1 (Midrasch me-aschre ha-ischMidrasch me-aschre ha-isch). Ob es sich dabei um eine „Auslegung“ handelt, bleibt umstritten. Maier denkt wieder eher an eine „Darlegung bzw. Niederschrift aus (einer Auslegung bzw. eines Peshers über) […] ‚Glücklich der Mann‘“ (Sp. 736).
„Siehe, all dies ist geschrieben in Bezug auf die letzte Erläuterung der Tora (Midrasch ha-tora ha-acharonMidrasch ha-tora ha-acharon)“ begegnet in 4Q270 |26|(4QDe) Frag. 7 col. ii. (= 4Q 266 11). Damit könnte die eschatologische (vgl. Wacholder, Damascus Document) oder eher die letztgültige Verkündigung/Interpretation der Tora gemeint sein. Die Bemerkung hat als Unterschrift die Funktion einer „Überschrift“.
Folgt man Maier und Mandel, so hat darasch in diesen Texten entgegen verbreiteter Deutung mehr mit Erläuterung und Vermittlung von Tora zu tun als mit dem forschenden Ausdeuten und Interpretieren des Textes, was in späterer rabbinischer Literatur die entscheidende Funktion des Midrasch sein wird. Allerdings findet bereits in den späten Schichten des Tanach und in Qumran ein Wandel im „Objekt“ des „(Auf)suchens, Erkundens“ (darasch) statt. War es im Anfang Gott (über Vermittlung eines Propheten), so ist es später die göttliche Weisung, die Tora. Die Qumrantexte fungieren somit als eine Art „missing link“ zum Midrasch.
In Sira 51,3 begegnet bereits ein bet Midrasch, ein Lehrhaus, offensichtlich ein Ort, wo man sich Weisheit erwerben kann (51,25).
Das bet ha-Midrasch der Rabbinen schließlich definiert sich vor allem durch das Studium der BibelStudium der Bibel (mSchabbat 16.1; mPesachim 4.4). Darschanim werden schließlich auch jene Personen genannt, die sich mit Bibelauslegung beschäftigen oder diese predigen.
Ein Blick in die Bibel erschöpft sich jedoch nicht in der Analyse der wörtlichen Anklänge von darasch oder Midrasch. Vielmehr ist zu fragen, inwieweit hermeneutische, formale und inhaltliche Elemente, die den rabbinischen Midrasch auszeichnen, bereits in der Bibel grundgelegt sind. Eine solche Betrachtung sollte grundsätzlich ohne vorausgehende definitorische Festlegungen erfolgen, die Midrasch in der Bibel einerseits auszuschließen oder andererseits zu beweisen suchen. An dieser Stelle ist ausdrücklich auf die Arbeit von Michael Fishbane zu verweisen, der u.a. 1985 mit Biblical Interpretation in Ancient Israel akribisch die Mechanismen innerbiblischer Interpretation und Fortschreibung von Tradition beschrieb. Darauf wird später noch einzugehen sein.
Eine umfassende Beschreibung der rabbinischen Vorkommen von darasch/Midrasch würde hier zu weit führen. Wenige Beispiele (mit Konzentration auf den Begriff Midrasch) müssen genügen.
So bietet die MischnaMischna als erste große Sammlung rabbinischer Gelehrsamkeit nur vier Belege für Midrasch und acht für darasch. In mKetubbot 4.6 ist Midrasch eine Auslegung bzw. eine Bestimmung im Zusammenhang mit einem Ehevertrag (vgl. bJevamot 117a); in mScheqalim 6.6 (vgl. Sifra Wa-jiqra Chova 12.21.6) leitet der Hohepriester einen Midrasch (Midrasch darasch) in Bezug auf Schuld- und Sündopfer ab, der Lev 5,19 und 2 Kön 12,16 verbindet; in mNedarim 4.3 steht Midrasch neben Halachot (rechtlichen Regeln, Handlungsnormen) und Aggadot (Erzählungen, freieren |27|Auslegungen) als Lernstoff. In mAvot 1.17 betont Schimon ben Gamaliel, dass das Tun wichtiger sei als der Midrasch, womit er wohl allgemein die Lehre meint. In mJoma 8.9 leitet R. Elazar ben Azarja aus Lev 16.30 ab bzw. lehrt, dass der Versöhnungstag Übertretungen zwischen Gott und Mensch sühnt, zwischen Mensch und Mensch jedoch nur dann, wenn vorher eine Versöhnung zwischen den beiden stattgefunden hat. In mJevamot 10.3 fungiert darasch als logische Ableitung (aus Lev 21,7) in Bezug auf Eherecht. Auch in mSota 5 wird darasch viermal im Kontext rechtlicher Entscheidungen, die aus biblischen Texten hergeleitet werden, verwendet. In mChullin 5.5 leitet Schimon ben Zoma aus Gen 1,5 analog in Bezug auf Lev 22,28 logisch ab, dass ein Tag immer die vorausgehende Nacht mitmeint. In allen Fällen von darasch meint man in der Mischna also eine Rechtliche Lehre, die aus biblischen Quellen erschlossen wirdrechtliche Lehre, die aus biblischen Quellen erschlossen wird.
Die ToseftaTosefta weist zehn Belege für Midrasch auf, zumeist im Zusammenhang mit einem bestimmten Lernstoff. In tSota 7.21 z.B. wird Spr 24,27 („Nimm draußen deine Arbeit auf und bestell dein Feld, danach gründe deinen Hausstand!“) ausgelegt, wobei jeder Teil des Verses mehrmals auf eine besondere Sache bezogen wird (z.B. Arbeit – Halachot; Feld – Liebeswerke; Haus – Midrasch), wofür man schließlich Lohn erhält. tSanhedrin 7.7 gibt klare Anweisungen zum Fragenkatalog und zum Umgang bei Prozessen bzw. auch beim Unterricht. Darunter heißt es auch:
Die ganze Tora ist eine einzige Sache. Eine [wichtige] Angelegenheit und eine [unwichtige] Angelegenheit: man hält sich an die [wichtige] Angelegenheit. Ein Präzedenzfall (maʿase) und kein Präzedenzfall: man hält sich an den Präzedenzfall. Halacha und Midrasch: Man hält sich an die Halacha. Midrasch und Aggada: Man hält sich an den Midrasch. Midrasch und Schluss vom Leichteren auf das Schwerere (qal wa-chomer): man hält sich an den Schluss vom Leichteren auf das Schwerere. Schluss vom Leichteren auf das Schwerere und Analogieschluss: man hält sich an den Schluss vom Leichteren auf das Schwerere. Gelehrter und Schüler: man hält sich an den Gelehrten. Schüler und Ungebildeter: man hält sich an den Schüler.
Midrasch nimmt hier wie schon in mNedarim 4.3 eine Zwischenstellung zwischen Halacha und Aggada ein (dies gilt u.a. auch für SifDev § 48; § 306; § 344). Er bezeichnet möglicherweise eine rechtliche Instruktion, die aus der Bibel abgeleitet wird, im Unterschied zur Halacha, die aus (davon unabhängiger) Überlieferung stammt. Eine Unterscheidung zwischen Halachot, Midraschot und (H)aggadot findet sich auch in der folgenden Auslegung in einem zeitlich wohl um Einiges später entstandenen Text, dem Midrasch Schemot Rabba. Nach ShemR 47.7ShemR 47.7 erhält Moses nach vierzigtägigem Fasten, nachdem er die ersten Tafeln des Bundes zerstört hatte, erneut |28|zwei Tafeln. Diese enthalten nun nicht mehr „nur“ den Bibeltext, sondern auch die gesamte mündliche Tora. Dazu heißt es:
Auf den ersten Tafeln waren nur die Zehn Gebote. Jetzt aber, da du dich kasteit hast, gebe ich dir Halachot, Midraschot und Aggadot; denn es heißt: „[Dann sprach der Herr zu Moses:] Schreib diese Worte auf! [Denn aufgrund dieser Worte schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund]“ (Ex 34,27). Warum sagte der Heilige, gepriesen sei er: „Schreib“? Es steht doch geschrieben: „[Die Tafeln hatte Gott selbst gemacht], und die Schrift, die auf den Tafeln eingegraben war, war Gottes Schrift“ (32,16), und es steht geschrieben: „Wie bei der ersten Inschrift schrieb er auf die Tafeln [die Zehn Worte, die JHWH am Tag der Versammlung auf dem Berg mitten aus dem Feuer zu euch gesprochen hatte, und JHWH übergab sie mir]“ (Dtn 10,4). Vielmehr sagte der Heilige, gepriesen sei er, so zu ihm: Schreibe dir Tora, Propheten und Schriften, damit sie schriftlich (so nach der Druckausgabe) seien; doch Halachot, Midrasch, Haggadot und Talmud sollen mündlich sein. Als Moses das erfuhr, begann er zu sagen: „Dass ich gedemütigt wurde, war für mich gut; [denn so lernte ich deine Gesetze]. Die Weisung deines Mundes ist mir lieb, [mehr als große Mengen von Gold und Silber]“ (Ps 119,71–72).
Der wohl ins 9. Jh. zu datierende Midrasch Mischle (MidMish) bietet in Kap. 10 eine Abfolge des LernstoffLernstoffs, in der Midrasch zu den fünf Büchern Moses nach dem Midrasch zu Levitikus und seinen rechtlichen Belehrungen gelehrt wird und der vor allem Bestimmungen zum „Höre Israel“, den Gebetsriemen und der Mezuza umfasst und deutlich von Haggada und Talmud unterschieden wird. Auch hier ist Midrasch also in erster Linie auf rechtliche Belange bezogen.
Nach dem halachischen Midrasch SifDev (Haʿazinu § 313) verstanden die Israeliten am Sinai sofort, wieviel Midrasch in den Zehn Geboten enthalten ist, „wieviel Halacha, wieviele Schlüsse vom Leichteren auf das Schwerere und wieviele Analogieschlüsse“. Hier könnte Midrasch synonym für Haggada stehen. Dies gilt auch für tEruvin 8.24 bzw. tChagiga 1.9, wo Teile der rabbinischen Handlungsnormen, die sich kaum aus der Bibel ableiten lassen, von anderen unterschieden werden, die eine Fülle von Schrift(bezügen), Midrasch und Halachot aufweisen.
Im Bibeltext von Ex 18,15 ist vom Wunsch des Volkes an Moses die Rede, Gott zu befragen (li-drosch). Dann heißt es: „Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide dann ihren Fall und teile ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes mit (et-chuqqe ha-elohim weet torotaw)“ (V. 16). Sein Schwiegervater gibt Moses daraufhin den Rat: „Nun hör zu, ich will dir einen Rat geben, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott! Bring ihre Rechtsfälle vor ihn, unterrichte sie in den Gesetzen und Weisungen, und lehre sie, wie sie leben und was sie tun sollen“ |29|(V. 19.20). Im halachischen Midrasch MekhJ wird im Abschnitt Amaleq 4 das Wort chuqqim (Gesetze) aus Ex 18,16.20 mit den midraschot (Pl.) in Beziehung gebracht. So heißt es:
„Und unterrichte sie in den Gesetzen“: Die Gesetze (chuqqim) – das sind die midraschotDie Gesetze (chuqqim) – das sind die midraschot; „und Weisungen (torot)“ – das sind die Entscheidungen – Worte des Rabbi Jehoschua. Rabbi Elazar von Modiin sagt: „Gesetze“, das sind die Inzestverbote, wie es heißt: „Befolgt keinen von den gräulichen Bräuchen“ (Lev 18,30); „die Weisungen“ – das sind die Entscheidungen.
Vergleichbare Auslegungen, wo man jeweils chuqqim auf midraschot bezieht, finden sich in Sifra Schemini 1.9 zu Lev 10,10; Achare Mot 9.9 zu 18,26; Bechuqqotai 2.8.9,10 zu 26,43.46; in MidTann zu Dtn 26,16 oder in SifDev § 58.59 zu Dtn 11,32 und 12,1, wo es heißt:
„Das sind die Gesetze (chuqqim)“ (Dtn 12,1) – das sind die midraschot; „und die Rechtsvorschriften“ – das sind die dinim; „auf die ihr achten sollt“ – das ist die Lehre (mischna); „und die ihr halten sollt“ – das ist das Tun (maʿase).
Gegenüber der geläufigen Übersetzung als „Auslegungen“ (Stemberger in MekhJ) für midraschot, „exegeses“ (Neusner in Sifra „exegeses“) oder „interpretations“ (Hammer in SifDev), kann man mit Mandel und Gruber (Midrash) midraschot hier eher als eine Rechtskategorie deuten. Gruber lehnt im Übrigen die Bedeutung Bibelauslegung für den tannaitischen Gebrauch von Midrasch (mit Ausnahme von mScheqalim 6.6) ab. Mandel sieht differenzierter einen Wandel in der zweiten Hälfte des 2. Jh. mit R. Aqiva zugeschriebenen Auslegungen, die kreative Exegese bezeugen, die z.B. Widersprüche oder überflüssige Worte auflöst und erläutert (vgl. mSota 5.2,4; tSota 5.13; tZevachim 1.8). Die Unterscheidung zwischen einer Schule R. Aqivas und R. Jischmaels mit unterschiedlichen Zugängen zur Schrift, die hier angesprochen wird, soll später noch ausführlicher erläutert werden. Der darschan ist, folgt man Mandel, vielfach nicht als Ausleger zu verstehen, sondern in erster Linie als öffentlicher Lehrer von Recht.
An dieser Stelle mag genügen, dass das Verständnis von darasch und Midrasch auch in tannaitischer Zeit noch nicht fest definiert ist. Neben Mayer Grubers kritischer Analyse sind vor allem Paul Mandels verschiedene Arbeiten wichtig, um zu zeigen, dass sich die Bedeutung von darasch – etwas vereinfacht – von einer rechtlichen Instruktion und Vermittlung zu einer hermeneutischen Durchdringung und Auslegung wandelt. In diesem Sinne ist z.B. WaR 1.3WaR 1.3 zu verstehen, wo behauptet wird, dass die biblischen Bücher der Chronik „midraschisch“ erläutert (liddaresch) werden müssen, um |30|ihren eigentlichen Gehalt zu verstehen. Es folgen im Anschluss die Identifikationen der Namen von 1Chr 4,18 u.a. mit Moses, z.B. Jered = Moses, der die Tora oder die Gottesgegenwart (Schechina) herabbrachte (horid); oder Chever, der die Kinder mit dem Vater im Himmel verband (chibber). In jedem Fall überwiegen schon früh die Belege, die Midrasch im Kontext von Schule und Lehrhaus verwenden.
In den Talmudim wird der Begriff u.a. als Auslegung, die sich von logischen Schlüssen ableitet (z.B. bBava Qamma 17b), als Interpretation eines Bibelverses oder der Bibel allgemein verstanden. jScheviit 8,1,37d stellt den Grundsatz auf:
R. Bun bar Chija sagte: Jeder Midrasch, den du vorbringst (doresch) und der einen vorherigen Midrasch zerbricht, ist kein Midrasch.
Hier fungiert Midrasch, in einer Auslegung von Lev 25,6–7, im Kontext von Bestimmungen zu erlaubten und verbotenen Nutzungen von Produkten im Sabbatjahr, die sich auf einen hermeneutischen Schluss, eine Einschließung bzw. Ausschließung, stützen (vgl. dazu unter Hermeneutische Regeln). Widersprüchliche Anwendungen in Bezug auf eine Bibelstelle werden ausgeschlossen. Wenn eine Bibelstelle bereits für eine Argumentation verwendet wurde, kann sie nicht mehr für eine andere Argumentation dienen.
In jMegilla 1,12(9),72a; jJoma 3,5,40c; jJevamot 6,4 (3),7c gibt es den Grundsatz: kol midrasch [u-midrasch] beinjano („Jede Auslegung in ihrem Kontextjede Auslegung in ihrem Kontext“), wodurch die Widersprüchlichkeit von Auslegungen (unter der Verwendung von hermeneutischen Regeln) dadurch aufgelöst wird, dass man jede bezogen auf ihren jeweiligen (biblischen) Zusammenhang (injan) verstehen muss.
Midrasch wird mehr und mehr als Auslegung von TextAuslegung von Text verstanden. So etwa, wenn es in jMegilla 1,1,70a zum Buch Ester heißt:
„All das legte er dar in einer Schrift [aus der Hand JHWHs über mir, ließ verstehen alle Arbeiten, die der Plan vorsah]“ (1Chr 28,19) – das ist die Masora (der Konsonantentext); „aus der Hand JHWHs“ – das ist der Heilige Geist; „über mir, ließ es verstehen“ – von daher ergibt sich, dass sie zur Auslegung (lehiddaresch) gegeben wurde.
Dort wird auch klar gelegt, dass das Buch Ester bzw. die Esterrolle eine der Tora entsprechende Bedeutung hat und wie diese selbst der Auslegung bedarf.
Als Lerninhalt tritt Midrasch häufig aufAls Lerninhalt tritt Midrasch häufig auf. Wie bereits erwähnt, enthält die Liste von Studieninhalten in mNedarim 4.3 Midrasch, Halachot und Haggadot. Midrasch ist hier also von Haggada und Halacha getrennt zu lernen. In tBerachot 2.12 werden – im Zusammenhang mit Fragen zur rituellen Reinheit – auch die Frauen ins Studium integriert, wenn es heißt:
|31|Männer und Frauen, die an Ausflüssen im Genitalbereich leiden, Menstruierende und Wöchnerinnen dürfen Tora, Propheten und Schriften lesen, Mischna, Midrasch, Halachot und Haggadot lernen.
Im babylonischen Talmud (i.F. Bavli) schränkt man in bBerachot 22a allerdings diese großzügige Regelung wieder auf Männer ein.
Eine gewisse Lernabfolge kann man z.B. aus jPea 2,6,17a erheben, wo es heißt, dass „Schrift, Mischna, Talmud und Haggada und auch das, was ein kundiger Schüler einmal vor seinem Lehrer entscheiden wird, bereits am Sinai Moses gesagt wurde.“ Allerdings wird im Alltag nicht unbedingt nach dieser Abfolge unterrichtet. In TanB Lech lecha 10 (34b) heißt es über R. Jochanan:
Seine Schüler saßen vor ihm im (Auslegungs-)Kapitel (vertieft). Als sie mit ihrem Kapitel fertig waren, lehrte er sie eine Haggada und danach Mischna.
In bTaʿanit 30a ist davon die Rede, dass man am 9. Av, dem Trauertag über die Zerstörung des Tempels, weder Tora, Propheten und Schriften liest noch Mischna, Midrasch und Talmud, Haggadot und Halachot studiert.
Aussagekräftig ist auch bQidduschin 49a. Darin wird die Selbsteinschätzung eines EhemannesSelbsteinschätzung eines Ehemannes in spe gegenüber seiner künftigen Braut thematisiert. Wenn er behauptet, imstande zu sein, die Bibel lesen zu können, so lässt man ihn drei Verse vortragen und übersetzen, damit er sich verloben kann. Behauptet er von sich, ein Schriftkundiger zu sein, so muss er aus allen drei Teilen der Bibel (Tora, Propheten, Weisheitsschriften) genau vortragen. Hat er sich gar als Gelehrter vorgestellt, argumentieren die Rabbinen dazu keineswegs einheitlich:
Chisqija sagte: (dies meint Kenntnisse bzw. Lernstoff der) Halachot; aber R. Jochanan sagte: Tora. Man wandte ein: Was ist Mischna? R. Meir sagt: Halachot, aber R. Jehuda sagt: Midrasch. Was ist Tora? Midrasch Tora (Auslegung der Tora). Dies gilt (unter der Voraussetzung,) dass er zu ihr sagte: Ich lerne. Sagte er aber: Ich bin ein Gelehrter (tanna), so muss er Halacha, Sifra und Sifre und Tosefta studiert haben.
Midrasch wird von Jochanan allgemein als Lehre (Mischna) verstanden, demgegenüber Meir diese auf die gesetzlichen Teile (Halachot) einschränken will. In der Regel folgt die Mischna als Lernstoff nach der Bibel, die man im Grundstudium erlernen soll. Andererseits versteht man Midrasch als Auslegung von Tora. Der Schlusssatz konkretisiert diese auf die Exegese von Lev (Sifra) und Num/Dtn (Sifre).
Avot de-Rabbi Natan A 28.17–19 vergleicht den Studierenden mit Steinen. Ein behauener SteinEin behauener Stein ist jemand, der nur Midrasch lernt, ein Eckstein einer, der Midrasch und Halacha lernt, ein polierter Stein aber ist schließlich jemand, der Midrasch, Halacha, Haggada |32|und Tosefta beherrscht, also über ein umfassendes Wissen in verschiedenen Bereichen verfügt. Etwas später (A 29.26) heißt es, dass einer, der Midrasch, aber keine Halacha beherrscht, nur schwach „bewaffnet“ ist. Wer aber beides besitzt, ist stark „bewaffnet“.
Im Seder Elijahu Rabba ist das CurriculumCurriculum mehrteilig und umfasst Mischna, Midrasch, Halachot und Talmud und Aggadot (15, Friedmann 69); Mischna, Midrasch, Halachot und Aggadot (18, Friedmann 91) bzw. Midrasch, Halachot und Aggadot und den Dienst an den Gelehrten (28, Friedmann 155).
Die Bedeutung des rabbinischen Verständnisses von darasch ist nicht zuletzt auch von seinem „Sitz im Leben“ abhängig. Unter Derascha wird oft eine Predigt oder eine synagogale Schriftauslegung verstanden. Diese Bedeutung ist für das Mittelalter zutreffend, doch zeigt sich, dass eine frühe Verankerung der DeraschaDerascha im Kontext der synagogalen Liturgie problematisch ist. In mehreren Studien (vgl. z.B. Porton, Sermon) konnte inzwischen plausibel gemacht werden, dass Rabbinen in früher Zeit nur sehr bedingt am Synagogenleben teilgenommen haben dürften und kein bedeutender Anteil an der liturgischen Gestaltung von ihnen ausgeht. Viel eher ist wahrscheinlich, dass die Rabbinen ihre Auslegung eines Bibeltextes im Rahmen eines Lehrvortrages hielten. Der Begriff darasch verweist hier nicht auf eine Predigt, sondern eine Interpretation, eine Auslegung von bestimmten Schriftstellen.