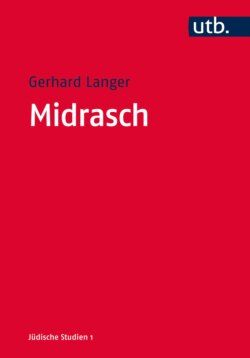Читать книгу Midrasch - Gerhard Langer - Страница 6
2. Die neueren Entwicklungen
ОглавлениеDie Erforschung von Midrasch ist seit ungefähr 1970 durch Interdisziplinäre Methodologieninterdisziplinäre Methodologien und Fragestellungen charakterisiert, die das Verhältnis zwischen Text und Intertexten und soziohistorischen oder kulturellen Kontexten untersuchen. Pionierarbeit leistete in diese Richtung Jacob Neusner. In Development of a Legend trägt er die Traditionen von einer und über eine „Gründungsfigur“ der rabbinischen Bewegung, Jochanan ben Zakkai, in tannaitischen und amoräischen Quellen – d.h. nicht nur Midrasch-Kompilationen – zusammen und analysiert diese nach Kategorien, die der talmudischen Literatur eigen sind. Midrasch wird jetzt weniger als geschichtliche Quelle gelesen; die Untersuchung der rabbinischen Korpora oder Dokumente könne, so Neusner, höchstens zu einer approximativen Beschreibung der Weltanschauung, der Ideologie, der Mentalität der Rabbinen beitragen. Allerdings mehren sich in jüngerer Zeit erneut Ansätze, die rabbinischen Äußerungen wieder enger an die Personen zu binden und als authentisch zu betrachten.
Die literaturtheoretische Reflexion der 1970er und 1980er Jahre, kollektiv als New CriticismNew Criticism bezeichnet, übte großen Einfluss auf die Erforschung der rabbinischen Literatur in Amerika, Europa und Israel aus. Bei diesem textimmanenten Zugang zu Midrasch wird die rabbinische Literatur nicht (mehr) auf ihre historischen Kontexte und Entstehungsbedingungen befragt. Historische Fakten aus diesen Texten zu gewinnen verliert an Relevanz, sobald man anfängt, sie als didaktische Fiktionen zu betrachten, die bestenfalls Informationen über die Situation der rabbinischen Erzähler hergeben können. Ein wichtiges Beispiel dieser Übernahme von Methodologien anderer Disziplinen ist der Sammelband, den Hartman und Budick mit dem Titel Midrash and LiteratureMidrash and Literature 1986 herausgaben. Hier wird auf die Vorgeschichte des Midrasch in der innerbiblischen Exegese (vgl. die Beiträge von Geoffrey Hartman und Michael Fishbane) sowie auf das Weiterleben der Formen und Themen der rabbinischen Exegese in der Literatur der Neuzeit und in der Gegenwart verwiesen. Vier zentrale Aufsätze – von Joseph Heinemann, Judah Goldin, James Kugel und David Stern – befassen sich mit Midraschim der klassischen Periode. Etliche ähnliche kollektive Unternehmungen sind seitdem erschienen, darunter The Midrashic ImaginationThe Midrashic Imagination, eine Festschrift für Yonah Fraenkel mit |3|älteren Beiträgen, die hauptsächlich von israelischen Forschern stammen.
Der Gedanke, dass Midrasch nicht auf die rabbinische Periode zu beschränken ist, steht im Zentrum von Susan Handelmans Monografie The Slayers of Moses. Es handelt sich dabei um eine Geschichte der Hermeneutik von den griechischen Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, die die hermeneutischen Prinzipien des klassischen Midrasch als immer da gewesene darstellt. Diese interpretiert Handelman als wirkungsvolle Herausforderung der griechisch-christlichen hermeneutischen Traditionen, insbesondere in den philosophischen und literaturkritischen Arbeiten jüdischer post-moderner Denker wie Jacques Derrida und Harold Bloom.
Daniel Boyarins Grundlagenwerk Intertextuality and the Reading of MidrashIntertextuality and the Reading of Midrash gehört zu dieser Phase der textimmanenten Lektüre von Midrasch als Literatur. Anhand einer Reihe von intensiven Analysen ausgewählter Passagen aus der Mechilta illustriert Boyarin die intertextuelle Arbeit des Midrasch, ihre charakteristischen Formen – die Verwendung von Belegversen aus anderen Büchern der Bibel bzw. aus anderen Teilen des Kanons, die Polyphonie der Meinungen der Rabbinen in Bezug auf einen unklaren Vers, die Erzählung von Meschalim/Gleichnissen als explizite Auslegung.
David Sterns Studie Midrash and TheoryMidrash and Theory widmet sich in einer Reihe von Essays der Verbindung von Midrasch und modernen Literaturtheorien, um zu eruieren, wie diese ein geeignetes Instrumentarium für die Lektüre von Midrasch bieten, die nach zentralen Aspekten wie der inhärenten Polysemie des Bibeltextes, den literarischen Formen, welche die Midrasch-Hermeneutik verwendet, dem Wesen einer Midrasch-Gattung u.a. fragt.
Die europäische Midrasch-Forschung ist durch die Arbeiten von Arnold GoldbergArnold Goldberg geprägt. Die von ihm vorgeschlagene exegetische Terminologie (citem, questem u.a.) hat sich jedoch nur begrenzt durchgesetzt. Er und seine Schülerinnen und Schüler in der so genannten Frankfurter Schule analysieren Midrasch-Werke zwar als Literatur, aber mit einem streng synchronen und strukturalistischen Ansatz, der formanalytischen Methode. Dabei werden die literarischen Formen und ihre Funktionen innerhalb des unmittelbaren Kontexts beschrieben. In zahlreichen Aufsätzen befasste sich Goldberg mit den Formen der so genannten homiletischen Midraschim (vgl. Gesammelte Schriften II). Lieve Teugels verwendet die formanalytische Methode u.a. in ihrer Studie der Midrasch-Traditionen zu Gen 24.
Goldbergs Formanalyse wurde von Philip S. Alexander um die Frage nach der Midrasch-Methode, d.h. dessen Hermeneutik und Schriftverständnis, erweitert. Auch in Alexander SamelyAlexander Samelys Untersuchung |4|der Funktion von Midrasch in der Mischna wirkt Goldberg weiter. Nicht nur mit kleineren Einheiten, sondern mit den meisten strukturell relevanten literarischen Merkmalen der antiken jüdischen Literatur, inklusive Midrasch, befasste sich ein an den Universitäten von Manchester und Durham abgeschlossenes Forschungsprojekt, an dem Alexander und Samely beteiligt waren (Samely, Profiling).
Midrasch als LiteraturMidrasch als Literatur fasste in dieser Zeit nicht nur in Amerika und Europa, sondern auch in Israel Fuß. Wichtige Beispiele dafür stellen die Beiträge des Erzählforschers Dov NoyDov Noy sowie die literarhistorisch ausgerichteten Arbeiten von Joseph HeinemannJoseph Heinemann und Yonah FraenkelYonah Fraenkel dar. Unbedingt zu erwähnen sind auch die Arbeiten von Joshua LevinsonJoshua Levinson. Yonah Fraenkels Darche ha-Aggada we-hamidrasch, nicht zu verwechseln mit der grundlegenden Arbeit von Isaak Heinemann, Darche ha-Aggada, klassifiziert und beschreibt Inhalt, Formen und hermeneutische Techniken von midraschischen und haggadischen Quellen aus der klassischen Periode, d.h. vom 1. Jh. v.Z. bis ins 6. Jh. n.Z. Diese Literatur, die als Produkt der rabbinischen Akademie (bet ha-midrasch) entstanden sein soll, die von Rabbinen für ihre Schüler konzipiert wurde, wird Fraenkels literaturwissenschaftlicher Analyse unterzogen. Fraenkel plädiert für eine Lektüre der rabbinischen Erzählungen, die ausschließlich auf deren Ästhetik fokussiert: Rabbinische Erzählungen sollen als kurze und geschlossene Kunstwerke angesehen werden, nicht als Darstellungen von Institutionen oder Praktiken. Fraenkel vergleicht Midrasch mit Spiel: wie im Spiel handelt Midrasch von Welten, die parallel zur und ähnlich der realen Welt existieren, in denen aber eigene Regeln herrschen, die in der realen Welt nicht gelten. In Bezug auf die Funktion von Midrasch beobachtet Fraenkel, dass es weniger auf Exegese als auf die Vermittlung von theologischen oder ethischen Konzepten ankomme.
Zwei Monografien haben sich eingehend mit einer Gattung, die in der Spannung zwischen Interpretation und Erzählung besteht, befasst: der exegetischen Erzählung. Ofra Meirs The Exegetical NarrativeThe Exegetical Narrative und Joshua Levinsons The Twice-Told TaleThe Twice-Told Tale. Letzterer bedient sich eines veritablen literatur- und kulturwissenschaftlichen theoretischen Arsenals, das Erzählforschung, klassische Narratologie, biblische Erzähltheorie, Strukturalismus, New Historicism und Marxismus, Reader Response-Theorien, die Studien zur Folklore und wichtige Arbeiten zu den biblischen Erzählungen umfasst. Die exegetische Erzählung ist nach Levinson durch die intensive Begegnung zwischen dem biblischen Text und der rabbinischen Kultur bestimmt und hilft sowohl die im Schrifttext eruierten Probleme als auch jene der aktuellen kulturellen Entwicklung in der rabbinischen |5|Welt zu lösen. Im Kern entspricht dies der von Foucault in der Ordnung des Diskurses formulierten These zum Thema Kommentar:
Aber andererseits hat der Kommentar, welche Methoden er auch anwenden mag, nur die Aufgabe, das schließlich zu sagen, was dort schon verschwiegen artikuliert war. Er muß (einem Paradox gehorchend, das er immer verschiebt, aber dem er niemals entrinnt) zum ersten Mal sagen, was doch schon gesagt worden ist, und muß unablässig das wiederholen, was eigentlich niemals gesagt worden ist. Das unendliche Gewimmel der Kommentare ist vom Traum einer maskierten Wiederholung durchdrungen: an einem Horizont steht vielleicht nur das, was an seinem Ausgangspunkt stand – das bloße Rezitieren. Der Kommentar bannt den Zufall des Diskurses, indem er ihm gewisse Zugeständnisse macht: er erlaubt zwar, etwas anderes als den Text selbst zu sagen, aber unter der Voraussetzung, daß der Text selbst gesagt und in gewisser Weise vollendet wurde. (S. 19–20)
Neu und alt werden verbunden. Der Kommentar gewinnt seine Bedeutung gerade durch seine Verbindung zum autoritativen Text. Nicht zufällig nannte Levinson sein Buch im Hebräischen ha-sippur sche-lo suppar, die „nicht erzählte Geschichte“, was an Foucaults „was eigentlich niemals gesagt worden ist“ erinnern soll. Levinsons Studien zeigen ein Doppeltes. Zum einen sind sie ein Plädoyer für eine Sicht auf rabbinische Texte im Kontext literaturwissenschaftlicher Theorien, um die komplexen Aspekte des Zusammenspiels von biblischem Text und rabbinischer Erzählung zu begreifen; zum anderen erwächst daraus kein Widerspruch zu einer Betrachtung der rabbinischen Erzählung als Ausdruck der konkreten Lebenswelt der Rabbinen, ihrer Probleme und historischen Bedingungen.
Als Gegenbewegung zum New Criticism entwickelten sich in der neueren Midrasch-Forschung Tendenzen, die dem New HistoricismNew Historicism verwandt sind. In diesem Zusammenhang werden Midrasch-Texte als Teil größerer soziokultureller Diskurse oder Praxissysteme erneut in einen historischen Kontext gesetzt, betrachtet und untersucht. Es lassen sich dabei thematische bzw. methodologische Schwerpunkte unterscheiden, wie einige ausgewählte Monografien oder Sammelbände illustrieren, auf die im Folgenden eingegangen wird. So bietet Jeffrey Rubenstein in seinen Talmudic StoriesTalmudic Stories nicht nur genaueste close readings von sechs talmudischen Erzählungen, sondern auch Überlegungen zur Kultur, die sie hervorbrachte. Eine dieser Erzählungen, bAvoda Zara 2a–3b, die er als homiletical story (in Ofra Meirs Terminologie „sippur darschani“) bezeichnet, ist eine literarische Form, die häufig in Midrasch-Kompilationen vorkommt.
Aus der volkskundlichen Erzählforschung stammen die Beiträge einiger Jerusalemer Wissenschaftler wie Dan Ben Amos, Eli Yassif, Dina Stein und Galit Hasan-Rokem. Letztere verwendet in Web of LifeWeb of |6|Life Kategorien der Erzählforschung für eine kulturwissenschaftlich und feministisch orientierte Lektüre von EkhR. In Tales of the NeighborhoodTales of the Neighborhood befasst sie sich mit rabbinischen Erzählungen, in denen kulturelle Nachbarschaft und literarische Nachbarinnen den Ausgangspunkt für Lektüren bilden, in denen es um die Konzeptualisierung von Alltag, Geschlecht, Grenzen, Identität, Körper u.a. geht.
Der feministische Zugang zu MidraschDer feministische Zugang zu Midrasch befasst sich mit der Darstellung und Konzeption der Frau im rabbinischen Korpus. Spezifische Themen dieser feministischen Lektüren umfassen so genannte „female-male plot structures“, Onomastik (vgl. Ilan, Silencing, Kap. 8), die frauenspezifische (inhärente) Alterität, den Diskurs über die Menstruation, den Körper der Frau (vgl. Fonrobert, Purity, S. 29–39), das Subversive, das Verhältnis der Frauen zur Macht, die Sexualität, die Familie, das Problem der Unfruchtbarkeit, die Genealogie u.a. Die Literatur zu diesen Fragen ist äußerst umfangreich. Es sei in diesem Rahmen nur auf eine Auswahl repräsentativer Publikationen hingewiesen. In Rereading the RabbisRereading the Rabbis geht Judith Hauptmann auf die wichtigsten Themen der rabbinischen Literatur ein, die Frauen als Protagonistinnen haben, u.a. den Sota-Prozess, den Ehevertrag/die Ketubba, die Regelungen in Bezug auf die Menstruation. Als Textgrundlage verwendet Hauptmann vor allem die Mischna und den babylonischen Talmud, vereinzelt aber auch halachische Midraschim. Judith Baskin fokussiert ihre Studie zur Konzeptualisierung der Frau in Midrashic WomenMidrashic Women auf haggadische Quellen aus Talmud und Midrasch.
Die Studien von Tal IlanTal Ilan zeigen, wie man u.a. aus rabbinischen Quellen historische Informationen zu einzelnen Frauenfiguren (wie der Frau von Rabbi Aqiva oder der Königin Schlomtzion/Salome Alexandra) und ihren geschichtlichen Kontexten sowie zu den Rollen der Frauen in der sozio-ökonomischen, politischen, intellektuellen und religiösen Geschichte des Zweiten Tempels und der rabbinischen Periode gewinnen kann, um eine Geschichte der Frauen zu schreiben. Was die verwerteten Midrasch-Quellen angeht, liegt Ilans Fokus auf halachischen Dokumenten, obwohl haggadische Quellen in Midraschim nicht ausgeschlossen werden. In Mine and Yours: Retrieving Women’s History from Rabbinic Literature (Kap. 4 und 5) handelt sie über die Kontexte, in denen Frauen in halachischen Midraschim konstruiert werden, sowie über die spezifische Sprache, die verwendet wird, um Rollen und Funktionen der Frauen auszudrücken. Interessant ist die Erkenntnis Ilans, dass Namen, die midraschisch ausgelegt werden, ein Hinweis dafür seien, dass die Namen erfunden sind. Kapitel 5 von Silencing the Queen zeigt die Verfahren, mit denen Frauen u.a. in halachischen |7|Midraschim zum Schweigen gebracht bzw. diskreditiert werden.
Naomi GraetzNaomi Graetz ist Autorin von zwei feministischen Monografien zu Midrasch-Quellen. Im Zentrum von Unlocking the Garden (vgl. in diesem Buch Kap. XIII.7) stehen Figuren als Metonymien für soziokulturelle Institutionen (Patriarchat, Ehe, Unfruchtbarkeit). Mit S/he created them: feminist retellings of Biblical stories liefert Graetz ein Beispiel von „zeitgenössischem Midrasch“, indem sie biblische Erzählungen mit einer weiblichen Stimme ergänzt und neu erzählt.
Die textuelle Konstruktion von Sexualität bildet einen weiteren Schwerpunkt der kulturpoetologischen Studien zu Midrasch und zur rabbinischen Literatur im Allgemeinen, wobei der Babylonische Talmud die erste Textgrundlage darstellt. Einige wichtige Beispiele umfassen zwei Werke von Daniel Boyarin – Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture und Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man – sowie Michael Satlows Tasting the Dish: Rabbinic Rhetorics of Sexuality, das vor allem tannaitische Midraschim und Talmudim behandelt. Gwyn Kessler veröffentlichte 2009 eine Monografie zur haggadischen Embryologie, in der sie Erzählungen über den Fötus in Midrasch-Kompilationen auswertet.
Aktuelle Studien sind nicht zuletzt komparatistisch ausgerichtetAktuelle Studien sind nicht zuletzt komparatistisch ausgerichtet, wobei rabbinische Auslegungspraktiken und -tendenzen im größeren Kontext (Judentum, Christentum und Islam) betrachtet und die Möglichkeit einer kulturellen Wechselwirkung analysiert werden (vgl. u.a. Visotzky, Midrash, Christian Exegesis and Hellenistic Hermeneutic und Stern, Ancient Jewish Interpretation of the Song of Songs in Comparative Context; Hirshman, Rivalry).
Jüngere Aufsätze, Monografien und Sammelbände wie die von Shaye Cohen (u.a. Beginnings, z.B. S. 293–298), Philip Alexander (Quid Athenis), Catherine Hezser (Rabbinic Law; Interfaces; Chrie), Lee I. Levine (Judaism and Hellenism), Pieter van der Horst (Hellenism), John Collins und Gregory Sterling (Hellenism) oder Carol Bakhos (Ancient Judaism) haben neuere Erkenntnisse in Bezug auf Hermeneutik und RechtHermeneutik und Recht in der rabbinischen Literatur im Rahmen der griechisch-römischen Welt erbracht.
Eine Reihe von Arbeiten von Daniel BoyarinDaniel Boyarin hat die Diskussion massiv angeregt, inwieweit rabbinische Literatur durch das aufkommende Christentum beeinflusst sei bzw. darauf reagiere. Dazu gehören Thesen wie die einer Grauzone zwischen jüdischen und christlichen Gruppen in den ersten Jahrhunderten (Jewish Gospels; Borderlines/Abgrenzungen), von der Beeinflussung jüdischer Martyriumsvorstellungen durch christliche Märtyrertexte (Dying for |8|God), von der schrittweisen Herausbildung einer jüdischen Orthodoxie als Reaktion auf die christliche etc. Für Boyarin findet eine entscheidende Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum in der Behandlung des Themas der göttlichen Einheit oder Zweiheit (Binitarianismus; vgl. dazu auch die Arbeit von Segal, Two Powers) statt. Die Rabbinen reagierten auf die Logostheologie, die vor allem in den Targumim begegnende Rede von der Memra (personifiziertes Wort Gottes) und die Engelverehrung und damit auf die theologische Bedeutung von Jesus als Heilsbringer in göttlicher Position. Boyarins Thesen radikalisieren sich zusehends, wenn er viele Entwicklungen des rabbinischen Judentums fast ausschließlich als Antwort auf das Christentum betrachtet. Die jüdische Rede von der Minut (Apostasie) ist dann Ergebnis der christlichen Häresiedebatte, die Erzählungen von der Gründung Javnes als neues rabbinisches Zentrum nach der Tempelzerstörung entsprächen einer Reaktion auf die Beschreibung der mit dem Konzil von Nicäa verbundenen christlichen Selbstdefinition durch den Kirchenvater Athanasius. Neben Boyarin ist hier auch Seth SchwartzSeth Schwartz zu erwähnen, der ebenfalls von christlichem Einfluss auf die Entwicklung des rabbinischen Judentums ausgeht (Imperialism; Culture). David Halperin (Origen and Seder Eliyahu) sieht Einflüsse des Origenes vor allem auf das Textkorpus von Seder Elijahu.
Mitunter auch in kritischer Distanz zu Daniel Boyarin hat vor allem Peter SchäferPeter Schäfer (u.a. Jewish Jesus) in jüngerer Zeit anhand einiger Beispiele illustriert, dass und wie rabbinische Texte als Reaktion auf die christliche Herausforderung gelesen werden können.
Erwähnt werden soll hier auch der Sammelband von Lieve Teugels und Rivka UlmerLieve Teugels und Rivka Ulmer (Midrash and Context). Er enthält Beiträge zum hellenistischen und christlichen Kontext des rabbinischen Midrasch, darunter von Matthew Kraus (zur Vulgata), von Joshua Moss (zur Bedeutung des Tempels) oder von Annette Yoshiko Reed (zum Vergleich von BerR und Augustinus).
Vergleichende StudienVergleichende Studien existieren z.B. zu den rabbinischen und neutestamentlichen Gleichnissen (Dschulnigg), zu Halacha bzw. Midrasch bei Paulus (Tomson, Halakha; Grohmann, Aneignung, S. 169–187), zu rabbinischen und neutestamentlichen Auslegungsmethoden (vgl. schon Bonsirvens Studie zu Paulus und der rabbinischen Exegese); David Wenkel untersucht die Bezüge von gezera schawa und dem Hebräerbrief. Informativ ist die umfassende Sammlung und Analyse von Robert PriceRobert Price (New Testament), die sich allerdings auf Evangelien und Apostelgeschichte beschränkt.
Zu den Bezügen zwischen den Rabbinen und den Kirchenvätern sind nicht zuletzt die Studien von Philip S. AlexanderPhilip S. Alexander (Intertexts), Burton VisotzkyBurton Visotzky (Fathers of the World; Jots and Tittles), Judith |9|Baskin (Contacts), Adam KamesarAdam Kamesar (Church Fathers) und Annette Yoshiko Reed (Reading Augustine) zu nennen. Informativ ist die kleine Monografie von Marc HirshmanMarc Hirshman (Rivalry). Darin widmet er sich den Kirchenvätern in Palästina zwischen dem 3. und 5. Jh. im Vergleich mit rabbinischen Texten dieser Ära. Er analysiert Texte von Justin, Origenes und Hieronymus, stellt vorsichtige Vermutungen über mögliche Kenntnisse der jeweilig anderen Überlieferungen an und reflektiert über Polemik, aber auch über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Midrasch und antiker Rhetorik.
Eine andere Form des „Vergleichs“ wird in den Untersuchungen Steven FraadeSteven Fraades deutlich. Er betreibt „comparative Midrash“, um Spezifika der verschiedenen exegetischen Gattungen der jüdischen Gemeinden der Antike zu beschreiben. Weitere Werke dieser Richtung umfassen James Kugels In Potiphar’s House – wo die Motive der narrativen Erweiterung biblischer Erzählungen in exegetischer Literatur, aber auch im Koran oder der Kunst, untersucht werden – und The Bible as it was u.a. Für eine vergleichende, allerdings innerrabbinische und auf die Dokumente ausgerichtete Midrasch-Lektüre plädiert Jacob Neusner, der einige Bände zu diesem Thema vorlegte.
Das Thema der mündlichen ÜberlieferungThema der mündlichen Überlieferung und die Performanz-Frage stehen im Zentrum einiger Beiträge zu Midrasch (u.a. Martin Jaffee, Torah in the Mouth; Steven Fraade, From Tradition to Commentary; vgl. auch Goldberg, Sprechakt, und Nelson, Orality).
Oft befasst sich die Forschung mit einzelnen Midrasch-KompilationenMidrasch-Kompilationen, wie sie etwa BerR oder EkhR darstellen. Umfassend sind die Untersuchungen zu PesR (seltener zu PesK), in Bezug auf Werke der gaonäischen Periode (z.B. Tanchuma) nicht zuletzt zu PRE.
ARN, gewissermaßen ein Midrasch zum Mishnatraktat Avot, bildet die Textgrundlage für einige Beiträge zum Thema Ethik im rabbinischen Judentum, wie Jonathan Wyn Schofers Buch The Making of a Sage.
Bedeutsam sind Neubewertungen von klassischen MidraschimNeubewertungen von klassischen Midraschim, so Visotzkys Untersuchung zu WaR, die diesen Midrasch als faszinierendes Sammelwerk zeigt, das als Zeichen einer fundamentalen Änderung in der jüdischen Frömmigkeit gelesen werden kann, die in einer Distanzierung von den Themen um den Tempelkult und einer konsequenten „Rabbinisierung“ des Buches Levitikus besteht. Die Monografie befasst sich mit der Struktur des Werkes, der thematischen Einheit der 37 Kapitel, mit einzelnen sprachlichen Aspekten sowie mit der vermittelten Anthropologie und Theologie.
Die Hermeneutik der halachischen Midraschim der Schule JischmaelsSchule Jischmaels, Mechilta und SifBem, wird von Azzan Yadin in seinem Buch Scripture as LogosScripture as Logos untersucht. Yadin arbeitet äußerst textimmanent und erlaubt sich Kritik am Dialog zwischen Midrasch |10|und literaturwissenschaftlicher Theorie, wie dieser von Handelman oder Hartman/Budick vertreten wird. Ein wichtiges Anliegen Yadins ist zu zeigen, wie die halachischen Midraschim der Schule Jischmaels die Freiheit der Lesenden steuern bzw. in Grenzen halten. 2014 folgte mit Scripture and Tradition. Rabbi Akiva and the Triumph of Midrash eine vergleichbare Studie zu Sifra.
Unter den Subgattungen des Midrasch, die als Mikroformen oder literarische Formen bezeichnet werden können, nimmt das Gleichnis (Maschal)Gleichnis (Maschal) einen besonderen Platz in der Forschung ein (vgl. die Arbeiten von Stern). Das mehrbändige Projekt von Thoma/Lauer/Ernst, Die Gleichnisse der Rabbinen bietet Übersetzung und Klassifikation von Gleichnissen in exegetischen und homiletischen Midrasch-Kompilationen. Alan Appelbaum (King-Parable) widmet sich dem Maschal im 3. Jh., wobei er bei der Frage nach einer antirömischen bzw. antikaiserlichen Tendenz u.a. auf postkoloniale Studien verweist.
Jüngere Arbeiten beschäftigen sich auch wieder intensiver mit der Form der Peticha (Proömium)Peticha (Proömium) und den so genannten homiletischen Midraschim (vgl. Kap. VII.3).