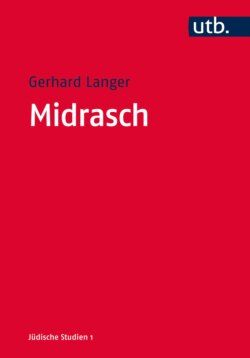Читать книгу Midrasch - Gerhard Langer - Страница 22
7. Hermeneutische Regeln
ОглавлениеEs ist wichtig zu betonen, dass rabbinische und damit auch midraschische Hermeneutik sich nicht in der Anwendung von hermeneutischen Regeln erschöpft. Was aber versteht man darunter? In tSanhedrin 7.11; Avot de-Rabbi Natan A 37.18 und – in einer anderen Version – zu Beginn von Sifra werden 7 Middot Hillelssieben Regeln (Middot) Hillel zugesprochen. Die so genannten 13 Regeln des R. Jischmael13 Regeln des R. Jischmael, die eigentlich 16 Regeln darstellen, sind mit großer Wahrscheinlichkeit in amoräischer Zeit zusammengestellt und im 10. Jh. dem Midrasch Sifra vorangestellt worden, wohl als Argument gegen die Karäer (vgl. Porton, Methods). 32 Regeln des R. Eliezer ben Jose ha-Gelili sind aus der Mischnat R. Eliezer bekannt und begegnen im MHG Gen, sind im Sefer Keritut von Simson von Chinon (1260–1330) erwähnt und zitiert durch den Grammatiker Abulwalid Ibn Ganach aus dem 11. Jh. Enelow hat 1933 eine bis heute zitierte Textausgabe veröffentlicht. Eine ausführliche Beschreibung der Regeln findet sich in der Einleitung von Stemberger (S. 26–42) sowie bei Porton (Methods; Hermeneutics) und Ulmer (Hermeneutics), weshalb hier darauf verzichtet werden kann. Erwähnt seien der qal wa-chomer (Schluss vom Leichteren auf das Schwerere – a fortiori) = 1. Regel Hillels und Jischmaels, die gezera schawa (Analogieschluss) = 2. Regel Hillels und Jischmaels; diesem verwandt ist die 6. Regel Hillels: ke-jotze bo be-maqom acher (eine Schlussfolgerung aus einer anderen Stelle); der binjan av mi-katuv echad (inhaltlich zusammengehörige Textstellen erhalten durch eine in einem einzelnen Belegvers befindliche Zusatzinformation Näherbestimmung) = 3. Regel Hillels und Jischmaels; der binjan av mi-schne ketuvim (die |73|gleiche Regel basiert auf zwei Belegversen) = 4. Regel Hillels und Jischmaels; kelal u-ferat u-ferat u-kelal (Näherbestimmung des Allgemeinen durch das Spezifische und umgekehrt) = 5. Regel des Hillel und in einer komplexen Aufsplitterung und Näherdefinition in den Regeln Jischmaels 5–11 (nach Portons Zählung 5–14); davar ha-lammed me-injano (der Schluss aus dem Kontext) = 7. Regel Hillels und 12. (15.) Regel Jischmaels. Jischmaels 13. (16.) Regel postuliert die Auflösung von Widersprüchen zweier Belegverse durch einen dritten.
Im Hinblick auf die hermeneutischen Regeln hat Daube für die sieben Middot Hillels, vor allem für gezera schawa oder ke-jotze bo be-maqom acher Wurzeln und Parallelen in der griechischen RhetorikWurzeln und Parallelen in der griechischen Rhetorik eruiert (mit den Stichworten synkrisis pro ison und symbainein). Visotzky verwendet das Beispiel der synkrisis aus dem Lehrbuch für Rhetorikvorübungen (Progymnasmata) des Rhetorikers Theon für die Erläuterung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zum qal wa-chomer-Schluss (Midrash, Christian Exegesis, S. 122).
Ergänzend dazu finden sich in den 32 Middot Eliezers32 Middot Eliezers u.a. die bereits am Beispiel des Gesprächs von R. Aqiva und Jischmael erläuterten Middot Ribbui (Einschließung) und Miut (Einschränkung, Ausschließung) als differenziert und häufig verwendete Regeln, in denen bestimmte Begriffe wie gam (auch), die Akkusativpartikel et oder raq (nur), min (aus) zur Auslegung verwendet werden. Wichtig ist, dass auch der Maschal als Midda angesehen wird, allerdings hier nicht im Sinne eines Gleichnisses, sondern eher als Allegorie verstanden; ebenso die Ausdeutung homonymer Wurzeln (Paronomasie); die Gematria (Berechnung des Zahlenwerts) und das Notarikon, wo Worte in Bestandteile zerlegt werden. Die 31. Regel bezieht sich auf Angaben in der Schrift, deren Reihenfolge als verkehrt erlebt wird, was ausgelegt werden muss. Die 32. wiederum thematisiert die mitunter als falsch erlebte zeitliche Abfolge von benachbarten Bibelversen.