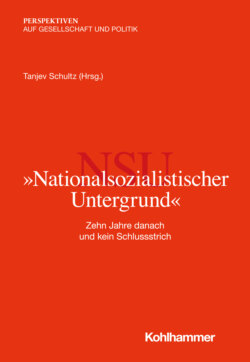Читать книгу "Nationalsozialistischer Untergrund" - Группа авторов - Страница 9
1991 bis 2021: »Generation Hoyerswerda«
ОглавлениеSo gibt es mittlerweile dutzende traurige und beschämende Jahrestage und vermeintliche Zäsuren, die mit den Taten rechter Terroristen verbunden sind. Es ist zehn Jahre her, dass der NSU entdeckt wurde – die Geschichte aus Hass und Gewalt ließe sich aber auch von anderen Daten her aufrollen. Statt zehn Jahre ließe sich zum Beispiel 30 Jahre zurückgehen, ins Jahr 1991: In Hoyerswerda tobte damals ein rassistischer Mob und bedrohte eine Flüchtlingsunterkunft und ein Wohnheim für sogenannte Vertragsarbeiter. Es war der Auftakt zu einer langen Serie rechtsextremer Anschläge, von denen die Angriffe in Rostock-Lichtenhagen (1992) und die Morde in Mölln (1992) und Solingen (1993) zu den bekanntesten gehören. Die späteren NSU-Terroristen wurden in dieser Zeit des Vereinigungsrassismus nach dem Fall der Mauer politisch sozialisiert. Sie und ihre Freunde zogen Springerstiefel an, verschickten Drohschreiben und Briefbomben-Attrappen. Mundlos und Böhnhardt marschierten 1996 in einer SA-Uniform über die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers in Buchenwald. Schon früh zeigte sich der Fanatismus dieser Neonazis aus Jena, die sich als Teil einer immer stärker werdenden Bewegung betrachten, an deren Spitze sie sich setzen wollten.
Man kann im Datum auch zwanzig Jahre zurückgehen: Im Jahr 2001, zehn Jahre nach den Ausschreitungen von Hoyerswerda, begingen die NSU-Terroristen gleich drei Morde. Sie fuhren dafür in den Süden und den Norden des Landes und schlugen in Nürnberg, Hamburg und München zu. Und sie arbeiteten bereits an einem Vorläufer des Paulchen-Panther-Videos. In diesem frühen Film, den Zschäpe nicht verschickte, der aber auf den Überresten der Computer aus der ausgebrannten Wohnung gefunden wurde, dröhnt harter Rechtsrock zu blutigen Bildern. Es gehe ihnen um den »Erhalt der deutschen Nation«, verkündeten die Terroristen. Sie verwendeten auch den Slogan »Deutschland den Deutschen«.
Diese Sprache erinnert an die Debatten der Gegenwart, in denen selbsternannte Verteidiger des »Abendlandes« auftreten, vor einer angeblichen Islamisierung und Umvolkung der Deutschen warnen und an die Idee anknüpfen, die Nation würde, wenn die etablierten Parteien und Medien weiter am Ruder blieben, sich aufgeben und selbst abschaffen. Schon während des NSU-Prozesses, bei dem immer wieder Rechtsextremisten auf der Zuschauertribüne auftauchten, konnten Beobachter den Eindruck gewinnen, dass der rechte Terror noch lange nicht vorbei ist. Viele Zeugen aus der rechtsextremen Szene, die dort im Gericht auf der Tribüne oder auf dem Zeugenstuhl Platz genommen hatten, waren in einem ähnlichen Alter wie Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt. In der Wendezeit waren sie Jugendliche, als mittlerweile gesetzte Erwachsene wirkten sie nun abgeklärt, aber deshalb nicht unbedingt ungefährlich – ganz im Gegenteil.
Die erbitterten Auseinandersetzungen um die Migrationspolitik und die Aufnahme geflüchteter Menschen seit dem Jahr 2015 hat so manchen alternden Rechtsextremisten wieder auf die Straße gebracht. Manche von ihnen mögen sich noch an die Diskussionen ums Asylrecht in den frühen 1990er Jahren erinnern, als auch etablierte Medien mit Sprüchen wie »das Boot ist voll« die Stimmung prägten. Zschäpe und ihre Freunde waren aufgewachsen in einer Zeit, in der kaum ein Tag verging, an dem sich nicht irgendwo in Deutschland ein rechter Mob austobte. Wer in diesen Zeiten aufgewachsen war, konnte nun am 1. September 2018 bei einer großen rechten Demonstration in Chemnitz Seite an Seite mit AfD-Politikern und jüngeren Rechtsextremisten laufen – wenige Monate nach dem NSU-Urteil in München. In Chemnitz war auch Stephan Ernst mit dabei, der am 2. Juni 2019 in der Nähe von Kassel den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordete (vgl. Steinhagen 2021).
Dass sich mit Blick auf den sogenannten Trauermarsch von Chemnitz der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, gegen die Bundesregierung stellte und partout keine rassistischen »Hetzjagden« erkennen wollte, zeigte einmal mehr, dass in den Sicherheitsbehörden – sehr sachte ausgedrückt – ein Gespür für die Gefahren von rechts weiterhin fehlte. Dabei hätte die in Chemnitz sichtbare Militanz die Sicherheitsbehörden ebenso alarmieren müssen wie der Schulterschluss von alten und neuen Neonazis sowie den diversen Parteien und Gruppen aus dem rechtsextremen Spektrum. Maaßen verlor sein Amt – immerhin. Dass ausgerechnet er damit betraut war, nach dem Entdecken des NSU das Vertrauen der Menschen in den Verfassungsschutz zurückzugewinnen, erscheint nicht nur rückblickend wie ein schlechter Scherz.
Mittlerweile haben die Behörden, auch der Verfassungsschutz, ebenso wie die Politik einen etwas schärferen Blick, wenn es um rechtsradikale Umtriebe geht – so jedenfalls wirkte es zuletzt. Die AfD wird mittlerweile vielerorts vom Nachrichtendienst beobachtet, mehrere rechtsradikale Organisationen sind in den vergangenen Jahren verboten worden, dazu kamen etliche Razzien und Ermittlungsverfahren. Doch noch immer gibt es Berichte darüber, dass rechtsextreme Motive bei Straftaten ausgeblendet werden (siehe den Beitrag von Daimagüler). Eine tiefgreifende Reform der Sicherheitsbehörden ist nach dem Entdecken des NSU ausgeblieben, ihre Rolle und die nötigen Veränderungen müssen weiter diskutiert werden, vor allem mit Blick auf den Verfassungsschutz (siehe die Beiträge von Wehrhahn/Renner, Kramer sowie Grumke), aber auch mit Blick auf die Polizei und die Staatsanwaltschaften (siehe den Beitrag von Schultz, Fahnder ohne Kompass).
Vom Aufstieg der AfD, deren Mitglieder und Sympathisanten bis hinein in die Justiz und den Sicherheitsapparat reichen, fühlen sich viele Rechtsextremisten beflügelt. In den vergangenen Jahren ist es der Partei gelungen, nicht nur in den Bundestag, sondern in sämtliche Landesparlamente einzuziehen. Obwohl innere Konflikte und ein unklarer Kurs in der Corona-Pandemie die AfD zu schwächen schienen, erzielte sie im Juni 2021 bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen weiteren Erfolg: Mit 20,8 Prozent landete sie als zweitstärkste Fraktion hinter der CDU. Spätestens damit ist klar, dass die direkte Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten längst auch in den Parlamenten stattfindet.
Im Mai 2021 nannte Bundesinnenminister Horst Seehofer den Rechtsextremismus die »größte Bedrohung für die Sicherheit«. In früheren Jahren waren die Gefahren von rechts oft heruntergespielt worden. Nun sprach Seehofer – angesichts von Gewalttaten, aber auch der Hetze im Internet – von einer gesellschaftlichen »Verrohungstendenz«. Die Zahl offiziell registrierter rechtsextremistischer Straftaten – rund 24.000 im Jahr 2020 – habe seit der ersten Erfassung vor zwanzig Jahren einen neuen Höchststand erreicht. Die Aktivitäten militanter Neonazis und Rassisten haben sich spürbar intensiviert (vgl. Quent 2019) – und der NSU scheint einigen dabei als Blaupause zu dienen. So wurde in Chemnitz auch eine Terrorzelle ausgehoben: Die Gruppe »Revolution Chemnitz« soll den NSU als »Kindergarten-Vorschulgruppe« bezeichnet und seine Leute auf noch härtere Aktionen eingeschworen haben. Die Mitglieder der Gruppe wurden im Jahr 2020 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Chemnitz – das war nicht nur der Ort, in den 2018 Rechtsextremisten aus der ganzen Republik gekommen waren, um einen Schulterschluss zu üben. Es war zwanzig Jahre zuvor, im Jahr 1998, auch der Ort, an dem Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt bei ihren Kameraden aus dem Netzwerk »Blood & Honour« Unterschlupf fanden, als sie den Weg in den Untergrund antraten.
Chemnitz als Ort trägt nicht die Schuld an diesen Entwicklungen; es gibt noch viele andere Städte und Gemeinden, in denen sich die rechtsextreme Szene formiert. Längst ist auch eine internationale Gemeinschaft des Hasses entstanden, die über das Internet kommuniziert und sich durch den Terrorismus in anderen Ländern anstacheln lässt, beispielsweise von den rassistischen Attentaten im Jahr 2019 in El Paso (USA) und Christchurch (Neuseeland). In Deutschland schreckten zuletzt vor allem die Morde und Anschläge von Halle (2019) und Hanau (2020) die Öffentlichkeit auf, dazu der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke (2019). Lübckes Mörder Stephan Ernst, Jahrgang 1973, gehört zur selben Generation wie Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt.
Wie so viele in dieser »Generation NSU« oder »Generation Hoyerswerda« (vgl. Kleffner/Spangenberg 2016) hatte Ernst diverse Kontakte zu Rechtsextremisten und Gruppen, die den Behörden schon aus anderen Verfahren bekannt sind, auch aus den NSU-Ermittlungen. Man kennt sich. Das muss nicht viel bedeuten, in der rechtsextremen Szene gibt es einen regen Austausch. Dennoch lassen die vielfältigen Kontakte und Verbindungen das Misstrauen wachsen, wenn auf Seiten der Ermittler allzu schnell von »Einzeltätern« die Rede ist. Schon zu oft haben sich die Behörden damit zufriedengegeben, einzelne Täter zu präsentieren und auf umfangreiche Strukturermittlungen zu verzichten. So war es bereits 1980 nach dem Oktoberfest-Attentat, bei dem 13 Menschen getötet und mehr als 200 Personen verletzt wurden.
In den Jahren nach Entdecken des NSU sind mehrere rechtsextreme Gruppen und Terrorzellen gerade noch rechtzeitig zerschlagen worden, sei es die »Gruppe Freital«, die »Oldschool Society«, »Revolution Chemnitz«, die »Gruppe S.« oder Zusammenschlüsse sogenannter Reichsbürger. In anderen Fällen, wie in Halle, Hanau oder beim Mord an Walter Lübcke schritten die Behörden zu spät ein – und erneut zeigten sich ähnliche Fehler und Ungeheuerlichkeiten, wie sie im NSU-Komplex aufgetaucht waren: Informationen, die von Beamten ignoriert oder blockiert wurden; Koordination- und Absprachemängel; unzureichende Sensibilität im Umgang mit den Familien der Opfer.