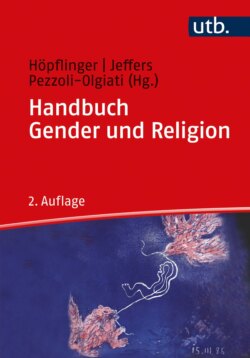Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 11
1 »Gender« und »Religion« als Konzepte der Religionsforschung
ОглавлениеGeschlecht ist eng mit anthropologischen Reflexionen verbunden, es geht um die Frage des Menschenbildes und seinen Bezug zu einem bestimmten kulturellen Kontext. Geschlecht ist zunächst verbunden mit einem Körper im Sinne einer physisch-sinnlichen Existenz. Genauso relevant in diesem Zusammenhang ist der Leib, verstanden als subjektiv gespürte und interpretierte Physis, als Reflexion des Individuums über das körperliche Sein.5 Menschen sind in ihrer Körperlichkeit und Leibhaftigkeit soziale Wesen: Zum Physischen und Individuellen tritt also das Sozial-Kollektive als dritte relevante anthropologische Kategorie hinzu. Damit wird ersichtlich, dass Geschlechtskonzepte stets kultur- und zeitspezifisch ausgeformt werden, sie prägen Menschen und ihre Vorstellungen in unterschiedlichen Teilen der Welt verschieden. Global gesehen lässt sich eine große Bandbreite an Geschlechterkonzepten finden: Es gibt Menschen- und Weltbilder, in denen mehrere fluide Geschlechter eine Rolle spielen,6 andere, die durch stark binäre Differenzkonstruktionen gekennzeichnet sind, und dazwischen findet sich eine ganze Bandbreite an Konstellationen.
Geschlecht ist also etwas Körperliches, etwas Leibliches und wird kulturell bestimmt. Gehen wir von dieser Annahme aus, können wir umgekehrt argumentieren, dass soziale Ordnungen auch Ordnungen des Körpers sind.7 Die oben zitierte Szene aus der Odyssee ist ein Beispiel für diese enge Verbindung zwischen körperlichen und sozialen Ordnungen: In der angeführten Passage zeigt sich eine deutliche Trennung von sozialen Räumen für Frauen und für Männer, die verbunden werden mit spezifischen körperlichen Tätigkeiten. Die Frauen spinnen und weben in den Privatgemächern, die Männer feiern und singen in den öffentlich zugänglichen Orten. Die Zuweisung zu diesen unterschiedlich konnotierten Orten reproduziert Machtverhältnisse, wie die Verse, in denen der Sohn über seine Mutter bestimmt, prägnant zum Ausdruck bringen. Soziale Umgangsformen, Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens und ordnende Klassifikationen von Orten, Tätigkeiten und Körpern sind also kultur- und zeitspezifisch. Sie sind aber wesentlich für die Frage, wer oder was der Mensch ist und wie das Verhältnis zwischen verschiedenen Geschlechtern zu begreifen sei.
Für die Erfassung und Systematisierung dieser unterschiedlichen Kategorien, die Körper und Kultur zusammenbringen, sind konzeptuelle Reflexionen notwendig. Ein Konzept, das ins Zentrum dieser Fragen zielt, ist Gender. Gender ist dabei keine statische oder »natürlich« festgeschriebene Kategorie, sondern bildet einen offenen Rahmen – mit der Kulturwissenschaftlerin Mieke Bal gesprochen ein travelling concept – der im Mittelpunkt unterschiedlicher Zugänge, Diskurse und Kontroversen steht.8
Der Terminus »Gender« ist ein Paradebeispiel eines solchen »wandernden Konzeptes«. Der Begriff entstammt der Linguistik. Von dort ist er ab Mitte der 1950er Jahre vom neuseeländischen Psychologen John Money und seinem Team im Zuge von Studien zur Intersexualität in die Psychologie eingeführt worden.9 In der Folge wird Gender in unterschiedlichen Disziplinen mit durchaus verschiedenen Semantiken und Zielen verwendet. Dabei zeigen sich spezifische Kristallisationspunkte der Fragerichtung:10 In feministischen Studien und den women studies wurden und werden androzentrische Sichtweisen aufgedeckt und die Perspektive auch auf Frauen und Kinder ausgeweitet. Damit konnten und können ungleiche Machtverhältnisse dargelegt werden.11 In solchen Zugängen nähert sich Gender Differenzkonstruktionen rund um Frauen an. Die einem solchen Zugang zugrunde liegende Binarität wurde und wird in der Folge jedoch nicht nur in queeren Theorien hinterfragt, sondern auch im globalen Feminismus, der auf intersektionale Verbindungen fokussiert und aufzeigt, dass Frau nicht gleich Frau ist.12 Somit wird Gender zu einer dynamischen Größe, die eng mit unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Prozessen, seien es Arbeitsbedingungen oder Zugang zu Bildung, zusammenhängt.13
Im Umgang mit Begriffen wie Sex, Geschlecht und Gender können unterschiedliche Spannungsverhältnisse beobachtet werden, die nicht zuletzt von der jeweiligen Sprache abhängig sind. John Money betonte beispielsweise die Spannung von Sex als biologischem Geschlecht und Gender als Geschlechtsverhalten; auf dieser Linie wird in der englischsprachigen Literatur geläufig Sex mit der biologischen Grundlage und Gender mit der sozialen Ausformung des Geschlechts assoziiert.14 Aber auch die Bezeichnung, Beschreibung und Klassifizierung der biologischen Grundlagen sind eine kulturelle Leistung und in diesem Sinne ebenfalls eine gesellschaftliche Konstruktion, ein Argument, das von Judith Butler vertreten wird.15 Im Deutschen artikulieren sich die Gestaltungsmöglichkeiten in der Triangulation von Gender – als Fremdwort –, Geschlecht und Sex. Ob man Gender und Geschlecht als Synonyme setzt oder Gender als Konstruktion von Geschlecht und Sex umreißt, variiert je nach Disziplin, Ansatz und Autor*in stark, auch in Abhängigkeit von der Rezeption der vielfältigen, hier nur konzis rekapitulierten Debatten im angelsächsischen Raum.
Für die Annäherung an diese Themen, die wir in diesem Handbuch vorschlagen, ist es wesentlich zu erkennen, dass Gender oder Geschlecht keine statischen Begriffe sind, sondern tatsächlich travelling concepts, die je nach Perspektive und Kontext anders verhandelt und verstanden sowie unterschiedlich debattiert werden. Gender kann beispielsweise sehr umfassend verwendet werden: Dies wird zum Beispiel ersichtlich in der Rezeption des Ausdrucks doing gender, den die US-amerikanischen Soziolog*innen Candace West und Don H. Zimmerman geprägt haben. Damit fokussieren sie nicht mehr auf die Frage, was Gender ist, sondern auf die Mechanismen der Konstruktion, Verhandlung und Veränderung im Umgang mit Geschlechtsdifferenzen in der Gesellschaft.16
Als Herausgeberinnen tendieren wir dazu, das Fremdwort Gender als Begriff der Theoriebildung in Abgrenzung zu politischen, medialen und/oder emischen Perspektiven zu verwenden. Dabei verstehen wir Gender als ein Konzept, mit dem wir kulturelle Ausprägungen von Körper und Leib im Hinblick auf Geschlechtsdiskurse und Aushandlungen von Geschlecht untersuchen können. Somit nehmen wir mit dem Konzept von Gender komplexe, kulturell verankerte Verflechtungen in den Blick, die für eine Untersuchung von Religion besonders relevant sind, und verzichten bewusst auf dichotome Konstellationen zwischen Gender, Geschlecht und Sex.
Allerdings wurde es aufgrund der unterschiedlichen Zugänge, Definitionen und Verwendung von Gender, Geschlecht und Sex, die nach- und nebeneinander existieren, in diesem Projekt den Autor*innen überlassen, ihr eigenes Verständnis dieser Konzepte einzubringen. Auch auf der formalen Ebene, die unserer Meinung nach stark mit der konzeptuellen verwoben ist, haben wir den Beitragenden die Herangehensweise an eine gendergerechte Sprache offengelassen. Die einzelnen Beiträge nähern sich also Geschlecht und Religion unterschiedlich und präsentieren somit in ihrer Gesamtheit eine aufschlussreiche Spannbreite von Zugängen. Diese Breite aufzuzeigen, ist eines der Ziele des Handbuchs.
In die gleiche Richtung bewegen wir uns mit dem zweiten, zentralen wandernden Konzept des Handbuchs: Religion. Das anfängliche Zitat ist auch in dieser Hinsicht aufschlussreich. Die Odyssee ist ein über die Jahrtausende – eben auch in Mary Beards Manifesto – rezipiertes Buch. Sie vermittelt Vorstellungen und Erwartungen an Mensch und Umwelt, die je nach Zeit und Kontext neu interpretiert werden und doch von einem Entstehungskontext geprägt sind. In den angeführten Zeilen wird nicht nur eine spezifische Geschlechterordnung, sondern auch ein bestimmtes religiöses Weltbild vertreten. Dabei werden immanente und transzendente Dimensionen einerseits unterschieden – der Text setzt eine Trennung zwischen Gottheiten- und Menschenwelt voraus – und andererseits in Verbindung gebracht. Telemachos weist Penelope zurecht und sieht Zeus auf seiner männlichen Seite, während Athena der trauernden Mutter einen süßen Schlaf beschert.
Ein Transzendenzbezug ist maßgebend für die hier vertretene Annäherung an Religion und unterscheidet religiöse Symbolsysteme von anderen kulturellen Bereichen. Religion formt die Spannung zwischen Transzendenz und Immanenz, gibt dieser unscharfen Grenze eine Gestalt und vermittelt damit Ordnung und Sinn, die auch Geschlechterverhältnisse prägen. In dieser Orientierungsfunktion wurzeln Werte und Normen, die internalisiert, verhandelt, weitergegeben und transformiert werden. Mit einer beschreibenden und normativen Orientierungsleistung von Religion sind stets Machtverhältnisse gekoppelt: Religionen konstituieren Hierarchien und verfügen über autoritative Strukturen, die einerseits die jeweilige Bestimmung von Geschlecht prägen und andererseits davon beeinflusst sind. Religion als umfassendes Symbolsystem modelliert und legitimiert nachhaltig Differenzprozesse in den verschiedensten gesellschaftlichen Institutionen und Bereichen. Wie die Beiträge in diesem Band eindrücklich aufzeigen, sind religiöse Symbolsysteme grundlegend in der Aushandlung von Geschlechtsbestimmungen, -rollen, -zuordnungen und -funktionen. Dabei spielt Religion nicht nur eine Rolle in der Reiteration von Machtstrukturen, sondern auch in Transformations- und Subversionsprozessen. Auf diesen dynamischen Relationen gründen religiöse Identitäten, die in der Spannung zwischen Gemeinschaft und Individuum artikuliert werden. Religiöse individuelle Praxis findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie rezipiert, reproduziert oder hinterfragt Geschlechtervorstellungen und -regulierungen. Umgekehrt sind religiöse Gemeinschaften nicht unveränderliche, statische Größen, sondern Gruppen von Menschen mit einem Körper, einem Leib und damit auch einem Geschlecht. Menschen in ihrer Geschlechtlichkeit leben Religion, sie reflektieren sie, reproduzieren Narrative und Motive, aber auch Normen und Werte oder brechen sie. Religiöse Identität kann nicht von Genderidentität gelöst werden. Religionen als historische, phänomenologische Größen sind also eng mit spezifischen kulturellen Kontexten und deren Perspektiven auf Mensch und Welt verbunden. Wir gehen von einem kulturwissenschaftlichen Verständnis von Religion aus und verstehen sie als Teil von Kultur: Religion wird als komplexes und intermediales Kommunikationssystem umrissen, das die Welt symbolisch ordnet und damit Orientierung formt.17
Was der Mensch ist, wie sein Geschlecht sich auf alle immanenten und transzendenten Beziehungen, die das Leben ausmachen, auswirkt, gehört zu den fundamentalsten Fragen von Religion. Diese Dimensionen von Religion als Symbolsystem, ihre Medialität, ihre Weltbilder, Transzendenzkonzepte, Normativitätsvorstellungen, Tradierungsmechanismen und Identifikationsprozesse bilden die Leitlinien des vorliegenden Handbuchs.18