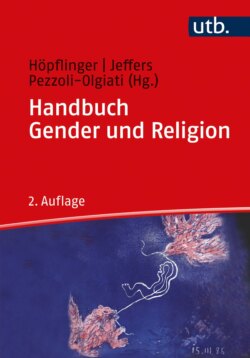Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 13
3 Gender und Religion als Gegenstand öffentlicher Debatten
ОглавлениеGendervorstellungen und -rollen sind also eng vernetzt mit religiösen Menschen- und Weltbildern. Sie wandeln sich mit der Transformation in religiösen Traditionen, sie breiten sich mit religiösen Gemeinschaften aus und regulieren Genderbilder auch in der heutigen, säkularisierten und pluralisierten Gesellschaft. Genderfragen waren und sind integraler Bestandteil gesellschaftlich-politischer Debatten: Das Frauenwahlrecht, der Zugang von Frauen zu Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, die Rolle der Frau in Familie und Arbeitswelt, die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper, der Kampf gegen sexuelle Übergriffe in ihrer ganzen Bandbreit (die #metoo-Kampagne ist hier zu nennen) sind nur einige der Diskussionsthemen, die seit der frühen Neuzeit verschiedene Länder, und zwar nicht nur der Nordhalbkugel, prägten. Feministische Bewegungen erlangten eine wichtige Bedeutung in diesen Emanzipationsbestrebungen.
Aufschlussreich für unseren Blick ist dabei die Rolle von Religion: Religion spielt bei zahlreichen Debatten um Gender eine maßgebende Rolle. Bei gesellschaftlichpolitischen Diskussionen beispielweise über Verhüllung (die am Körper von Frauen ausgeführt werden), über weibliche Genitalverstümmelung oder über das Priesteramt für Frauen in der römisch-katholischen Kirche geht es um Debatten über die Rolle von religiösen Traditionen im Umgang mit dem weiblichen Körper und der Frau. Religiöse Argumente können aber auch als Grundlage dienen, um gegen Emanzipationsbewegungen zu kämpfen: antifeministische und antigenderistische Bewegungen oder LGBTIQ+-feindliche Positionen zeigen dies deutlich auf. Gleichzeitig können religiöse Positionen jedoch auch Emanzipationsbestrebungen unterstützen, wie beispielsweise im globalen Feminismus, der religiös geprägt sein kann.25
Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, dass das Wechselspiel zwischen Religion und Gender die Welt verändernde gesellschaftlich-politische Debatten angestoßen hat und noch immer anstößt. Solche Debatten transformieren einerseits die religiösen Gemeinschaften selbst, die sich in diesen Diskursen positionieren und gegen Kritiken – entweder gegen den Vorwurf des Konservativismus oder der normativen Verwässerung – antreten müssen, die aber auch in sich plural sind, neue Sichtweisen in sich aufnehmen oder sich erweitern. Denn religiöse Gemeinschaften befinden sich in einem steten Wandel, der in Interaktion mit gesellschaftlich-politischen und den kulturellen Debatten betrachtet werden muss.
Andererseits haben solche Diskurse bezüglich Gender und Religion maßgebenden Einfluss auf gesellschaftliche Ansichten und Grundlagen: Sie beeinflussen die politischen Meinungsbildungen und Gesetzeswerke; sie tangieren medizinische Diskurse und das alltägliche soziale Zusammenleben. Und nicht zuletzt verändern diese Debatten die medialen Repräsentationen von Frau, Mann und anderen Geschlechtern.26 Die »Macht« der Medien – und auch der Unterhaltungskultur – darf für gesellschaftliche Debatten über Gender und Religion nicht unterschätzt werden. Mediale Diskurse formen alltägliches Wissen über Gender und bilden »Repräsentationsregime«, die durch Reiteration und Verbreitung von Stereotypen Vorstellungen und Praktiken prägen.27
Diese Relevanz des Zusammenspiels von Gender und Religion für öffentliche, politische und mediale Debatten, die wir hier nur mit wenigen Beispielen illustriert haben, hat für eine wissenschaftliche Beschäftigung verschiedene Implikationen, von denen wir zwei betonen möchten:
Erstens sind wir auch als Fachleute in einen sozialen Genderdiskurs und ein Genderregime eingebettet. Wir sind also als Lehrende und Forschende immer Teil dieser öffentlichen Debatten über Gender und Religion, sie prägen uns im Alltag und im Berufsleben maßgebend mit. Sie formen unsere Forschungsfelder und ermöglichen aufgrund ihrer Aktualität Finanzierungen von Projekten.
Zweitens versuchen wir, trotz aller Verfangenheit in Genderrollen, als Wissenschaftler*innen auch Distanz zu diesem Forschungsfeld zu generieren. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass wir ein metasprachliches Instrumentarium entwickeln und zur Verfügung stellen, um solche öffentlichen Debatten aufzugreifen. Ein solches Instrumentarium sollte geeignet sein, um synchrone und diachrone Prozesse zu erfassen, es erklärt Verbindungen zwischen historischen und gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen und Unsicherheiten. Des Weiteren hilft es, Zugänge zu Geschlechterfragen zeit- und kulturgeschichtlich zu kontextualisieren. Solche metasprachlichen Konzepte können dann wiederum Mittelpunkt öffentlicher Debatten werden, wie es beim Begriff »Gender«, zum Beispiel im Antigenderismus, geschehen ist.28 Damit wird Wissenschaft selbst wieder Teil dieser gesellschaftlichen Diskurse. Sie oszilliert zwischen Nähe und Distanz und sucht nach Reflexionsmöglichkeiten der eigenen Vorannahmen und Zugänge.