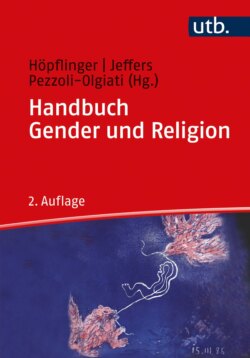Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 18
Einleitung
ОглавлениеSobald von Vermittlung die Rede ist, muss berücksichtigt werden, dass eine solche Vermittlung immer nur in einem ganz bestimmten Kontext Sinn macht. Auf diese Kontextbedingtheit hat ganz besonders und mit Nachdruck die Hermeneutik als Theorie der Auslegung und des Verstehens aufmerksam gemacht. In diesem Sinne könnte man sagen, dass die Definition der Religionswissenschaft als »Vermittlung von Weltbildern« in ihr das hermeneutische Moment hervorhebt, und um diesen hermeneutischen Aspekt soll es hier gehen. Alle vier Aufsätze, die diesen ersten Teil des Handbuchs ausmachen, enthalten denn auch, wie mir scheint, klare Ansätze zu einer hermeneutischen Reflexion der Religionswissenschaft.
Sowohl die philosophische als auch die theologische Hermeneutik haben sich intensiv mit dem Thema der Weltbilder, oder vielleicht üblicher in der Terminologie der hermeneutischen Tradition: mit dem Thema der Weltanschauungen, auseinandergesetzt. Dies kann ganz einfach bei Rudolf Bultmann belegt werden: Für seine Hermeneutik spielt das Thema der Weltanschauung eine entscheidende Rolle, auch in seinem Versuch, das Urchristentum religionsgeschichtlich in die antike Welt einzuordnen (eine neuere Beschäftigung dazu findet sich in Christian Berners Buch Qu’est-ce qu’une conception du monde?). Dabei setzt sich die Hermeneutik kritisch mit der Geschichtsvergessenheit der traditionellen Metaphysik auseinander, die ihre Weltanschauung als geschichtslose, objektive Wahrheit vertrat, ohne zu berücksichtigen, dass diese immer schon historisch und gesellschaftlich vermittelt ist. Die Hermeneutik hingegen betont die Geschichtlichkeit der Weltbilder oder Weltanschauungen und deshalb auch ihre Relativität, ihre Veränderlichkeit und dadurch ihre Interpretierbarkeit. Bultmanns heftig diskutiertes Programm der Entmythologisierung versucht über die Geschichtlichkeit der Weltbilder in Hinsicht auf unseren Umgang mit den biblischen Texten Rechenschaft abzulegen.
Wie steht es nun aber in Hinsicht auf »die Religionswissenschaft als Vermittlung von Weltbildern«? Könnte es sein, dass auch hier manchmal die Vermittlung als »blinder Fleck« behandelt wird, Weltbilder also auch objektiviert, als unmittelbare Wahrheit betrachtet werden? Zunächst muss hier zwischen der Religion selbst und der Religionswissenschaft unterschieden werden. Es ist klar, dass Religionen auf vielfältige Weise Weltbilder entwickeln und deren Vermittlung auch sehr unterschiedlich auffassen. Aufgabe der Religionswissenschaft wäre es dann, auf solche »Weltbilder der Religionen«, wie es beispielsweise der Religionswissenschaftler Fritz Stolz in seinem gleichnamigen Buch von 2001 formuliert, aufmerksam zu machen und sie also in diesem Sinne zu vermitteln. »Vermittlung« könnte hier also im Sinne von »Bekanntmachen, Auslegen« verstanden werden. Auf einer Metaebene gibt es aber noch ein anderes Vermitteln von Weltbildern in der Religionswissenschaft, das dieses Handbuch kritisch reflektieren will: das Vermitteln von Weltbildern, die sich mit den methodischen Voraussetzungen der Disziplin verbinden. Diese methodischen, epistemologischen Weltbilder können sich dann auch auf die Wahrnehmung der religiösen Weltbilder auswirken. Kritische Stimmen sagen sogar: Je weniger bewusst sie reflektiert werden, je stärker können sie sich auswirken!
Achtet man auf die Vermittlung dieser Weltbilder oder -anschauungen, wie es die Hermeneutik wünscht, stellt sich unmittelbar das Gefühl einer starken Ambivalenz ein. Weltbilder können sehr unterschiedlich wirken, erklärend oder verdunkelnd, befreiend oder erdrückend, öffnend oder verschließend. Paul Ricœur hat in seinem Werk L’idéologie et l’utopie von 1997 versucht, diese Ambivalenz mit dem Gegensatz von Ideologie und Utopie zu reflektieren: Ideologisch – hier im positiven Sinne zu verstehen – ist ein Weltbild, wenn es den gegebenen Zustand bestätigend aufnimmt und rechtfertigt, warum er so sein soll, wie er ist; utopisch hingegen ist ein Weltbild, das den gegebenen Zustand hinterfragt und subversiv eine Gegenwelt entwickelt.
Diese Polarität von bestätigenden und brechenden Weltbildern ließe sich leicht im Bereich der Religionen beobachten. Im vorliegenden Band wird diese Ambivalenz in den religionswissenschaftlich vermittelten Weltbildern zu thematisieren sein, und zwar indem die Gender-Perspektive als kritischer Maßstab angelegt wird. Es gehört zur Kontextbedingtheit der Hermeneutik, dass sie die Gender-Thematik noch relativ wenig aufgenommen hat. Eine bedeutende Ausnahme bildet die Hermeneutik, wie sie in den feministischen Theologien entwickelt wurde. Ein Beispiel hierfür wären ein Aufsatz mit dem Titel Die Bibel verstehen, den ich zusammen mit Elisabeth Schüssler Fiorenza veröffentlich habe, oder im religionswissenschaftlichen Kontext der Beitrag von Erin White von 1995 mit dem Titel Religion and the Hermeneutics of Gender.
In diesem Handbuch wird sie bewusst thematisiert, und zwar in diesem ersten Teil als hermeneutische Frage: Welches Licht wird auf die Weltbilder der Religionswissenschaft und deren Vermittlung geworfen, wenn man stärker, bewusster auf die Geschlechterdifferenz achtet? Welche dieser Weltbilder wirken ideologisch und welche utopisch? Wie löst man sich von erstarrten, einengenden Gender-Auffassungen? Wie entwirft man in Hinsicht auf religionswissenschaftliche Wahrnehmung der Gender-Thematik inspirierende Gegenwelten? An solchen Fragen arbeiten unsere vier Texte.
Ursula King steigt bei der Beobachtung ein, dass die Entdeckung der Gender-Perspektive einen radikalen Paradigmenwechsel in den Geistes- und Sozialwissenschaften ausgelöst hat, der sich nun, wenn auch verspätet, ebenfalls in der Religionswissenschaft breit auswirkt. Wie sich das auswirkt, wird unter drei Gesichtspunkten erörtert: die Frage nach den geschlechtsspezifischen Rollen, welche die Religionen in ihrer institutionellen Ausgestaltung Frauen und Männern zuweisen; die Frage danach, wie sich die Geschlechterdifferenz in der Symbolik und Metaphorik des religiösen Denkens und der religiösen Sprache niederschlägt; und schließlich die Frage, ob und wie in der religiösen Erfahrung geschlechtliche Spezifizierungen wahrnehmbar werden.
Daran anschließend macht U. King auf ein neues, heute stark bearbeitetes Gebiet aufmerksam, das der Spiritualität. Auf das prägnante Gendering the Spirit, das Durre S. Ahmed als Titel für ihr Buch von 2002 gewählt hat, anspielend, betont sie, dass die noch zu wenig beachtete Gender-Dimension zu einer neuen Bestimmung des Umgangs mit Geist und Transzendenz führt. So ist etwa zu beobachten, dass der Zugang zur Lese- und Schreibfähigkeit, zur »Literalität« (literacy), der den Frauen jahrhundertelang vorenthalten wurde, die Spiritualität stark verändert. Die Spannung zwischen Literalität und Oralität hat genderspezifische Aspekte, und der Durchbruch zu einem unabhängigen Lesen und Interpretieren der kanonischen Texte und zur Aneignung von Wissen über Religion ist für die Frauen als soziale Gruppe eine späte, auch jetzt noch nicht weltweit erreichte Errungenschaft (was Frau King mit verschiedenen Beispielen aus unterschiedlichen Erdteilen illustriert). Abschließend schlägt Ursula King vor, in diesem Sinne von einer »spirituellen Literalität« (spiritual literacy) zu sprechen, als Bezeichnung für einen neu zu entdeckenden Forschungszweig.
Einen anderen Weg geht Daria Pezzoli-Olgiati in ihrem Aufsatz: Einsteigend bei der berühmten Frage von Schneewittchens Stiefmutter: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«, thematisiert sie die Optik der Religionswissenschaft, das heißt die optischen Hilfsmittel, die sie zum Betrachten ihres Gegenstandes braucht: »Brillen, Spiegel und Spiegelungen«. Im Unterschied zur Märchengestalt verfügt die Religionswissenschaft über keinen Spiegel, der einfach die Wahrheit sagt, obschon das vielleicht lange das Ideal der Disziplin war, das Ideal einer möglichst präzisen und objektiven Beschreibung bestimmter religiöser Sachverhalte. Doch die Autorin geht gerade davon aus, dass dieses Ideal in einer radikalen Krise steckt: Die hermeneutische und postmoderne Reflexion hinterfragt die Idee einer unbeteiligten, unparteiischen Distanz; zugleich setzen die gesellschaftlich-politischen Erwartungen die Religionswissenschaft unter Druck, sodass sie sich nicht mehr in einem Elfenbeinturm verschanzen kann.
Auch die Entdeckung der Gender-Thematik hat dazu beigetragen, dass man vermehrt darauf achtete, wie stark die Religionswissenschaft mit optischen Hilfsmitteln arbeitet. Das klassische Ideal einer objektiven Sicht wurde denn auch in diesem Kontext »als typisch androzentrisch entlarvt«, in Hinsicht sowohl auf die Ausblendung der Frauen in der Geschichte der Disziplin als auch auf eine gewisse Geschlechterblindheit in der empirischen Erforschung von religiösen Gemeinschaften.
In ihrem letzten Abschnitt schlägt die Autorin vor, das Dilemma aus einer wissenschaftsethischen und hermeneutischen Perspektive anzugehen, indem der Standpunkt, die Vorverständnisse, die Werte und Normen, welche die wissenschaftliche Einstellung regeln, kritisch reflektiert werden. Solche Regulierungen müssten, so die Autorin, in einer academic community ausgehandelt werden. Damit werden entscheidende methodische Spannungen thematisiert, die sonst nicht bewusst wahrgenommen werden.
Unter dem Titel Schuld ist nur der Feminismus befasst sich Kristina Göthling-Zimpel intensiv mit dem Phänomen des Antifeminismus. Sie beschreibt seine unterschiedlichen Facetten und untersucht die Faktoren, die es dieser heftigen Gegenbewegung erlauben, sich als eine Weltsicht zu etablieren. In Hinsicht auf die in den Gender Studies erforschte Genderfrage führt er zu einem Antigenderismus: Gender wird als Genderideologie abgestempelt. Einen besonderen Fokus legt die Autorin auf die Verbindung mit der Religion, aber immer eingebettet in die breitere gesellschaftliche Dimension. In diesem Sinne unterscheidet sie vor allem drei Spektren, aus denen heraus Antigenderismus, in Europa wie auch in den USA, betrieben wird: die Männerrechtsbewegung, die fundamental-christlichen Kreise und der politische Rechtspopulismus.
Im Weiteren unterscheidet sie in Anlehnung an einen Artikel von Brigit Sauer mit dem Titel Anti-feministische Mobilisierung in Europa sechs Argumentationsmuster, die ins Spiel gebracht werden: die als von Natur gegeben erklärte Zweigeschlechtlichkeit (religiös begründet im römisch-katholischen Konservatismus wie auch in evangelikalen Kreisen); der Schutz der heterosexuellen Kleinfamilie, Keimzelle des Staates; das Kindeswohl im Elternrecht und in der Sexualerziehung; die Enthüllung von Gender als Genderideologie; eine religiös begründete, kolonialistische Gegenüberstellung von emanzipiertem Okzident und rückschrittlichem Orient; und schließlich ein gegen das Universitäre gerichteter Anti-Intellektualismus.
Nachdem K. Göthling-Zimpel gezeigt hat, wie sich dieser Antigenderismus dank Internet und in heftiger Reaktion auf Hashtags wie #aufschrei, #MeToo und #TimesUp, aber auch in Verbindung mit Phänomenen der »Mannosphäre« wie etwa die Vormachtstellung des Weißen Mannes, hat ausdehnen können, konzentriert sie sich auf die »Intersektionen von Religion, Gender und Race«. Das heißt: Sie zeigt auf, wie sich der Antifeminismus mit Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Homophobie verbindet und damit zum Vermittler von konservativen religiösen Normen wird.
Mit dem vierten Beitrag, Rosalind Janssens Darstellung der Höhen und Tiefen der Genderarchäologie, verändert sich die Perspektive nochmals. Es geht der Autorin darum, aufzuweisen, wie sich im Bereich der Archäologie das Interesse für Genderfragen trotz Widerständen progressiv durchgesetzt und dauerhaft etabliert hat. Aufgrund von drei Fallstudien wird das in zwei Richtungen entfaltet: Einerseits soll damit in den archäologisch erforschten Zeiten die patriarchale Vorherrschaft infrage gestellt und den oft stimmlos gebliebenen Frauen eine Stimme verliehen werden; andererseits gilt es, auch die Rolle der Frauen und die Bedeutung der Genderfrage in der Archäologie selbst als Disziplin hervorzuheben (etwa durch Verbesserung der Berichterstattung über Archäologinnen). Zugleich lässt sich beobachten, dass die neuere Genderarchäologie nicht mehr ausschließlich die Rollen und den Status von Frauen betont, sondern eine breitere Perspektive einnimmt, die eine »Einbeziehung von Frauen, Männern und anderen Geschlechtern in einen einzigen Untersuchungsrahmen« erlaubt, um ein Zitat von Elizabeth Brumfiel aus ihrer Studie von 2006 anzuführen.
Genderarchäologie setzt ihren Fokus auf Objekte, die mit Frauen verbunden sind, etwa in Hinsicht auf Befunde in Gräbern, aber auch aus der Arbeitswelt, z. B. der Welt des Backens. Damit ist ein Akzent auf Materialität gesetzt, denn gerade an solchem Material lässt sich die Frage von Geschlecht und Herrschaft und deren religiösen Begründungen neu aufrollen. In diesem Sinne sieht die Autorin darin eine große Chance, Genderarchäologie und Religion in Kombination zu bringen: Es könnte sich damit ein wichtiger Gegenpol zu hegemonialen Texten herausbilden, wie sie in religiösen Kontexten zu finden sind, etwa in der Bibel, aber auch anderswo. Damit kann sich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit feministischen Bibelwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen ergeben.
Durch eine kleine Evaluation der vier Aufsätze möchte ich versuchen, einen bescheidenen Beitrag zu einer hermeneutischen Rechenschaft über das religionswissenschaftliche Arbeiten zu leisten. Ich hebe jeweils in jedem Beitrag ein Element hervor, das mir hermeneutisch fruchtbar zu sein scheint, um die Beiträge dann abschließend in einer Gesamtperspektive zu betrachten.
Bei Ursula King finde ich den Hinweis auf die Spiritualität sehr wichtig. Dass dieser Aspekt zum Bereich der religiösen Praxis gehört, darf als Selbstverständlichkeit gelten. Dass er aber auch in Hinsicht auf die methodischen Voraussetzungen der Religionswissenschaft mitzubedenken ist, scheint mir eine verheißungsvolle Forschungsperspektive zu enthalten. Damit könnte sich einiges im Selbstverständnis der Disziplin verändern. Dass U. King in dieser Spiritualität die Dimension der Literalität hervorhebt, finde ich ebenfalls hermeneutisch spannend, denn die Spannung von Literalität und Oralität begleitet mindestens seit der Reformationszeit die theologische Hermeneutik. Es wäre deshalb interessant, noch zu vertiefen, was »spirituelle Literalität« in heutiger Zeit konkret bedeuten könnte, und zwar in verschiedenen kulturellen Kontexten.
Der Aufsatz von Daria Pezzoli-Olgiati ist ganz stark von der optischen Metaphorik getragen, und das ist im Kern natürlich eine hermeneutische Metaphorik. Dass wir in unserer geistes- und sozialwissenschaftlichen, ja vielleicht sogar auch in der naturwissenschaftlichen Arbeit, ständig mit Brillen, Spiegeln und Spiegelungen zu tun haben, gehört zu den Grundeinsichten der Hermeneutik. Das führt dazu, dass man die wissenschaftlichen Grundprinzipien der Objektivität, der Distanziertheit, der Wertneutralität immer wieder kritisch hinterfragen muss, ohne natürlich einem besinnungslosen Subjektivismus freien Lauf zu lassen. Sehr schön bringt Daria Pezzoli-Olgiati die ständige Spannung von Distanz und Voreingenommenheit zum Tragen. In diesem Rahmen ergäbe sich mit Paul Ricœurs Kategorie der »distanciation« (auf Deutsch üblicherweise mit »Verfremdung« übersetzt) aus seinem Text La fonction herméneutique de la distanciation von 1986 die Möglichkeit einer hermeneutischen Vertiefung, die zeigt, dass man sich erforschte Wirklichkeiten immer nur über Distanz aneignen kann.
In Kristina Göthling-Zimpels Beitrag möchte ich die Kategorie der Intersektionalität, mit der sie im Schlussteil arbeitet, hervorheben. Diese Kategorie erlaubt ihr zu zeigen, wie der Antifeminismus seine Weltsicht aufbaut, indem er sich mit einer Reihe von weiteren polemischen Abgrenzungen in Religion und Politik zusammenfügt, wie Rassismus, Homophobie, Antisemitismus und Islamfeindschaft. An alldem ist dann eben, so der Vorwurf, der Feminismus schuld: Er hat all die Übel ausgelöst, gegen die man nun unablässig kämpfen muss. Weil die Phänomene nie isoliert bleiben, weiß die Hermeneutik darum, dass man auf solche Interdependenzen im breiten Umfeld achten muss. Es kann nicht nur um den Streit zwischen Feminismus und Antifeminismus gehen, sondern alle weiteren, damit zusammenhängenden Implikationen spielen mit hinein. Die Hermeneutik kann helfen, sich mit solchen komplexen Konstellationen auseinanderzusetzen.
Dass bei Rosalind Janssen Fortschritte der Genderforschung ausgerechnet in der Archäologie thematisiert werden, stiftet eine interessante Resonanz mit Paul Ricœurs Hermeneutik. In seinem Versuch über Freud (2004 bei Suhrkamp, 1965 in der französischen Originalversion) unterscheidet er zwei Grundausrichtungen der Interpretation. Die eine bemüht sich darum, dem Text zu seinem Ziel zu verhelfen, seinen Sinn möglichst klar zum Ausdruck zu bringen. Dieser Ausrichtung, die er deshalb teleologisch nennt, stellt er die andere gegenüber, die er in Anlehnung an die »Meister des Verdachts«, wie er Marx, Freud und Nietzsche nennt, als die Bemühung versteht, den Text zu hinterfragen, in ihm herauszufinden, was er verbirgt, was er verschweigt. Diese zweite Ausrichtung nennt er die archäologische. Damit entsteht, scheint mir, eine Entsprechung zur Genderarchäologie, die ja auch den Stimmlosen eine Stimme verleihen will, indem sie in Objekten, Artefakten, Utensilien einen Kontrapunkt zu hegemonialen, patriarchalen Texten sucht.
In den vier Aufsätzen ist relativ wenig explizit von den Weltbildern und deren religionswissenschaftlicher Vermittlung die Rede. Implizit jedoch ist die Thematik bei allen sehr präsent, und zwar als kritisches Ferment in Hinsicht auf die Rechenschaft über die komplexe Beziehung von Weltbild und Genderfrage. Alle sind sich der Ambivalenz der Weltbilder bewusst, die hier aufeinanderstoßen. Diese Ambivalenz könnte leicht dualistisch ausgeschlachtet werden, im Sinne der »-ismen«, auf die Daria Pezzoli-Olgiati hinweist. Demgegenüber scheint es mir wichtig, die Komplexität der Genderfrage zu betonen, wie das Ursula King macht. Das »engendering«, die »Eingeschlechtlichung«, ist hermeneutisch als ein umfassender Prozess zu verstehen, in dem auch die gesellschaftlich vermittelte Weltanschauung auf dem Spiel steht. Das wissen auch Kristina Göthling-Zimpel in ihrer Auseinandersetzung mit dem Antigenderismus und Rosalind Janssen in ihren Bemühungen um die Etablierung der Genderarchäologie. In dieser Hinsicht zeigt sich eine große Nähe zwischen den vier Beiträgen. Sie machen es auch dem Hermeneutiker zur stimulierenden Herausforderung, noch intensiver hermeneutisch über diesen Prozess nachzudenken.