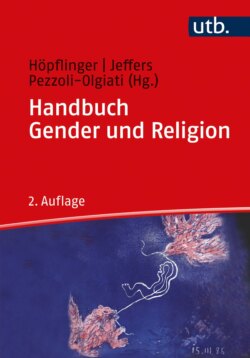Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 12
2 Gender als grundlegende Dimension religiöser Symbolsysteme
ОглавлениеGendervorstellungen und -rollen sind mit der Grundfrage der Anthropologie verbunden und werden also im Zusammenspiel mit vielfältigen Dimensionen von Religion geformt. Grundlegend für das Verhältnis von Religion und Gender sind zunächst die subjektive Wahrnehmung der Welt und die Interaktion mit einem vis-à-vis: Menschen nehmen die Welt wahr, sie verorten sich als Körper im Raum, sie kategorisieren und kommunizieren diese Wahrnehmungen durch unterschiedliche Medien wie mündliche Sprache, Texte, Bilder, Handlungen, sie systematisieren sie nach bestimmten Konzepten und formen durch diese und in diesen Prozessen Wirklichkeit.19 Teil dieser Wirklichkeitskonstruktionen sind auch Gendervorstellungen und Geschlechterrollen. Da diese oft mit existenziellen Fragen rund um Körper und Sein verknüpft sind, nehmen Geschlechterdifferenzierungen – und davon zeugen die Artikel im vorliegenden Handbuch – in zahlreichen religiösen Symbolsystemen eine zentrale Bedeutung ein. Gendervorstellungen können die basale Struktur religiöser Praktiken formen und religiöse Weltbilder prägen. Religionen können Genderhierarchien begründen und legitimieren, sie können beispielsweise durch Mythologien oder Kosmologien Unterschiede zwischen den Geschlechtern erklären und erhärten. Religionen ermöglichen es aber auch, Geschlechterdifferenzen zu hinterfragen, zu nivellieren oder zu brechen. Dabei bieten Religionen, auch in stark binären und heteronormativen Geschlechtersystemen, oft beides: Einerseits werden Erhärtungen von Geschlechtsdifferenz propagiert, andererseits werden sie unscharf gemacht, kritisiert und verändert. Aushandlungen von Geschlechterbestimmungen spiegeln die Auseinandersetzung von dominanten und marginalisierten Machtdiskursen wider. Diesbezüglich stellen die biblischen Schöpfungsberichte im Genesisbuch ein eindrückliches Beispiel dar. Diese Narrative wurden im Laufe von Tausenden von Jahren in der Legitimierung und Delegitimierung theologischer Begründungen von Machtverhältnissen aufgenommen, debattiert, verfremdet. Diese Auseinandersetungen mit dem biblischen Mythos und seine Verwendung in der Bestimmung der Geschlechter und ihres gegenseitigen Verhältnisses, die ganze Bibliotheken füllt, ist heute noch voll im Gang. In europäischen Religions- und Kulturgeschichten wurden diese Narrative von Adam und Eva verwendet, sowohl um die ontologische Sündhaftigkeit der Frau zu propagieren und ihre Unterwerfung unter den Mann zu untermauern, als auch um die Gleichwertigkeit der beiden Geschlechter darzulegen.20
An diesem Beispiel können drei Prozesse, die für einen Blick auf Gender als Dimension religiöser Symbolsysteme bedeutsam sind, verdeutlicht werden:
Erstens, Gendervorstellungen können nicht losgelöst von Traditionslinien betrachtet werden. Religionen interagieren mit Geschlechterordnungen nicht nur innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft, sondern auch über die Zeit hinweg: Religionen wie auch Gendervorstellungen unterliegen Tradierungs- sowie Diffusionsprozessen. Sie prägen die Weitergabe von religiösem Wissen, religiösen Praktiken und Vorstellungen; sie brechen sie und formen sie neu. Eine diachrone Vermittlung, gerade bezüglich Gender, geschieht manchmal auch über Religionsgrenzen hinweg. So haben beispielsweise antike griechische Vorstellungen wie sie im Odyssee-Zitat vorzufinden sind, die christliche Religionsgeschichte mitgeprägt. Religionen erschaffen bezüglich Gender in ihren synchronen und diachronen Ausprägungen ein komplexes Netzwerk, das in ständiger Aushandlung und Transformation ist. Gendervorstellungen und Geschlechterrollen verändern sich also entlang religiöser Traditionen.
Zweitens formen sich Gendervorstellungen in Religionen durch unterschiedliche Medien aus: Das oben genannte Narrativ von Eva und Adam wurde in der europäischen Religionsgeschichte so bedeutsam, weil es in einem heiligen Text präsentiert wird, aber auch, weil es in unterschiedlichsten medialen Formen bis heute immer wieder rezipiert wird. Textkommentare, Bilder, Filme, Werbung, Romane, Internetblogs und viele weitere Kommunikationsformen nehmen es auf, wiederholen und popularisieren es – und zwar so stark, dass heute ein Apfel (der wohlgemerkt in Genesis 3 gar nicht vorkommt) genügt, um Referenzen auf dieses Narrativ auszulösen.21 Bestimmte Gendervorstellungen werden dabei redundant repräsentiert und formen Werte und Normen aus, die wiederum Identifikationsmechanismen von Gemeinschaften und Individuen auslösen können – und umgekehrt.22 Die Relation von Religion und Gender tangiert also im Zusammenspiel zwischen Medialität und Körper Ebenen der Produktion von Genderwissen, der Rezeption solcher Vorstellungen in synchroner und diachroner Perspektive, der Repräsentation und Inszenierung von Gender, der Normativität sowie die Dimension von Identität.23
Drittens spielt für Religion und Gender die Selbstreflexion innerhalb religiöser Gemeinschaften eine zentrale Rolle. Wiederum ist das biblische Narrativ von der Erschaffung des Menschen als Frau und Mann ein aufschlussreiches Beispiel dafür. Denn dieser Text wurde in verschiedenen Positionen und religiösen Traditionen verwendet, um Gendervorstellungen zu legitimieren oder zu hinterfragen. Die Selbstreflexion führt zu theologischen, aber auch zu politischen Überlegungen und zu Aktivismus. Klassikerinnen der Religionswissenschaft wie Elizabeth Cady Stanton sind ein prägnantes Beispiel für eine solche Veränderung, die durch ein kritisches Nachdenken und eine frauenspezifische Aneignung der biblischen Narrative angestoßen wird.24 Wissenschaftliche Konzepte entstehen aus diesen Reflexionen und formen sich durch sie weiter aus.