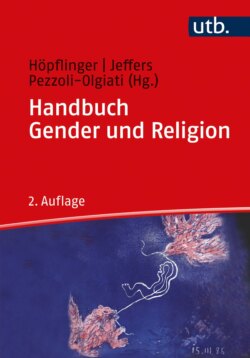Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 23
2 Die verwirrende Komplexität des Gender-Begriffes
ОглавлениеIn den letzten Jahrzehnten haben sich Gender-Forschungen zum Teil auch in der Religionswissenschaft mit einer solchen Rapidität entwickelt, dass es für Neuanfänger(innen) auf diesem Gebiet recht schwierig ist, die vielen, hoch abstrakten Theorien, Standpunkte und Argumente zu begreifen. Sich hier Wissen und einen Durchblick zu verschaffen, kann mit einem Gang durch ein unbekanntes Labyrinth verglichen werden. Das Abenteuer lohnt sich, doch es geht nicht ohne Geduld, Entschlossenheit und Engagement. Persönliches Selbstverständnis und Identität werden mit auf die Reise genommen und unter Umständen stark verwandelt. Es ist also nicht ohne Risiko, sich auf diesen kritischen Weg zu begeben!
Warum? Weil Gender keine selbstverständliche, »natürliche« Kategorie ist, sondern sich auf gesellschaftliche und historische Konstruktionen bezieht, die erst einmal kritisch untersucht und erkannt werden müssen. Vor dem 20. Jahrhundert gab es die Kategorie Gender im analytischen und theoretischen Sinne überhaupt nicht. Ursprünglich diente der Begriff Gender in den Sprachwissenschaften zur geschlechtlichen Unterscheidung verschiedener Wörter. Die Sozialwissenschaften haben das Wort Gender als erste adaptiert und seinen Sinn auf die gesellschaftliche Differenzierung zwischen Männern und Frauen angewandt. Sie haben begonnen, Identitäts-, Autoritäts- und Machtunterschiede kritisch zu hinterfragen. Die kanadische Religionswissenschaftlerin Randi R. Warne (2000) spricht von der Notwendigkeit, dass unser Bewusstsein zuerst eine »gender-kritische Wendung« machen müsse, bevor wir die dynamischen Perspektiven der Gender-Beziehungen klar erkennen und kritisch evaluieren können.
Gender ist eine labile Kategorie. Sie besitzt keine klaren, definitiven Grenzen, sondern sie kann sich verändern und wechselnde Bedeutungen annehmen. Gender ist jedoch immer eine Kategorie, die mit dem Bestimmen verschiedener gesellschaftlicher Rollen zusammenhängt. Sie prägt persönliche Identität und Weltanschauung. Randi R. Warne (2001) und andere Autorinnen sprechen daher von engendering. Dies ist ein aktives Verb, das mit menschlichen Handlungen verbunden werden kann. Gender und Religion sind also nicht einfach zwei parallel zu behandelnde Substantive, die unabhängig voneinander existieren, lediglich verbunden durch das Wort und. Ganz im Gegenteil, beide sind ineinander eingebettet. Es ist deshalb oft schwierig, Gender in Religion zu identifizieren und klar herauszuarbeiten, zumindest solange das Bewusstsein nicht eine definitive gender-kritische Stufe erreicht hat.
Was in der Einleitung von Gender-Studien von Christina von Braun und Inge Stephan beschrieben wird, gilt auch für Gender-Studien in der Religionswissenschaft:
Geschlechterforschung zu studieren bedeutet, auf ein Fach und dessen Wissenskanon einen »Blick von außen« zu werfen. Das kann dazu führen, dass sich die Studierenden innerhalb der einzelnen Disziplin »fremd« fühlen. Andererseits gibt es kein anderes Studiengebiet, das so wie die Gender-Studien in alle Wissens- und Wissenschaftsbereiche hineinführt […] Der interdisziplinäre bzw. transdisziplinäre Ansatz der Gender-Studien bedeutet auch, dass es keine feste Methodik gibt. Die Gender-Studien greifen vielmehr die verschiedenen Methoden in den einzelnen Disziplinen auf, arbeiten mit ihnen, modifizieren sie und entwickeln sie so weiter, dass sie für die Gender-Fragestellungen produktiv gemacht werden können.3
Die Entwicklung der Gender-Studien ist mit einem zweifachen Paradigmenwechsel verbunden.4 Der erste Wechsel geschah, als sich Frauenstudien (Women’s Studies), die sich aus der historischen Frauenbewegung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hatten und hauptsächlich phänomenologisch deskriptiv und empirisch orientiert waren, in eine stärker kritisch reflektierte, feministische Orientierung umwandelten. Diese führte wissenschaftlich zu einem neuen Durchbruch und neuem Wissen. Der zweite Paradigmenwechsel folgte, als manche feministischen Ansätze als zu eng und einseitig erkannt und gender-kritische Theorien entwickelt wurden, die sich mehr inklusiv mit den verschiedensten Geschlechterrollen, -identitäten, -beziehungen und unterschiedlichen Machtpositionen von Frauen und Männern beschäftigten. Kritische Gender-Studien über Männer und Religion sind von feministischen Theorien mitbeeinflusst und haben neue Forschungsperspektiven entdeckt, die sich zum Beispiel mit dem Verständnis männlicher Identität, dem Verhältnis zwischen männlicher Sexualität und Spiritualität oder mit dem männlich überdeterminierten traditionellen Gottesbegriff im Judentum und Christentum auseinandergesetzt haben. Doch trotz allem Fortschritt sind Gender-Studien über Männer viel weniger weit entwickelt als solche über Frauen. Da letztere einen größeren gesellschaftlichen und ideengeschichtlichen Rückstand aufzuarbeiten haben, ist hier ein kritisches Gender-Denken viel notwendiger. Ein solches hat jedoch auch Konsequenzen für Männer. Dennoch kann es noch lange dauern, bis Männer den Vorsprung der Frauen auf dem Gebiet der Gender-Studien aufgeholt haben werden. Bis jetzt ist die Männlichkeit noch nicht in demselben Ausmaß wie die Weiblichkeit kritisch theoretisiert worden.
Wie steht es nun mit spezifischen Gender-Perspektiven in der Religionswissenschaft?