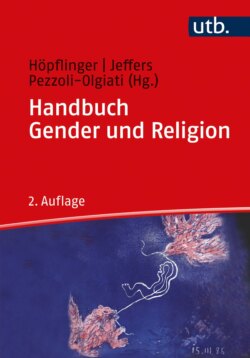Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 35
6 »Scheintod« der Objektivität?
ОглавлениеDie frühere Forderung nach einem »wissenschaftlich objektiven Standpunkt« wurde aus verschiedenen Lagern scharf kritisiert und mit unterschiedlichen Akzentuierungen als Ausdruck von Antifeminismus, Eurozentrismus, Kolonialismus und Imperialismus zusammengefasst.20 Nähert man sich der Religionswissenschaft aufgrund ihrer Geschichte, dann leuchten die unter den verschiedenen Etiketten aufgeführten Kritiken ein, ist doch die Religionswissenschaft maßgeblich als Produkt der europäischen Religionsgeschichte zu verstehen.21 Als solche ist sie in den theoretischen Annahmen, in den Methoden sowie in der Auswahl an religionsgeschichtlichen Fragestellungen von vielen christlichen, theologischen und/oder westlichsäkularen Begriffen und Sichtweisen geprägt. Das Beispiel der Ausblendung der Rolle der Frau in der Forschung und in den erforschten Bereichen kann hier synekdotisch als pars pro toto angeschaut werden. Diese Kritiken haben viel geleistet im Hinblick auf die Aufdeckung der Systemfehler der »klassischen« Religionswissenschaft in ihren Hauptströmungen, wobei die religionsphänomenologischen Zugänge am meisten Kritik einstecken mussten und in Extremfällen zum Sündenbock einer ganzen Disziplin deklariert wurden.
Problematisch finde ich die Kritiken, die in »-ismen« zusammengefasst werden, wenn sie auf keine Strategien hinweisen, wie man folgendem Dilemma entweichen könnte. Denn einerseits kann man nicht mehr in der naiven Haltung der objektiven Sicht verweilen, andererseits kann man auch nicht so leicht aus einer wissenschaftlichen Tradition heraustreten, die unsere Methoden und Weltbilder – auch nach einer Auseinandersetzung mit der Kritik – nach wie vor maßgeblich formen.
Nimmt man die Kritik an der Objektivität passiv wahr, so kann man von einem »Scheintod« dieser Art von Annäherung an religiöse Symbolsysteme sprechen. Ich möchte dieses Dilemma mit Zitaten aus zwei bekannten Handbüchern, die 1988 erschienen sind, illustrieren. Ohne zu zögern lehnt man folgende Haltung als Idealbild für den Forscher oder die Forscherin ab:
[…] Der unbeteiligte Zuschauer schaltet nämlich das beteiligte Ich ab. Das Ich begehrt, was es nicht hat, und was es hat, fürchtet es zu verlieren. Solange wir bewusst sind, bleiben wir unbeteiligt: weder Begehren noch Furcht können sich in uns ausbreiten. Dann haben wir uns selbst vergessen und sind frei, wahrhaft objektiv zu sehen, was sich uns zeigt.22
Stattdessen neigt man eher zu Folgendem:
Neben dem methodischen Zugang zum Phänomen der Religionen, der die eigene Verwurzelung in einer Religion zum methodischen Ausgangspunkt macht, steht die andere Möglichkeit, von Anfang an eine größtmögliche methodische Distanz zum eigenen Standort einzuführen. Methodische Distanzierung bedeutet nicht Ausschaltung. Es ist selbstverständlich, dass auch in diesem Fall die Religion des eigenen kulturellen Kontextes ein Vorverständnis von Religion überhaupt schafft, welches man nicht hinter sich lassen kann.23
Der Verfasser des zweiten Zitats hat keine Mühe damit, die Befangenheit des eigenen Blickes einzugestehen. Problematisch ist hier allerdings, dass die »größtmögliche methodische Distanz« nicht näher umrissen wird. Nach welchen Kriterien kann man wissen, ob man den erwünschten Grad an Distanzierung erreicht hat? Liegt dies im Ermessen des Einzelnen, dann droht entweder die Rückkehr zur naiven Haltung, der man keine standfesten Alternativen entgegenzusetzen vermag,24 oder es schleicht sich eine Art methodische Willkür ein, in welcher alles, was als größtmöglich distanziert deklariert wird, auch als solches zu gelten hat.