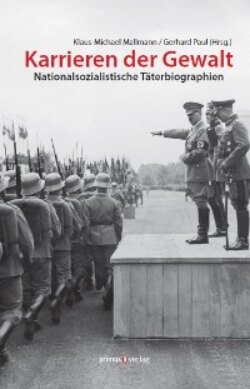Читать книгу Karrieren der Gewalt - Группа авторов - Страница 13
Typen, Trends, Tendenzen
ОглавлениеSichtbar wird ein breites Spektrum der Einbindung in den Vernichtungskrieg, angefangen von der Sachbearbeiterin im Judenreferat, dem Mitarbeiter der Konzentrationslager-SS, dem Führer einer Feldgendarmerieabteilung, dem Kommandoführer eines Polizeibataillons und dem Befehlshaber der Ordnungspolizei, dem Inspekteur der Vernichtungslager, dem Gestapo-Chef in Minsk, dem Kommandeur eines SS-Kavallerie-Regimentes, dem Führer eines Kommandos zur Partisanenbekämpfung bis hin zu den Chefs der Sonder- und Einsatzkommandos, dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und dem Höheren SS- und Polizeiführer. Bei etlichen von ihnen handelte es sich um mobil agierende Multifunktionäre der Vernichtung an den verschiedensten Einsatzorten. Die Qualifizierung und Bewährung beim (Juden-)Mord wiederum eröffneten neue Einsatzmöglichkeiten und oftmals einen weiteren Karrieresprung. Zu den Männern dieser Gruppe zählte etwa Zapp, der es vom Führer des Sonderkommandos 11a schließlich zum Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in Dresden brachte. Dazu gehörte auch Ehrlinger, der bereits 1939 als SD-Führer im Stab der Einsatzgruppe IV an zahlreichen Massenmorden in Polen, 1941 dann als Leiter des Sonderkommandos 1b an Massenmorden in Litauen beteiligt war, bevor er anschließend zum Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Generalbezirk Kiew, zum Chef der Einsatzgruppe B, zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Rußland-Mitte/Weißruthenien und schließlich gar zum Amtschef I im Reichssicherheitshauptamt aufstieg.
Deutlich wird in den Lebensbildern dieses Bandes zugleich ein differenzierteres Täterprofil. Männer wie Gaier, Hamann, Krüger oder Pallmann erscheinen nicht länger als gehorsame und willenlose Exekutoren einer Weltanschauung, als gefühlslose Befehlsautomaten, sondern als engagierte Profiteure der Tat, als Männer, die vergewaltigten, ihren Spaß hatten, sich bereicherten, sich Sonderzuteilungen erwirtschafteten usw. Wie Augenzeugen später aussagten, sei ein Mann wie Walter Nord „mit ‚Freude‘ und ‚Eifer‘ bei der Sache“ gewesen. Erst hierdurch erhielt der rassistische Terror seinen Schwung und seine ungebremste Dynamik, verzahnten sich die ‚großen‘ utopisch-weltanschaulichen mit den ‚kleinen‘, ganz banalen privaten Zielen, wurde Eigennutz zur Antriebsfeder bei der Realisierung der rassistischen Utopie. Aber auch bei den Täter(innen) an den Schreibtischen ging das Engagement vielfach über bloßen Diensteifer und Pflichtbewußtsein hinaus, wie Elisabeth Kohlhaas für Slottke nachweisen kann. Der von Daniel Jonah Goldhagen den Deutschen pauschalisierend als Antriebsmotiv unterstellte eliminatorische Antisemitismus ist dagegen nur bei Hamann, Zapp, Bechtolsheim, Krüger, Szymanowski, Dirlewanger, Wirth und Koch zweifelsfrei nachweisbar. Allerdings bleiben gerade hier eindeutige Grauzonen. Denn das Bekenntnis zu „Rassenhaß“ in Vernehmungen – und dies sind nun einmal die ausgiebigsten Quellen zu einer Person – bedeutete strafrechtlich auch die Positionierung als Täter mit eigenem Willen, mit der man zugleich die juristische Attestierung „niedriger Motive“ riskierte und wurde darum – spätestens nach Intervention des Verteidigers – vermieden. Gleichwohl fällt es schwer, sich etwa einen Ehrlinger ohne diese weltanschauliche Komponente vorzustellen.
Typologisiert man die hier vorgestellten Täter nach Verhalten bzw. Motiven, so werden mindestens fünf Tätertypen deutlich.
(1) Bei einem Mann wie Adolf von Bomhard etwa handelte es sich weniger um einen radikalen Nationalsozialisten als vielmehr um einen willigen politischen Konformisten, um einen „band wagon Nazi“ (Michael Mann), der im Sinne des Wortes „Opportunitas“ nach 1933 die gute Gelegenheit ergriff, Karriere zu machen. Allerdings waren auch solche Opportunisten keineswegs frei von rassistischen Überzeugungen und Ressentiments, wie sie später vielfach Glauben machen wollten.
(2) Demgegenüber repräsentierten Täter wie Erich Ehrlinger und Paul Zapp den Typus des Weltanschauungstäters, der genau wußte und tat, was er wollte. Im Zentrum ihres Tuns stand das nationalsozialistische Projekt der rassischen Neuordnung Europas. Dafür war man auch bereit, bürgerliche Karriere und erlernten Beruf zu opfern. Daß Weltanschauungstäter zugleich auch Exzeßtäter sein konnten, zeigt das Beispiel von Hans Krüger.
(3) Männer wie Oskar Dirlewanger, Hans Gaier und Heinrich Hamann waren typische Exzeßtäter, Hardcore-Nazis, die keine Befehle brauchten. In Hamann, so Klaus-Michael Mallmann, „begegneten sich der Ideologe und der Profiteur, der Türöffner und der Trittbrettfahrer der ‚Endlösung‘, kreuzten sich Überzeugung und Eigennutz, der Vollzug einer Weltanschauung und der Rausch grenzenloser Macht“. In Dirlewanger, einem sadistischen, amoralischen Alkoholiker, hatte nach Knut Stang „das ohnehin verbrecherische NS-Regime seinen vielleicht extremsten Henker“ gefunden.
(4) Den reinen Schreibtischtäter („bureaucratic killer“) repräsentiert in unserem Sample Gertrud Slottke, die Sachbearbeiterin im Amsterdamer Judenreferat. Elisabeth Kohlhaas hat deren Tatbeitrag als „Selektion durch Bürokratie“ gekennzeichnet und aufgezeigt, daß auch dieser Tätertypus keineswegs von antisemitischen und rassistischen Ressentiments frei war und keineswegs nur auf Befehl handelte, sondern den Prozeß der Vernichtung mit Engagement und eigenen Vorschlägen vorantrieb. Dasselbe traf auch auf Bechtolsheim zu, der zwar nicht selbst Hand anlegte, wohl aber eindeutig ideologisch motivierte Befehle dazu erteilte.
(5) Sehr viel häufiger anzutreffen war eine Mischung aus Schreibtisch- und Direkttätern, aus Vordenkern und Vollstreckern, wie Jürgen Matthäus für Georg Heuser und Konrad Kwiet für Paul Zapp exemplarisch zeigen können. Führer, so Michael Wildt mit Blick auf Erich Ehrlinger, „entwarfen nicht nur politische Konzepte, sie formulierten nicht allein Erlasse, sondern sie erteilten die Befehle auch vor Ort und sorgten dafür, daß die Praxis der ‚Idee‘ entsprach“. Wie so oft erweisen sich auch hier Mischformen und das Prozeßhafte als charakteristischer als die reinen Idealtypen. Beispielhaft zeigt dies Rudolf Pallmann, der sich vom Befehlstäter über den Inititativtäter, der durch selbständige Taten den Vernichtungsvorgang in Betrieb hielt, schließlich zum Exzeßtäter entwickelte, der in reiner Willkür und aus niederen Motiven Menschen zu Tode brachte.
Alle Beiträge dieses Bandes thematisieren zugleich die Karrieren der Täter und Täterinnen in der deutschen Gesellschaft nach 1945. Abhängig von den Zeitläuften lassen sich auch hier verschiedene Muster erkennen, die allerdings auf keinen gemeinsamen Nenner zu bringen sind und nur zeigen, wie komplex und widersprüchlich, wie mühsam, aber letztlich erfolgreich sich die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gestaltete.
(1) Entgegen der landläufigen Annahme erwies sich die sogenannte Festung Nord um den letzten Regierungssitz des NS-Regimes in Flensburg-Mürwik auch für unsere Klientel als bedeutsames Rückzugsrevier.63 Wie Heinrich Himmler, Rudolf Höß, die Führung der Oranienburger Inspektion der Konzentrationslager und ganze Abteilungen des Reichssicherheitshauptamtes suchte auch von Gottberg in den ersten Maitagen 1945 dort Zuflucht. Zusammen mit anderen Teilen der RSHA-Führung hatte sich auch Ehrlinger nach Schleswig-Holstein abgesetzt, dort wie weitere 2000 ehemalige SS-Offiziere und Gestapobeamte seine SS-Uniform mit der eines Wehrmachtsunteroffiziers getauscht und sich einen falschen Namen zugelegt. Schließlich schlugen sich auch Szymanowski und Hamann dorthin durch. Während Hamann abtauchte, wurde Szymanowski in Neumünster von britischer Feldpolizei festgenommen. Seetzen befand sich auf dem Weg nach Eutin, als er auf dem Bahnhof Hamburg-Altona erkannt wurde.
(2) Das gewalttätige Ende der Täter blieb die Ausnahme. Wirth war bereits im Mai 1944 von Partisanen erschossen worden. Dirlewanger starb im Juli 1945 an den Folgen eines Übergriffs von polnischen Wachsoldaten in der französischen Besatzungszone. Von Gottberg beging wie etliche seiner SS-Kameraden in Flensburg Selbstmord. Seetzen wählte ebenfalls den Freitod, nachdem man ihn in Hamburg festgenommen hatte. Maximal dürften sich etwa 5 Prozent des höheren SS- und Gestapo-Personals einer Strafverfolgung durch Selbstmord entzogen haben.64 Koch erhängte sich 1967 in der Strafvollzugsanstalt. Gegen einige wenige NS-Täter sprachen alliierte Gerichte Todesurteile aus, von denen allerdings nur ein Bruchteil zur Vollstreckung kam. In unserem Sample wurde allein an Tessmann das von einem britischen Militärtribunal gefällte Todesurteil 1948 vollstreckt.
(3) Eine Gruppe von höherrangigen Tätern tat es ihrem obersten Vorgesetzten Himmler gleich und nahm bei Kriegsende eine neue Identität an.65 Hamann schlug sich bis 1951 unter dem Namen ‚Hoßfeld‘ durch; als er nach Inkrafttreten des Grundgesetzes nicht mehr an Polen ausgeliefert werden konnte, zeigte er sich wegen falscher Namensführung selbst an, ohne jedoch bestraft zu werden. Ehrlinger tauchte bis 1952 unter falschem Namen zunächst in Schleswig-Holstein, dann in Baden-Württemberg unter. Zapp lebte gar 22 Jahre lang unter falschem Namen ganz in der Nähe seines Geburtsortes im hessischen Bebra, wo man ihn vermutlich kannte, aber unbehelligt ließ.66
(4) Der größte Teil der hier vorgestellten Täter und Täterinnen schlug nach 1945 eine normale bürgerliche Karriere ein. Etliche von ihnen mußten sich niemals strafrechtlich verantworten.67 Zu ihnen zählte von Bomhard, der lange Zeit als Erster Bürgermeister in Prien am Chiemsee agierte und über das Image eines voll in die Gesellschaft der Bundesrepublik integrierten Ehrenmannes verfügte. Bechtolsheim gelang es gar, seine Schuld auf ehedem Untergebene abzuwälzen. Nachdem Ehrlinger 1952 aus der Illegalität aufgetaucht war und seinen bürgerlichen Namen wieder angenommen hatte, war er als Leiter einer VW-Vertretung tätig. Eine 1961 ausgesprochene zwölfjährige Zuchthausstrafe mußte er wegen Vollzugsunfähigkeit nicht angetreten. Lombard, 1955 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassen, brachte es zum Versicherungskaufmann. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde 1970 eingestellt. Wenn es richtig ist, daß die beschriebenen Gewaltmilieus die Wirkung situativer Sozialisationsagenturen entfalteten, wird auch verständlich, daß mit dem Zerfall und der Zerschlagung dieser Milieus die Beteiligten – gewiß mit Verzögerungen und Schwierigkeiten – wieder an ihre begonnenen bürgerlichen Karrieren anknüpfen konnten und fähig waren, sich in der Mehrzahl durchaus erfolgreich in den Alltag der bundesdeutschen Demokratie einzufädeln.
(5) Vor allem der Polizeidienst der 1950er und 1960er Jahre erwies sich als Hort und Reintegrationsinstanz der ‚alten Kämpfer‘ und NS-Täter.68 Pallmann war bis zu seiner Suspendierung 1963 im Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Dort wurde auch Nord 1956 wieder in die Polizei eingestellt. Bevor die Staatsanwaltschaft rechtliche Schritte gegen ihn einleiten konnte, verstarb der ehemalige Chef der 1. Kompanie des Polizeibataillons 316. Bergmann fand 1955 eine Anstellung beim Bundeskriminalamt. Heuser, 1954 aufgrund Artikel 131 des Grundgesetzes als Kriminaloberkommissar in den Staatsdienst von Rheinland-Pfalz übernommen, avancierte 1958 gar zum Leiter des dortigen Landeskriminalpolizeiamtes.69
(6) Ein Teil dieser Männer war aktiv in die Versuche der politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung ihrer ehemaligen Kameraden in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft involviert. Hamann etwa hielt Kontakt zu alten SD-Kollegen sowie zu Dr. Werner Best, der im Zentrum dieser Bemühungen agierte.70 Von Bomhard wirkte über etliche Jahre als Experte der „Fachvertretung der 131er Polizeiberufsbeamten“ vor Gericht sowie als Gutachter tatkräftig an der Legendenbildung von der ‚sauberen‘ Ordnungspolizei mit. Daß man sich gegenseitig ‚Persilscheine‘ ausstellte, versteht sich schon fast von selbst. Als Chef des LKA Rheinland-Pfalz oblag Heuser u.a. die Fahndung nach NS-Verbrechern, zu denen er selbst zählte. Die Unterstützernetze reichten bis weit in die Verwaltungen der Nachkriegszeit hinein. Der Oberkreisdirektor des Kreises Mettmann etwa engagierte sich wiederholt für den verurteilten Massenmörder Pallmann. Einige Männer tummelten sich weiterhin am rechten Rand wie etwa Krüger, der sich politisch für die Deutsche Partei und den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten engagierte, oder Lombard, der weiterhin zu seinen ehemaligen SS-Kameraden Kontakt hielt und sich hochbetagt von Hunderten von Angehörigen der Waffen-SS feiern ließ.
(7) Mehr als die Hälfte der den Krieg und die Nachkriegszeit überlebenden NS-Täter und Täterinnen unseres Samples wurde von alliierten und deutschen Gerichten zu langen Freiheitsstrafen verurteilt, die allerdings nur in einigen Fällen bis zum Ende verbüßt wurden. Ein sowjetisches Militärgericht hatte Lombard bereits 1947 zu einer 25jährigen Lagerhaft verurteilt; er wurde 1955 dann aber begnadigt und in die Bundesrepublik entlassen. Szymanowski war 1948 im Nürnberger Einsatzgruppenprozeß zum Tode verurteilt worden, ohne daß die Strafe allerdings vollstreckt wurde; 1958 wurde er aus dem Landsberger Kriegsverbrechergefängnis entlassen. Zill, Hamann, Krüger und Zapp wurden zwischen 1955 und 1970 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Doch weder Zill noch Hamann mußten ihre Strafen voll verbüßen. Das Urteil gegen Zill wurde 1961 aufgehoben und in eine 15jährige Zuchthausstrafe umgewandelt, auf die die gesamte Untersuchungs- und Strafhaft angerechnet wurde; bereits zwei Jahre später wurde er entlassen und kehrte zu seiner Familie nach Dachau zurück. Koch, ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt, verbrachte mehr als 20 Jahre in verschiedenen Haftanstalten, bevor sie sich 1967 das Leben nahm. Eine der höchsten Strafen vor einem bundesdeutschen Gericht erhielt 1969 Pallmann. Das Düsseldorfer Landgericht verurteilte den Massenmörder von der Krim wegen gemeinschaftlichen Mordes zu sechsmal lebenslangem Zuchthaus. Gegen Heuser sprach das Landgericht Koblenz 1963 unter Anrechnung der Untersuchungshaft eine 15jährige Zuchthausstrafe aus; bereits 1969 stimmte dasselbe Gericht der Haftentlassung des ehemals obersten Kriminalpolizeibeamten von Rheinland-Pfalz zu. Slottke schließlich, 1967 zu fünf Jahren Haft verurteilt, saß krankheitsbedingt nur einen Teil ihrer Strafe ab. Reder hingegen verbüßte seine Strafe in voller Länge und saß von 1948 bis 1985 in italienischen Gefängnissen ein.