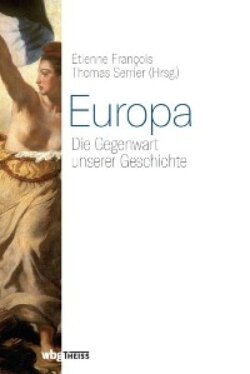Читать книгу Europa - Группа авторов - Страница 15
Französische Ambivalenzen
ОглавлениеDiese Vorsicht zeugt vielleicht auch von einer gewissen Ambivalenz, von einer Ungewissheit hinsichtlich des zweckdienlichsten Bildes von Napoleon in einer Zeit, in der die Öffentlichkeit weniger akzeptiert, dass man den Krieg glorifiziert und einen Sieg bejubelt. In den letzten Jahren hat sich diese Ambivalenz aufgrund der Frage der ethnischen Integration noch verstärkt: Die afrikanischen und die antillischen Gemeinschaften Frankreichs erinnern sich heute hauptsächlich an Napoleon als denjenigen, der in den Kolonien die Sklaverei wieder eingeführt hat und den atlantischen Sklavenhandel wieder beleben wollte. Claude Ribbe, einer der zahlreichen antinapoleonischen Polemiker, ist noch weiter gegangen und hat Napoleon vorgeworfen, in den Französischen Antillen ganze Bevölkerungen aus rassischen Gründen ausgerottet zu haben. Obwohl Ribbe das Ausmaß dessen, was er als die „Verbrechen“ Napoleons bezeichnet, übertrieben hat, hat er eine diesbezüglich wesentliche Frage gestellt: Kann er für die multikulturelle Welt des 21. Jahrhunderts einen zufrieden stellenden Helden abgeben, für eine Welt, in der Toussaint Louverture und die „schwarzen Jakobiner“ von Haiti vermutlich eine größere Popularität und Wertschätzung genießen?
Diese Ambivalenz verweist auch auf die anhaltenden Spaltungen innerhalb der politischen Kultur in Frankreich, wo das Gedenken Napoleons seit dem 19. Jahrhundert starke politische Akzente angenommen und systematisch das jeweils an der Macht befindliche Regime widerspiegelte. Die Monarchie der Restauration war bestrebt, jede Anspielung auf den abgesetzten Kaiser zu verbieten, und beauftragte Polizisten und Spitzel, diejenigen zu melden, die die Erinnerung an ihn hochhielten. Die Julimonarchie hingegen war bemüht, sein Ansehen noch zu erhöhen, indem sie sich mit seiner Erinnerung verband: Louis-Philippe hat sich bei seiner Krönung mit vier Marschällen des Kaiserreichs umgeben, bevor er 1834 in Paris die Vendôme-Säule und 1846 den Triumphbogen einweihte, zwei Denkmäler zu Ehren Napoleons. Und 1848, nach einer weiteren Revolution in Paris, knüpfte das französische Volk an die napoleonische Tradition an, indem es Napoleon III. zum Präsidenten wählte, bevor sich, um das berühmte Wort von Karl Marx zu verwenden, die Geschichte als Farce wiederholte, als sich 1852 der Präsident im Anschluss an einen militärischen Staatstreich zum Kaiser krönen ließ.
Das Zweite Kaiserreich war, wie zu erwarten, der Höhepunkt des Napoleon-Kults, es waren die Jahre, in denen es am zulässigsten war, auf den Dienst in der Armee Napoleons stolz zu sein, und in denen auch die von den Offizieren der Großen Armee verfassten Memoiren ganz besonders in Mode waren. Doch mit der Wiedereinsetzung der Republik nach 1870 ging Frankreich rasch wieder auf Distanz zu der kaiserlichen Legende. In der Moderne verankert sie sich fest in einer republikanischen Tradition, die auf die Bewahrung der Ideale von 1789 Wert legt. Zum ersten Mal seit dem Tod Napoleons trennt sich der Napoleon-Mythos von der Politik. Man konnte nostalgisch sein, ohne Bonapartist zu sein: Man konnte sich zurücksehnen nach dem Ruhm, nach einer verlorenen Welt. Die Gemälde, die Édouard Detaille in den Jahren 1880–1890 angefertigt hatte, veranschaulichen sehr gut die Stimmung der Jahrhundertwende, die damals in Frankreich herrschte. Man konnte nunmehr Napoleon als eine historische Figur darstellen, die über den politischen Kontingenzen stand, als einen patriotischen Helden, dem Republikaner wie Royalisten nachstreben konnten – als einen Staatsmann, einen Soldaten und vor allem als einen Menschen.