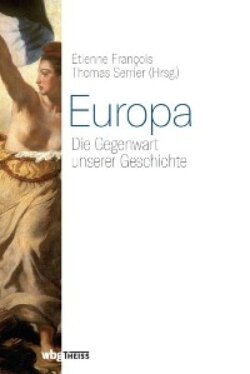Читать книгу Europa - Группа авторов - Страница 7
OLAF B. RADER UND PIERRE MONNET Einführung:
Was wir teilen, was uns trennt
ОглавлениеErster Akt: Im Rathaus von Stockholm, das zwischen 1911 und 1923 im Stil der venezianischen Renaissance errichtet wurde, befindet sich der berühmte „Goldene Saal“, der bewusst einem Langhaus der Wikingerzeit nachempfunden ist, in dem wohl einst die Stammesversammlungen der freien Männer (Thing) abgehalten wurden. Dessen Nordwand schmückt ein riesiges Mosaik, das die Königin von Mälar zeigt, der Orient und Okzident huldigen. Mälar ist der alte Name von Stockholm, das am Ufer des gleichnamigen Sees liegt.
Zweiter Akt: Vor Kurzem zeigte eine junge englische Wissenschaftlerin anhand archäologischer Forschungen, dass Wikinger aus Skandinavien am Ende des 8. Jahrhunderts in Ost-Anglien nicht nur, wie es die Legende will, an Land gingen, plünderten und sich wieder zurückzogen, sondern, dass sie Lager errichteten, Handel trieben, die Gegend erkundeten und sich schließlich – so wie es auch die „Barbaren“ am römischen limes taten – mit der Bevölkerung mischten. Daraus entstand ein Jahrhundert später das „Danelaw“, das Land des „dänischen Gesetzes“. Nichts belegt die Vermischung besser als das damals praktizierte Währungssystem, das einer parallelen Zirkulation entsprach: Es gab zum einen die Geldstücke, die von den angelsächsischen Königen geprägt wurden, zum anderen einen Geldumlauf nach Gewicht, also in Barren und ausländischen Münzen, die in Stücke geschnitten wurden. Diese Praxis herrschte in ganz Skandinavien. Sie war aber nichts anderes als die Übernahme eines in der islamischen Welt entwickelten Systems, in dem zwar der Dirham geprägt, dann aber nach standardisierten Gewichtsvorgaben unterteilt wurde.
Das Fresko des „Goldenen Saals“ von Stockholm zeichnet die lange und komplexe Geschichte der skandinavischen Wikinger vom 8. bis zum 11. Jahrhundert nach. Diese dehnten sich bis nach Russland, bis ans Schwarze Meer und zum Byzantinischen Reich aus. Sie prägten England und die nördliche und westliche Hälfte Frankreichs, kolonisierten Island und Grönland, drangen ins Mittelmeer vor und berührten die Küsten des iberischen al-Andalus sowie Sizilien. Sie erreichten sogar auch jenen Kontinent, der später den Namen Amerika erhalten sollte.
Was aber ist davon im europäischen Gedächtnis erhalten, in Schulbüchern, in den verschiedenen nationalen Erinnerungen und in volkstümlichen Vorstellungen? Eigentlich nichts, mit Ausnahme vielleicht des Hörnerhelms, den die Skandinavier allerdings niemals trugen und der eine Erfindung Richard Wagners war. Es gibt kein europäisches Narrativ, das nachhaltig die negative Legende von den brutalen Eroberern korrigierte, den Plünderern von Klöstern, heidnischen Piraten, die schamlos über den Reichtum der latinisierten, dann fränkischen Provinzen herfielen, von Stämmen, die so heillos zerstritten waren, dass die Eroberungen, die sie machten, lediglich der Lösung ihrer inneren Streitigkeiten dienten. Kurz, das war eine sehr rohe Welt – das Gegenteil also dessen, was die Gelehrten von damals und dann unsere neuzeitlichen Historiker als die eigentliche Wiege des römisch-christlichen und zivilisierten Abendlands betrachteten. Ein überzeugender Beleg für dieses Manko ist die seit zwei Jahrzehnten anhaltende Retrowelle der nordischen Sagas und Mythen im Kino, in der Literatur und in Spielen, oft untermalt mit Musik aus Wagners Opernzyklus Ring des Nibelungen. Hierbei handelt es sich wohl um eine Flucht nach vorn oder um einen Ersatz für die vermeintliche Entzauberung der Welt der Postmoderne.
Wie das Beispiel der Wikinger deutlich macht, wird das Wahre oft mithilfe des Falschen erkannt und von der Peripherie her erschließt sich der eigentliche Kern. Diese Anhäufung von Orientierungsmarken und ihre Widerspiegelung im neuzeitlichen Gedächtnis, diese Verschachtelung und das Hin und Her zwischen Fiktion und Realität, Selbstbild und Fremdbild, die das kleine nordische Beispiel deutlich macht – gerade das ist es, was dieser zweite Band aufzeigen möchte. Es geht hier also um alles andere als ein einheitliches Europa, sondern vielmehr um die Vielfalt und Widersprüche unseres Kontinents.
Von dieser Pluralität zeugt jeder einzelne der im Folgenden in einer Langzeitperspektive und in ihren vielerlei Facetten untersuchten Gegenstände. Das sind Städte mit ihren zahlreichen Schichten wie etwa Byzanz/ Konstantinopel/Istanbul oder Vilnius/Wilno/Wilna/Vilne. Es sind chamäleonartige Personen wie der französische, deutsche, polnische, englische und russische Napoleon oder der römische und ägyptische Caesar, der griechische und indische Alexander und schließlich die österreichischen, belgischen, spanischen und amerindianischen Habsburger. Es sind Städte, die Kreuzungspunkte darstellen: Venedig und Sankt Petersburg, die zusammen mit den Isthmen des Balkans, der Adria und des Baltikums die europäische Halbinsel eingrenzen und aus der Geschichte des Kontinents die seiner Grenzen machen, seien sie nun ganz konkrete oder aber Phantomgrenzen – von der gefallenen Berliner Mauer, einer mentalen Grenze, bis zum Grenzort der Katastrophe, dem Unort Tschernobyl.
Um dieses plurale Europa ganz zu ermessen, wird sich der Leser auf eine Reise einlassen müssen, die von Heldenfiguren zu solchen der Verdammnis führen wird, von bewohnten in erdachte Landschaften, von der Regression zur Transgression, von sorgfältig aufgezeichneten zu erfundenen Sprachen, von verblendeten zu verzehrenden Leidenschaften. Die Liste der behandelten Gegenstände macht deutlich, dass ihre Auswahl sich daran orientierte, inwieweit die Europäer ihnen im Lauf der Zeit die Fähigkeit zu vielfacher Brechung und Beugung zugeschrieben haben. Sehen wir uns nur die großen Persönlichkeiten an, die ausgewählt wurden: Sie alle – vom Tyrannen bis zum Genie – verbinden sich in exemplarischer Weise mit Momenten, die im Guten wie im Schlechten das Europäertum auf unterschiedliche Grundlagen stellen: auf Eroberungen (Gaius Iulius Caesar und Napoleon Bonaparte), auf die Sprache (William Shakespeare), die Wissenschaft (Marie Curie), den Krieg (Johanna von Orléans, Winston Churchill), Nachdenken über sich selbst, um die Welt besser zu erfassen (Leonardo da Vinci, Johannes Gutenberg, Erasmus von Rotterdam). Das erfolgt jeweils offen oder unbewusst an der Grenze von nationaler Aneignung, europäischer Legende und globaler Dimension.
Diese Mehrdimensionalität findet sich auch in der Art und Weise wieder, wie man an den Raum der verschiedenen Europas, so wie er hier abgesteckt ist, herangeht. Das ist zum einen der vereinheitlichte Binnenraum von Stadt und Land, Kirchen und Plätzen, aber auch der drei Stände, die allesamt nach jahrhundertelanger Sedimentierung einen starken Eindruck des Vertrautseins vermitteln, der sogar noch deutlicher wird, wenn man das Ganze von außen betrachtet. Das ist zum anderen der fragmentierte Raum der Konfessionen, des Katholizismus und der Reformationen, die noch zu der Spaltung in römisches und griechisches Christentum hinzutreten, die das Jahr 1054 symbolisiert, aber auch die Linie, die die katholischen Weinländer von den protestantischen Hopfenländern trennt. Da ist der von Meeren umgrenzte Raum, vom Mittelmeer natürlich, aber auch von den Meeren des Nordens, mit Orten der Zirkulation wie Sankt Petersburg, Amsterdam, Venedig und Istanbul. Es geht auch um Flüsse und Berge, die zu Mauern oder Festungswällen werden können, zu Appellen, sie zu überschreiten, zu Aufforderungen zur Migration bis hin zum höchsten Nomadentum des wandernden Juden, dessen ewige Wiederkehr jedes Mal die Frage nach der europäischen Identität aufwirft. Es geht hier natürlich nicht um die Erstellung eines vollständigen Inventars, aber mithilfe der Typologie der behandelten Fälle will dieser Teil von den verschiedenen Europas sprechen, von deren Ängsten (von der Pest über den Wolf bis zum Teufel) und Mythen, die oft von literarischem Austausch geprägt sind, von Wiederverwendung und Übersetzung (Faust, Carmen, Don Quichotte, die Märchentradition), von den Emotionen (von der Liebe bis zum Tod, der Sinnsuche und den Träumen) und den Grenzen dieses pluralen Europas. In all diesen Verbindungen von Sinn und Form verbindet sich das unvermischte Eigene, das Indigene, mit dem Gemischtem, dem Hybriden.
Personen, Orte, Weltbilder, gemeinsame und umstrittene Begriffe tauchen auf und es ist Sache jedes Einzelnen – so wie die des Pilgers nach Santiago de Compostela –, seinen eigenen Weg unter den hier versammelten „Erinnerungsorten“ zu finden. Es mag ja gemeinsame Erinnerungen geben, doch können diese nicht das Ergebnis einer von den Historikern gegebenen Anweisung sein, sie müssen vielmehr aus der Art hervorgehen, in der jeder Leser sich die 50 Essays aneignet, aus denen dieser Teil besteht, und jeder einzelne bedeutet ein spezielles Eintauchen in die Tiefen einer immer noch lebendigen Geschichte.
Die Architektur, die für diesen zweiten Band gewählt wurde, weist alle Vor- und alle Nachteile einer kollektiven Auswahl auf, für die ein Team verantwortlich zeichnet, dessen Autoren glücklicherweise aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Sprachen zwischen Atlantik, Mittelmeer und Ural kommen. Ein Teil der ausgewählten Gegenstände mag überraschen, Fragen aufwerfen. Warum Churchill und nicht Karl der Große? Weshalb ein Kaiser und nicht ein Papst? Warum Shakespeare und nicht Dante Alighieri? Weshalb die beiden Meere und nicht die beiden Ozeane? Warum Prag und Sankt Petersburg und nicht Wien? Dieser Liste der fehlenden Stichwörter und Namen könnte man noch andere Leerstellen hinzufügen: die bedeutenden Monumente, die großen Texte, die wichtigen Daten … Eine enzyklopädische Zusammenstellung hätte natürlich dieses Werk angereichert, sie hätte aber seine Grundlinie, seinen Geist nicht geändert und auch nicht die Art der Reflexion, deren Leitgedanke es war, die verschiedenen Europas zugleich von innen und von außen zu betrachten. Damit wird es möglich, ein dreifaches Gedächtnis mit seinen einzelnen Schichten zu erfassen: das zeitgenössische, das sedimentierte und das reflektierte Gedächtnis.