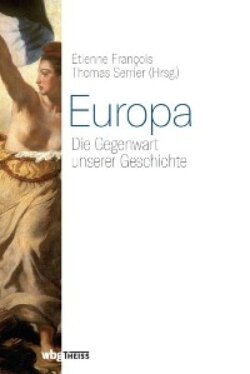Читать книгу Europa - Группа авторов - Страница 34
Theatermaschinen
ОглавлениеWährend seiner Mailänder Zeit (1482–1499) wird die Ingenieursarbeit Leonardos von drei Haupttätigkeiten bestimmt, die auch hier mehr politischen Bedürfnissen als persönlicher Entscheidung entsprechen. Die erste betrifft den umfangreichen Ausbau der lombardischen Wasserwirtschaft, wofür Leonardo Zustandsberichte verfasst und sich Systeme von Schleusen, Wasserstandsregulierungen der Kanäle oder der Auffangbecken ausdenkt, die ihre Instandhaltung sicherstellt. Die zweite Tätigkeit betrifft die Konzeption von Maschinen für die Textil- und Metallindustrie und hat so einen Anteil an den großen Bemühungen um die Mechanisierung der Arbeit in der lombardischen Hauptstadt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die dritte ist mit der Prachtentfaltung des Hoflebens verbunden, die Leonardo inszenierte, wobei die Fürsten insbesondere seine Erfindungsgabe in Sachen „Spezialeffekte“ schätzten. Bühnenbilder, Kostüme, Automaten: Wenn sie nicht dazu dienten, Krieg zu führen, dann waren Leonardos Maschinen oft Theatermaschinen.
So erging es zum Beispiel seinem berühmten „Automobil“: Als der Wissenschaftler Girolamo Calvi 1905 im Folio 812 des Codex Atlanticus in Mailand die Zeichnung eines mechanischen Wagens entdeckte, dachte er sofort, es handle sich um den Plan eines Autos. 1935, in einem Klima eines übersteigerten Chauvinismus und der überspannten Begeisterung für das technische Genie Italiens, ist die Zeichnung bereits berühmt und Calvi nennt sie „Leonardos Fiat“. Man entwarf ein Modell nach dieser Zeichnung und dieser Nachbau wurde auf der 1939 von Benito Mussolini persönlich geförderten großen Ausstellung Leonardo und die italienischen Erfindungen im Palazzo delle Arti in Mailand präsentiert. Dieses Modell wurde ein Jahr später auf dem Transport dieser Ausstellung nach Tokio zerstört, aber von diesem ersten Modell stammen alle anderen ab, die noch lange in den Museen, besonders im Clos-Lucé und in Vinci, gezeigt wurden. So genau das Modell der Zeichnung Leonardos entsprach, so wenig fahrtüchtig war es: Ohne Motor hatte es nicht die geringste Chance, Fahrgäste zu befördern. Denn die Zeichnungen von Leonardo enthalten meistens weder Maßstab noch Angaben über die Energiequelle. Erst viel später, im 21. Jahrhundert, verstand man, dass diese Zeichnung kein Transportmittel darstellte, sondern einen kleinen programmierbaren, von einem Uhrwerk angetriebenen Roboter, der dazu dient, Automaten in Bewegung zu setzen.
Doch kann man das Genie Leonardos nicht einfach auf seine Talente als Bastler zurückführen. Seit seiner Begegnung 1496 mit dem berühmten Mathematiker Luca Pacioli, dessen Traktat De divina proportione er illustrierte, bemüht sich Leonardo darum, das empirische Sammelsurium an aufgehäuftem Wissen auf ein Wissen zurückzuführen, das durch die mathematischen Regeln der Mechanik vereinheitlicht wird. Das ersieht man am allgemeinen Erscheinungsbild des 1966 in der Nationalbibliothek von Madrid entdeckten Codex, der auf eine viel geordnetere und hierarchisierendere Weise als in seinen üblichen Skizzen das präsentierte, was er in euklidischer Manier seine „Maschinenelemente“ nannte. Leonardo bringt hier eine Reihe von Zeichnungen ins Reine, die systematisch Maschinen und Mechanismen darstellen, von der Schraube bis zum Zahnrad, von den Dichtungen bis zu den Scharnieren, von der Kette zum Flaschenzug. Er fügt diesen Darstellungen präzise Kommentare bei, in denen er die Charakteristiken dieser Mechanismen beschreibt, ihre Kraft abschätzt, ihre Reibungen misst. Sie werden heute als Muster der modernen technischen Zeichnung betrachtet, die „Sezierbilder der Maschinen“ in der Art des Anatomen, der er ebenfalls war, präsentieren.