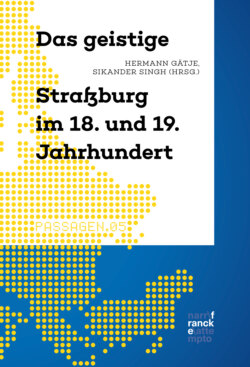Читать книгу Das geistige Straßburg im 18. und 19. Jahrhundert - Группа авторов - Страница 12
III.
ОглавлениеDass das Stück das Lächerliche des Aberglaubens aufdeckt, zeigt sich ebenso in der Anlage der Figuren: Bis auf die beiden Studenten entstammen alle auftretenden Figuren der niederen Welt des Handwerks. Die Darstellung des beruflichen Lebens und alltäglichen Treibens dieser sogenannten einfachen Leute und ihres durchaus örtlichen Gepräges deutet bereits auf die Lokalkomödien Carlo Goldonis oder Ramón de la Cruz’ voraus, die im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts in ganz Europa Popularität erlangten.1
Den poetologischen Vorstellungen der Zeit entsprechend, erfolgt die Belehrung der Zuschauer über Fehler und Tugenden durch Kontraste: Dem (Aber)Glauben des Spenglers, der in dem sein Haus und seine Werkstatt heimsuchenden Lärm das Wirken eines Poltergeistes zu erkennen glaubt, werden Einschätzungen zweier „studirende[r] fremde[r] Cavalliers“ gegenübergestellt, die in ihren Gesprächen das Unwissen und die Naivität des Handwerksmeisters reflektieren und kommentieren. So wendet sich der Spengler Simplicius im dritten Auftritt des ersten Aktes mit der Klage an seine Lehrbuben:
Behüt uns … ihr lieben Kinder / ihr habt es ja selbst gesehen und gehöret und sehet uñ höret es noch stündlich / das der leidige abgesagte Feind deß menschlichen Geschlechts vor ein entsetzliches Wesen in meinem Hauß anstellet. Ich armer und darzu mit dem vermaldedeyten Podagra geplagter Handwercks Mann weiß mich nicht deß geringsten Verbrechens zu erinnern / dadurch ich mir den Himmel oder die Hölle so auffsässig solte gemacht haben. Betet ihr Bursch vielleicht nicht fleißig und richtig?2
Die Anrede offenbart neben der (falschen) Überzeugung des Handwerkers, dass die Störungen in seinem Haus von einer höheren Macht verursacht werden, die Glaubensgewissheit, dass die Erscheinungen eine Strafe für Fehlverhalten sind und somit durch Gebete und Sühneopfer wieder aufhören werden.
Das schlichte Gemüt des Spenglers, das auf diese Weise sichtbar wird, kommt auch in seinem Namen zum Ausdruck, der als Hinweis auf das Wesen seines Trägers zu lesen ist (und auf diese Weise zugleich die Tradition des Abentheuerlichen Simplicissimus Teutsch von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen aufruft). Diese Haltung wird mit derjenigen eines der Studenten konfrontiert, der nicht an überirdische Mächte glaubt, sondern eine strikt rationale Erklärung des „Schießens“, also des im Haus des Handwerkers auftretenden Lärms vertritt:
Die Zeit wird den Außgang bringen / und dieser die Wahrheit offenbahren. Ich finde bey diesem Schießen nichts / als was durch menschliche Geschicklichkeit kan zuwegen gebracht werden. Wann ich überwießen solte seyn / daß der Teuffel oder eine abgestorbene und noch vor ihrer letzten Ruh wieder zurück gewiesene Seel oder auch gar eine himmlische Gewalt diese Unordnung anrichtete / so müßte ich dergleichen geschossene Sachen sehen / die der gemeine Verstand nicht begreiffen könne; Zum Exempel / frembde Thiere / Vögel / Schlangen und dergleichen / wiewohl auch noch dieses durch abgefeimte und angestellte Betrüger zu erzwingen wäre.3
Ein nicht nur inhaltlich, sondern auch quantitativ bedeutender Aspekt des Stückes sind jene Dialoge, welche entweder das Unerklärliche der Erscheinungen betonen und somit auf überirdische Mächte als deren Urheber verweisen, oder darlegen, inwiefern menschliche Manipulationen als Ursachen der Geräusche und Zerstörungen in dem Haus des Handwerkers angesehen werden müssen und daher Appelle an die Vernunft der Zuschauer sind.
Das Straßburger Bühnenstück weist damit charakteristische Momente des Lust- oder Freudenspiels im Spannungsfeld von Barock und Frühaufklärung auf: Die Personen sind solche, um auf eine Wendung Georg Philipp Harsdörffers zurückzugreifen, „die in gemeinen Burgerlichen Leben zu finden“ sind,4 und die Belehrung des Zuschauers über richtiges (tugendhaftes) und falsches (lasterhaftes) Verhalten erfolgt, indem letzteres dem Gelächter preisgegeben und mit dem Vorbild des ersteren kontrastiert wird, wie Albrecht Christian Rotth in seinem Werk über die Poesie erläutert:
So ist demnach die neue bey uns itzo gebräuchliche Comödie nichts anders als ein solch Handelungs-Spiel / in welcher entweder eine lächerliche oder auch wohl löbliche Verrichtung einer Person / sie sey wer die wolle / sie sey erdichtet oder aus den Historien bekannt / mit vielen sinnreichen und lustigen Erfindungen auffgeführet und abgehandelt wird / daß entweder die Zuschauer die Fehler und Tugenden des gemeinen menschlichen Lebens gleichsam spielweise erkennen und sich bessern lernen / oder doch sonst zu einer Tugend auffgemuntert werden.5