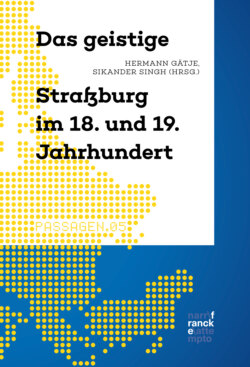Читать книгу Das geistige Straßburg im 18. und 19. Jahrhundert - Группа авторов - Страница 7
I.
ОглавлениеDie unterschiedlich langen, meist zwischen zwölf und sechzig Seiten umfassenden Thesendrucke, die im institutionellen Kontext akademischer Disputationsveranstaltungen veröffentlicht wurden, sind, zumindest was den deutschen Kulturraum betrifft, als außerordentlich ergiebige Quellen für die interdisziplinäre kultur- und wissenschaftshistorische Forschung klassifiziert worden.1 Um den Quellenwert des Mediums richtig einschätzen zu können, muss man sich allerdings einige Funktionsbedingungen des frühneuzeitlichen Universitätsbetriebs klar machen. Wissenschaftsgeschichtlich gesehen, markiert die Zeit um 1800 einen Paradigmenwechsel. Wenn man von der Moderne aus die Schwelle zur Frühen Neuzeit überschreitet, also in das 18. Jahrhundert und weiter zurück blickt, fallen besonders drei Aspekte gelehrter Beschäftigung auf, die dem heutigen Forscher befremdlich erscheinen mögen: Zum einen ist die umfangreiche, kohärente und vom gelehrten Nachwuchs eigenständig verfasste Monographie in jener Zeit zwar eine Option, doch nicht der Regelfall eines Thesendruckes. Neben Schriften mit echtem Abhandlungscharakter, die aus Forscherperspektive grosso modo natürlich die ergiebigeren sind, waren auch knappe Reihungen unverbundener Thesen (sogenannte theses nudae) verbreitet. Zwischen diesen Extremen sind alle überlieferten Drucke zu verorten. Im Zusammenhang mit der auffälligen Struktur der Dissertationen steht eine Vorstellung von akademischer Lehre, die der Rekapitulation gelehrten Wissens gegenüber einer innovativen Forschungsleistung den Vorrang einräumt. Auch hier gab es freilich unterschiedliche Ansätze, und es wurde unter den Zeitgenossen darüber diskutiert, welchen Status die Thesendrucke im Hinblick auf ihr innovatives Potential im Vergleich mit anderen Formen der Wissensliteratur besaßen. Der Pädagoge Sigmund Jakob Apin (1693 bis 1732) stellte das Forschungspotential dieses Genres heraus:
Viele Gelährten kommen bey Untersuchung der Warheit auf neue Gedancken, wollen aber deswegen nicht gleich gantze Bücher und Tractate schreiben, sondern geben ihre neue Meinung in forma Disputationis heraus.2
Schließlich ist zu beachten, dass die an einer Disputation beteiligten Personen sich zwar um eine überzeugende Argumentation bemühten, nicht aber um wissenschaftliche Neutralität im modernen Sinne. Waren Fragen der theologischen oder verhaltensethischen Positionierung Gegenstand der Debatte, lag eine Voreingenommenheit der Akteure gewissermaßen in der Luft, aber selbst bei historisch-philologisch angelegten Untersuchungen zeigt sich bisweilen ein eklatanter Kontrast zwischen nüchterner Detailanalyse und affektgeladener Parteinahme für oder gegen die Sache, die verhandelt wurde. Dies hängt einerseits mit der Verankerung des Disputationswesens innerhalb eines durch und durch rhetorisch fundierten Unterrichtskonzeptes zusammen, andererseits ist die Vorstellung von einem zweckfreien Interesse des innerlich unbeteiligten Forschers aus der Perspektive der Frühen Neuzeit ein Anachronismus – auch noch im 18. Jahrhundert, in dem die emphatischen Forderungen einiger prominenter Vertreter der Aufklärung nicht den Maßstab für die gelehrten Positionskämpfe im Allgemeinen bildeten.
Die Fachtermini, die zur Beschreibung des Disputationsaktes verwendet werden, spiegeln die Entstehungs- und Funktionsbedingungen der behandelten Texte. Mit dissertatio wird eben nicht eine Inauguraldissertation modernen Zuschnitts bezeichnet, sondern der Thesendruck, der in metonymischer Ausdrucksweise gelegentlich auch disputatio genannt wird. Verfasser der dissertatio war vielfach der betreuende Professor, der als Präses (praeses) der Disputation vorstand. Der Schüler musste als Respondent (respondens) auf Einwürfe der Opponenten (opponentes) „antworten“, also die Thesen verteidigen. Wenn diese tatsächlich vom Respondenten selbst verfasst waren, wurde dies meist auf dem Titelblatt des Druckes vermerkt, indem seinem Namen der Zusatz „respondens et auctor“ beigegeben wurde – was freilich ebenfalls bedeuten konnte, dass der Respondent den Disputationsakt veranlasste, die Kosten übernahm und so weiter. Im Laufe des 18. Jahrhunderts scheint der Anteil der vom Respondenten verfassten Dissertationen zugenommen zu haben, ohne dass dieser Befund bisher statistisch zuverlässig erfasst worden wäre.3
Thesendrucke sind, wie schon gesagt, von kultur- und wissenschaftshistorischer Relevanz. Sie dokumentieren die Konjunktur von Diskursen und Autoritäten. Sie geben Hinweise darauf, welche Fragen mit welchen Argumenten im Rückgriff auf welche Referenztexte und in Auseinandersetzung mit welchen Gegenpositionen an welchen Universitäten mit welcher praktischen Zielsetzung behandelt wurden. Die folgende Untersuchung führt vor, in welcher Weise die im 18. Jahrhundert virulente Frage nach der Legitimation von Widmungsschriften von genau jenen Personen verhandelt wurde, die allfällige aus der Debatte resultierende Konsequenzen zu gewärtigen hatten.