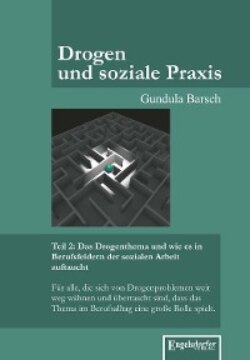Читать книгу Drogen und soziale Praxis - Teil 2: Das Drogenthema und wie es in Berufsfeldern der sozialen Arbeit auftaucht - Gundula Barsch - Страница 10
Was sind empfohlene Trinkmengen?
ОглавлениеBereits im ersten Band dieser Reihe wurde erörtert, welche Einseitigkeiten sich ergeben, wenn einzig am Kriterium der konsumierten Substanzmenge ein Urteil gefällt würde, ob ein Missbrauch vorliegt oder nicht (vgl. Drogen und soziale Praxis, Bd. 1, 2010, S. 93-108). Mit dem Fokus auf Alkoholfolgekrankheiten werden jedoch in der Tat rein medizinische Aspekte des Alkoholkonsums in den Blick gerückt. Insofern ist auch die Frage berechtigt, ab welcher Menge ein regelmäßiger Alkoholkonsum Erkrankungen auszulösen vermag. Die Antwort darauf könnte sehr simple und eindeutig sein, ist sie aber nicht!
Empfehlungen müssen realitätsgerecht sein
In den letzten dreißig Jahren haben sich die Limit-Empfehlungen für den regelmäßigen Alkoholkonsum von Männern, Frauen und Jugendlichen mehrfach geändert. Sie sind dabei immer weiter nach unten korrigiert worden. Weltweit kursieren heute diverse Angaben zu medizinisch begründeten Mengengrenzen, deren Einhaltung empfohlen wird, um das Risiko körperlicher Folgeerkrankungen zu vermeiden:
Die Empfehlungen der WHO für unschädlichen Alkoholkonsum betragen für gesunde Männer täglich 40 g und für gesunde Frauen und Jugendliche 20 g reinen Alkohol.
Die Britische Ärzteschaft (Britisch Medical Association) definiert eine kritische Tagesmenge reinen Alkohols von 30 g für gesunde Männer und 20 g für gesunde Frauen.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde National Institut on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAA) verweist sogar auf eine kritische Menge von 24 g bei gesunden Männern und 12 g bei gesunden Frauen (zit. nach Klingemann et al. 2004).
Deutlich wird, dass sich die Empfehlungen zu Grenzwerten für einen Alkoholkonsum, durch den das Entstehen alkoholbedingter somatischer Erkrankungen verhindert werden kann, gravierend unterscheiden.
Empfehlungen zu Trinkmengen sind immer auch Ideologie
Dies ist keineswegs nur auf einen veränderten Wissensstand zurückzuführen. Zu bedenken ist zugleich, dass solche Richtlinien auf angenommenen Wahrscheinlichkeiten basieren, mit der die benannten Ereignisse eintreten könnten. Die sehr unterschiedlichen Empfehlungen berufen sich also auf verschiedene Erkrankungswahrscheinlichkeiten. Konsequent zu Ende gedacht könnten derartige Empfehlungen also beispielsweise auch darin gipfeln, überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Dann wäre zu 100 % ausgeschlossen, dass sich die vorliegenden Erkrankungen auf den Konsum von Alkohol zurückführen lassen. Popularisierte Mengenempfehlungen sind also immer auch von Normativen, sozialen Konventionen und Ideologien mitbestimmt.
Merkenswert: Unter den Experten gibt es keineswegs Einigkeit bei den Empfehlungen zu Mengen für einen regelmäßigen und dennoch unschädlichen Alkoholkonsum. Die popularisierten Limits unterscheiden sich zum Teil gravierend. Sozialarbeiter müssen deshalb entscheiden, welche Empfehlungen sie ihrer Arbeit zugrunde legen wollen.
Auch hier kann als Empfehlung gelten, sich an realitätsgerechten Limits zu orientieren1. Dies beinhaltet immer auch die Chance darauf verweisen zu können, dass durchaus auch Grenzwerte popularisiert werden, die weit limitierender sind, als die gewählten.