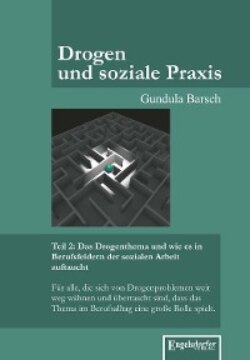Читать книгу Drogen und soziale Praxis - Teil 2: Das Drogenthema und wie es in Berufsfeldern der sozialen Arbeit auftaucht - Gundula Barsch - Страница 8
1.2.1Voraussetzungen für professionelles sozialarbeiterisches Handel: Eigene Klärungsprozesse
ОглавлениеDie Mitwirkung an der Prävention und Behandlung von Alkoholfolgeerkrankungen setzt allerdings voraus, dass sich jeder Sozialarbeiter klare Positionen erarbeitet, wie er sich zum Thema „Alkoholfolgekrankheiten“ verhalten will. Dieser individuelle Klärungsprozess ist oft schwerer als vermutet und hat verschiedene Themen/Ebenen.
Erstens bewegen sich auch Sozialarbeiter in der extremen Ambivalenz, mit der der Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft verhandelt wird: In der Regel wird er verklemmt zwischen der hohen positiven Bewertung des „Trinkens“ an sich und der starken Abwertung von „Trinkern/Säufern“ diskutiert. Sozialarbeiter müssen sich zu diesem Spannungsbogen verhalten und mit realitätsgerechten Positionen Modelle anbieten, die Genuss, Spaß und Vergnügen erlauben, für negative physische, psychische und soziale Konsequenzen sensibilisieren und auf ein sachgerechtes Risikomanagement verweisen.
Zweitens muss ein Sozialarbeiter darauf vorbereitet sein, dass derjenige, der den Alkoholkonsum anderer thematisiert, immer auch riskiert, dass das eigene Trinken ebenfalls angesprochen wird. In solchen Situationen lenken Verweise auf einen asketischabstinenten Trinkstil auf Ausnahmen, die in unserer Kultur selten vorkommen, von der Masse der Menschen aber weder erstrebt noch geschätzt werden. Sie sind in den notwendigen Auseinandersetzungsprozessen deshalb oft auch nicht hilfreich. Auch hier sind realitätsgerechte Modelle nützlicher.
Drittens muss ein Sozialarbeiter damit rechnen, dass sein Bemühen um Prävention und Behandlung von Alkoholfolgekrankheiten mit der Begründung zurückgewiesen wird, dass der Alkoholkonsum eine „rein private Angelegenheit“ sei, weshalb der Klient strikt jeden Hinweis als Einmischung zurückweist. Dies geschieht immer dann mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn auf Seiten des Sozialarbeiters fachliches Wissen fehlt und deshalb eine Veränderung des Trinkens mit moralischen Attitüden eingefordert wird, die das Recht auf Genuss in Frage stellen und stattdessen Askese fordern. Derartige Zurückweisungen lassen sich oft mit dem Verweis aufweichen, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass übermäßiger Alkoholkonsum Alkoholfolgeerkrankungen auslösen kann. Auch eine Aufklärung zu dem verbreiteten Irrtum, nachdem Alkoholfolgekrankheiten nur auftreten würden, wenn jemand zugleich alkoholabhängig sei, könnte die Bereitschaft fördern, sich mit Unterstützung des Sozialarbeiters mit dem eigenen Trinkverhalten auseinanderzusetzen.
Erkennbar wird, dass Einsicht und Mitwirkung an einer Änderung des Trinkens sehr davon abhängen, dass die Hinweise und Motive des Sozialarbeiters zum Thema Alkoholkonsum sachlogisch und weitestgehend ohne moralische Vorwürfe vorgetragen werden.