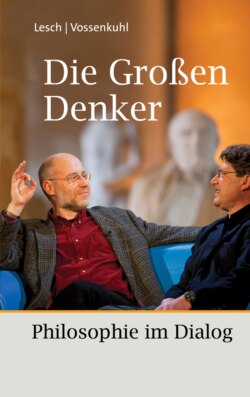Читать книгу Die Großen Denker - Harald Lesch - Страница 12
Heraklit (544-484 v.Chr.) & Parmenides (540-470 v.Chr.)
ОглавлениеHeraklit
Parmenides
Vossenkuhl:
„Es ist nicht möglich, zweimal in denselben
Fluss zu steigen. Immer ist alles im Flusse. Es fließe das All nach Flusses Art.“
Das ist ein Zitat aus dem kargen Nachlass, der uns von Heraklit erhalten ist. Er wird auch „Der Dunkle“ genannt.
Lesch:
Der Rätselhafte.
Vossenkuhl:
Geboren in Ephesus, neben Milet eine der größeren Städte Kleinasien an der Küste. Man kann heute noch sehen, wo der große Artemis-Tempel stand. Er fiel einem Brandstifter zum Opfer.
Heraklit war also wieder ein Kleinasiate und noch dazu aus bestem Hause. Antiker Adel und mit der Priesterkaste familiär eng verbundenen.
Lesch:
Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Er hat sich nicht wie viele andere seiner Vorgänger mit den Dingen in der Natur beschäftigt. Er war eher ein Metaphysiker. Er hat sich das alles angeschaut und dann hat er gesagt: Das Werden und Vergehen, das ist das Prinzip, von dem alles herrührt. Die Veränderung.
Das ist in gewisser Weise genau mein Mann, auch wenn er dunkel und rätselhaft erschien.
Ich weiß, dass er ein ziemlich schwieriger Mensch war. Wenn die Fragmente stimmen, die wir von ihm haben, dann hat er den Satz: Wer keine Feinde hat, hat keinen Charakter, überaus ernst genommen. Er hat sich ja offenbar nur Feinde gemacht. Seine Umwelt hat er gnadenlos verachtet. Über viele seiner Mitbürger ist er hergezogen. Am liebsten hätte er sie alle einen Kopf kürzer gemacht. Ein unfreundlicher Zeitgenosse.
Vossenkuhl:
Er war felsenfest davon überzeugt, dass die meisten Menschen nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Da könnte er vielleicht gar nicht mal so sehr daneben gelegen haben - natürlich nur auf seine Zeit bezogen.
Lesch:
So rigorose Denker gibt es ja heute auch noch. Hoffen wir, dass die sich wenigstens etwas irren.
Vossenkuhl:
Wir zwei sind doch schon einmal ein Hoffnungsschimmer, oder? (Hust hust!)
Heraklit würde gut in unsere Zeit passen. Er hat viel von Elite gehalten, adlige Herkunft eben. Die Dinge, für die er sich interessierte, sind ja auch nicht so leicht zugänglich.
Lesch:
Aber das, was ich anfangs zitiert habe, das klingt doch nach einigem Nachdenken so, dass man sagen kann: Ja, der Mann hat recht.
Vossenkuhl:
Da hast auch Du wiederum recht, mein lieber Harald.
Lesch:
Ich bin halt ein alter Rechthaber, verändere mich aber ständig dabei. Du übrigens auch. Wir beide verändern uns ständig. Selbst wenn nur eine Sekunde vergangen ist, könnte man das ganz wörtlich nehmen und schauen, was von dem Willi vor einer Sekunde noch übrig ist. Mensch, da hat sich ja schon wieder dieses und jenes getan. Das kann man doch mal so festmachen.
Die Veränderung ist was ganz Grundsätzliches. Das merken wir an uns selbst von einem Tag zum anderen. Der Fluss fließt, wobei erstmal das Flussbett bleibt. Obwohl sich das ja auch im Laufe der Zeit verändert. Das Wasser des Flusses allerdings verändert sich ständig. Es sind immer andere Teilchen, mit denen der Schwimmer, wenn ich das mal physikalisch ausdrücken darf, wechselwirkt.
Insofern hatte unser Mann schon einen tiefen Einblick und ziemlich recht. Warum dann diese Ablehnung? Hat er noch andere Dinge gedacht, die für seine Mitmenschen so verstörend und absurd waren?
Vossenkuhl:
Ich glaube, das Schwierige bei Heraklit ist, dass er als „Archae“, also als Urgrund und Grundprinzip eben das Werden annimmt. Und das ist natürlich schwer greif- und begreifbar. Man kann sich zwar vorstellen, dass sich alles in Veränderung befindet. Aber jedes Ding hat zumindest in den Phasen der Veränderung seine Identität. Selbst wenn man sich manchmal morgens beim Rasieren – was bei Dir offensichtlich nicht so häufig der Fall ist – frägt: Ist das da im Spiegel noch derselbe von gestern? Trotzdem zweifelt man nicht daran, dass man einen guten, alten Bekannten rasiert.
Lesch:
Es gibt gewisse Formen, die nur kleineren Abweichungen in langen Zeitintervallen unterworfen sind. Trotzdem ist das Prinzip der Veränderung um mich herum überall ständig im Gange.
Früher hatte man gedacht, der Himmel, die Dinge am Himmel seien ewig. Da sprach man von Fixsternen. Das ist heute längst erledigt. Wir wissen, dass Sterne entstehen und irgendwann auch vergehen, abhängig von ihrer Masse. Wir wissen sogar, dass das Universum einen Anfang hatte. Wir wissen allerdings nicht, was davor war. Es ist uns aber glasklar, dass Entwicklungsprozesse für unser Universum der Normalfall sind. Da bleibt nichts so wie es ist.
Vossenkuhl:
Das müsste Dich ja eigentlich ganz stark interessieren. Der Heraklit hatte diese Idee, dass es Weltenjahre gibt. Ein Weltenjahr sollte acht Millionen Sonnenjahre umfassen.
Lesch:
Da weiß man nicht so genau, woher das kommt.
Unsere Weltenjahre sind … na ja gut, unsere Sonne braucht 220 Millionen Jahre, um einmal um das Zentrum der Milchstraße herum zu kreisen.
Die Milchstraße ist hunderttausend Lichtjahre im Durchmesser. Unsere Sonne bewegt sich mit der gesamten galaktischen Scheibe – eine Spiralgalaxie - um das Zentrum der Milchstraße.
Vossenkuhl:
Wie oft noch?
Lesch:
Ach, das macht die schon noch ein paar Mal. Die hat ja noch viereinhalb Milliarden Jahre Zeit. Wenn da zwischendurch nichts passiert, dann wird sie das auch weiterhin tun.
Vossenkuhl:
Aber wir gehen doch davon aus, dass alle Sterne und Planeten solcher Galaxien wie der unseren jeweils von einem Schwarzen Loch verschluckt werden?
Lesch:
O nein, o nein. Unsere Milchstraße endet nicht so schnell. Mensch, Du hast vom Schwarzen Loch im galaktischen Zentrum gehört? Ich will jetzt nicht von Heraklit ablenken. Aber jetzt bin ich überrascht! Ein Philosoph und das Schwarze Loch!
Du hast auch noch recht. Da ist eines im galaktischen Zentrum! Mit zwei Millionen Sonnenmassen auch ein recht großes, ein ordentliches Schwarzes Loch. Sein unmittelbarer Einflussbereich reicht allerdings nicht bis zu unserem Sonnensystem. Da brauchen wir uns für die nächsten Jahre keine Gedanken zu machen.
Vossenkuhl:
Dann können wir also beruhigt weiter philosophieren. Sag aber an, Sternendeuter: Warum dreht sich das Ganze um ein Schwarzes Loch?
Lesch:
Zusammen mit der galaktischen Scheibe hat die Sonne eine bestimmte Rotationsenergie. Diese Kraft hält sie davon ab, in das Zentrum der Milchstraße hinein zu stürzen. Das ist ein bisschen so wie bei den Planeten, die um die Sonne kreisen. Die tun das auch nur, weil die Gegensätze - die eine Kraft zieht nach außen, die Schwerkraft zieht nach innen - hier wirksam sind.
Interessant ist, dass Heraklit die Gegensätze ganz stark in sein Denken einbezogen hat. Da hat er ein weiteres Mal auf das richtige Pferd gesetzt.
Vossenkuhl:
Das ist erstaunlich. Der wusste natürlich nichts von Schwarzen Löchern. Aber diese Attraktion und Repulsion, das Anziehen und Abstoßen, das war ihm klar. Dass sich Gegensätze nicht einfach ergänzen, sondern sich gegenseitig hervorrufen und erhalten.
Das ist schon ein tiefer Gedanke. Heraklit hat ja noch einige andere Kernsätze formuliert. Einer, der heute ein bisschen missverständlich ist:
„Der Krieg ist der Vater aller Dinge.“ Aber Polemos kann nicht einfach mit Krieg übersetzt werden. Es ist vielmehr die Auseinandersetzung, der Kampf. Eigentlich muss man besser sagen: Der Kampf, die Auseinandersetzung ist der Grund oder Auslöser aller Dinge.
Lesch:
Es reicht ja oft schon eine gehaltvolle Diskussion.
Vossenkuhl:
Ein gutes Gespräch, das gerne kontrovers verlaufen kann.
Lesch:
Im Grunde genommen ist ja das Heraklit’sche Denken sehr demokratisch. Man tauscht Argumente aus. Nicht einer entscheidet, was zu passieren hat. Es geht immer darum, mit der Umgebung in Wechselwirkung zu treten.
Vossenkuhl:
Ja gut. Den Gedanken kannst Du hier natürlich anfügen. Aber faktisch hat unser Mann den zu seinen Lebzeiten herrschenden Demokraten abgesägt, wie man heute sagen würde.
Lesch:
Abgesetzt? Der passte ihm wohl auch nicht?
Vossenkuhl:
Ganz und gar nicht. Der musste verschwinden. Er hat einen anderen eingesetzt. Heraklit war ein ganz mächtiger Mann. Er hatte in Ephesos schon einiges zu sagen.
Lesch:
Ich finde es erstaunlich, dass jemand in einer solchen, sagen wir mal privilegierten Position sich Gedanken über das Ganze in der Welt macht.
Wir haben ja schon über andere Vorsokratiker gesprochen, also die Philosophen vor Sokrates. Und hier ist wieder so einer, der nach der Einheit strebt. Ich habe das Gefühl, dass diese griechischen Philosophen immer nach etwas gesucht haben, was sie nehmen können, in die Tasche stecken und sagen: So, und jetzt marschiere ich los und erzähle allen anderen: Es ist Wasser, es ist Luft, es ist irgendwas. Bei Pythagoras sind es die Zahlen. Bei Heraklit haben wir jetzt wieder so ein Abstraktes:
Alles ist im Flusse.
Vossenkuhl:
Aber anders, als wir es heute verstehen, wenn wir in den Kosmos schauen und uns sagen: Alles bewegt sich mit zunehmender Geschwindigkeit auseinander, in alle Richtungen. Er war der Meinung, dass alles wieder zurück fließt. Also eine ewige Wiederkehr. Die Weltenjahre sind das Maß für Anfang und Ende. Das hat gerade im 19. Jahrhundert sehr viele kluge Köpfe fasziniert. Diese ewige Wiederkehr. Für Nietzsche war das eine Steilvorlage.
Lesch:
Dieses Thema ist dann im 21. Jahrhundert allerdings durch. Das Universum wird nicht wieder in sich zusammenfallen. Im Gegenteil. Man hat eher das Gefühl, dass der Zeitpfeil, der im Universum auftritt, der durch die Expansion zustande kommt, eben nur in eine Richtung zeigt.
Vossenkuhl:
Der lässt sich nicht zurückbiegen.
Lesch:
Nix da. Der ist unbeugsam.
Vossenkuhl:
Aber es gibt trotzdem sehr viele zyklische Überlegungen. Wir haben ja den Jahreszyklus, wir haben den Wachstumszyklus, Verfall, Wiedererwachen usw. Es gibt schon viele Analogien.
Für Heraklit war die Natur - auch er hat natürlich wie alle über die Natur nachgedacht - das Ausgangs-Modell. Dass etwas entsteht und vergeht und dass das immer eine Art von Wiederkehr in den Ursprung ist oder Rückkehr in den Ursprung. Dafür gibt es sehr viel Anschauungsunterricht in der Natur.
Lesch:
Das stimmt. Aber trotzdem würde man doch heute eher von Rhythmen sprechen. Die verändern sich ganz leicht, da ist immer so ein kleiner Unterschied.
Im Großen und Ganzen kommt man schon wieder an einen Punkt zurück, aber trotzdem gibt es winzige Veränderungen. Wenn man sich zum Beispiel mit der Evolutionstheorie beschäftigt, zeigt sich, dass oft kleinste Veränderungen im Laufe der Zeit Neues auf den Weg bringen.
Und dann passiert noch mal etwas Neues, eine winzig kleine Veränderung der ersten Veränderung. Dass also eine Veränderung sich verändert. Diese Gedanken liegen mir als Naturwissenschaftler natürlich sehr nah. Die schmecken mir.
Vossenkuhl:
Das verstehe ich voll und ganz. Du liebst die Veränderung.
Lesch:
Ich kann das nicht immer festmachen, aber es erscheint mir auf jeden Fall der bessere Weg als alles andere. Zu fordern, dass die Dinge immer gleich bleiben, das kann es nicht sein.
Es wundert mich aber, dass Heraklit, der so stark auf Veränderung setzt und das zur Grundlage seiner Philosophie macht, dass der zum Menschenverächter wird. Der hätte doch eigentlich auch die Hoffnung haben können: Na ja, das wird schon noch, das wird schon noch werden. Weil er ja ein Freund des Werdens war. Warum hat er dann die Welt, die um ihn herum war, so verachtet? Er hat sich dann ja auch noch zurückgezogen und ist Eremit geworden.
Vossenkuhl:
Na ja, Eremit ist übertrieben. Er hat sich in den Artemis-Tempel zurückgezogen. Den Priestern übergab er dort seine Schriften. Er hat dann nur noch im Tempel gelebt. Ganz zurückgezogen.
Lesch:
Er wollte nichts mehr mit dem öffentlichen Leben zu tun haben?
Vossenkuhl:
Nein. Das war nicht mehr sein Ding. Totale Verweigerung.
Lesch:
Das finde ich schon erschütternd.
Vossenkuhl:
Dabei hatte er lange Zeit in der Öffentlichkeit eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Ich meine, diesen Politiker abzusägen, das ging wahrscheinlich nicht einfach durch ein Telefonat.
Lesch:
Wie ist das damals gelaufen?
Vossenkuhl:
Er hat das mit den richtigen Leuten eingefädelt. Er war wahrscheinlich ein ausgefuchster Netzwerker.
Lesch:
Also, da stand einer – noch dazu als Machtmensch – voll im Leben. Er hat der Erfahrung der Sinne zugesprochen. Aus diesen Sinneserfahrungen hat er abgeleitet: Es gibt ein Prinzip, mit dem man die Welt verstehen kann. Ohne dass ich gleich Naturwissenschaften betreibe. Ich schaue einfach nur, was da ist. Für Heraklit war der Logos das Prinzip der Veränderung. Kann man das so sagen?
Vossenkuhl:
Das ist das richtige Stichwort: Logos. Logos als Wortursprung, auch Gottheit. Logos ist ein wunderbares Wort. Weil es genau diese metaphysische Komplexität, diese Vielfalt enthält, die man sich nur wünschen kann. Da ist alles drin. Deswegen haben natürlich dann auch die Christen dieses Wort übernommen, vor allem der Evangelist Johannes.
Lesch:
Im Anfang war das Wort.
Vossenkuhl:
„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ So heißt es bei Johannes. Im Grunde genau heraklitisches Denken. Obwohl es bis zum Beginn des Christentums noch einige Jahrhunderte dauerte.
Für Dich als Astrophysiker hat Heraklit noch so einige Schmankerl parat. Er ging von der Kugelgestalt der Erde aus. Er hat gewusst, dass der Mond das Sonnenlicht reflektiert. Er war ein Mann, der auch im wissenschaftlichen Sinne einiges zu bieten hatte.
Lesch:
Hat eigentlich irgendjemand im Altertum tatsächlich geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist? Ah doch! Einer von den Vorsokratikern hat doch tatsächlich die Erde als eine Scheibe gedacht. Ich meine, es war der Anaximenes.
Vossenkuhl:
Thales hat gemeint, dass die Erde schwimmt.
Lesch:
Ja. Eine ziemlich verschwommene Angelegenheit. Als Kugel oder Scheibe?
Vossenkuhl:
Scheibenartig vielleicht? Jedenfalls war die Sonne für Heraklit eine Scheibe.
Lesch:
Ach was?
Vossenkuhl:
Die Sonne war für ihn eine Scheibe, die Licht produziert. Für diese Theorie haben wir noch einen zweiten Kandidaten.
Lesch:
Bevor wir auf den Zweiten kommen, lass´ mich kurz zusammen fassen: Es gibt mehrere Elemente. Wir hatten Wasser, wir hatten schon Luft und wir werden noch die Erde etwas später mitkriegen.
Heraklit war der Mann, der das Feuer zum Prinzip erhob. Er war ein dunkler, feuriger, rätselhafter, sich verändernder Philosoph, und als Mensch ein sehr streitbarer Zeitgenosse.
So, das musste noch gesagt werden, bevor wir zum Nächsten kommen.
Vossenkuhl:
Du erzählst immer in Deinen Vorträgen, dass wir aus Staub, aus Sternenstaub bestehen.
Lesch:
Aus Sternenstaub entstanden sind.
Vossenkuhl:
In großer Hitze erbrütet, ja?
Lesch:
Ganz genau. Eine Höllenhitze. Mehrere Millionen Grad Celsius.
Vossenkuhl:
Kürzlich habe ich mal gelesen, dass jedes Atom in unserem Körper bei mindestens drei Supernova-Explosionen mit dabei gewesen ist.
Lesch:
Ja. Mittendrin. 1. Reihe.
Vossenkuhl:
Ist ja auch interessant, oder?
Lesch:
Wem sagst Du das!
Vossenkuhl:
Das Feuer ist so gesehen natürlich eine wichtige Sache.
Lesch:
Dass man immer wieder auf diese ursprünglichen, von den alten Griechen gedachten Prinzipien zurückkommt. Ich wundere mich stets von Neuem. Ob es nun das Wasser als Urstoff des Lebens ist, oder die Luft, ohne die wir keinesfalls leben könnten. Und das Feuer? Ich glaube, das muss man übersetzen.
Feuer zerstört eigentlich eher etwas. Aber wenn man Feuer als etwas nimmt, was die Sterne antreibt, das Verschmelzen von Atomkernen, die Fusionsenergie, dann ist Heraklit jemand, der nach meinem Dafürhalten die Energie, also die Potenz, dass sich etwas verändert, erkannt hat. Die Fähigkeit, Arbeit zu leisten - damit meine ich jetzt nicht industrielle Arbeit - sondern, dass ein System mechanische Arbeit leisten kann. Das war für ihn das A und das O, dass sich da was tut.
Vossenkuhl:
Genau. Er war ein philosophischer Feuerwerker.
Lesch:
Der Nächste bitte.
Vossenkuhl:
Nun kommen wir zu einem ganz anders gearteten Kopf, aber von ähnlichem Gewicht. Parmenides. Geboren in Süditalien, in einem kleinen Städtchen namens Elea. Dort hat er philosophischen Unterricht genossen, Xenophanes war sein Lehrer, ein Dichter und Denker. Er war der wichtige, erste Mann in Elea. Man kann da heute noch hinfahren, Velia heißt dieses kleine Städtchen südlich von Salerno, am Meer gelegen, selbst heute nicht leicht zugänglich.
Lesch:
Von nichts kommt nichts.
Parmenides war einer, der nach etwas gesucht hat, das sich dem Werden von Heraklit, der Veränderung entzieht.
Vossenkuhl:
Man kann sich eigentlich keinen größeren Gegensatz zu Heraklit denken: Parmenides’ völlige Ablehnung des Werdens. Das Werden, sagt Parmenides, gibt es nicht.
Lesch:
Ist alles Illusion.
Vossenkuhl:
Ja. Es ist einfach nicht. Aristoteles hat diesen Gedanken übernommen, und variiert. Nur das, was ist, von dem kann man sagen, dass es ist. Und von dem, was nicht ist, kann man nur sagen: Es ist nicht. Aber nichts, was nicht ist, ist und nicht was ist, ist nicht. Dieses Prinzip der Seinslehre herrschte dann fast zweitausend Jahre.
Lesch:
Hallo lieber Leser. Sind Sie noch da? Also, Sie sind da, wir sind da. Sie sind, wir sind.
Wenn unsere Leser nicht sind, dann können sie ja von dem Buch nichts mitkriegen.
Ist das so eine saubere Übersetzung?
Vossenkuhl:
Läuft ungefähr darauf hinaus.
Lesch:
O.k. Nur … das war jetzt doch ein bisschen gedankliche Spaghetti-Arbeit.
Vossenkuhl:
Zugegeben. Das war ein bisschen zu abrupt.
Lesch:
Also, Parmenides hat sich mit dem Sein beschäftigt.
Er gilt als der Vater der Ontologie. On heißt Sein.
Und die Ontologie ist die Lehre des Seins. Keine Bange, es wird gleich wieder normal.
Vossenkuhl:
Es ist eigentlich ganz simpel. Zum Beispiel: Dieses Buch ist, Du bist, ich bin. Immer sagen wir: „Es ist“.
Was ist nun all diesen Dingen gemeinsam, die sind? Das ist das Sein. Das ist der gemeinsame Nenner. Es ist eigentlich ganz einfach.
Lesch:
Ja. Aber es wurde dann doch etwas schwieriger. Bei Parmenides war das Sein etwas, das sich selbst nicht verändert.
Das ist praktisch wie eine starre Schablone oder wie ….
Vossenkuhl:
Nein. Fangen wir noch mal bei dem gemeinsamen Nenner an.
Lesch:
O.k. Wir einigen uns jetzt da drauf.
Vossenkuhl:
Es ist doch völlig klar. Wenn wir so etwas haben wie einen gemeinsamen Nenner für alles, was ist, dann kann man sagen: Im Hinblick auf die Tatsache, dass die Dinge sind, kommen sie alle überein. Sie haben also eine Gemeinsamkeit: Sie sind.
Lesch:
Sie sind. Jawohl. So sei es.
Vossenkuhl:
Und dieses Sein, das kann sich ja nicht verändern. Die Dinge verändern sich. Sie entstehen und vergehen. Sie sind und sind nicht. Diese Gemeinsamkeit aber, ihr Sein, das ist der Grundstock. Das kann nicht vergehen. Das ist. Basta.
Lesch:
Das hat also mit meinen Sinnen nichts zu tun.
Vossenkuhl:
Nein.
Lesch:
Worüber wir jetzt reden, das ist begrifflich. Im Gegensatz zur Induktion, bei der wir aus Erfahrung etwas über die Welt mitkriegen, machen wir jetzt eine Deduktion. Wir arbeiten mit Begriffen, um über die Welt mit Hilfe der Logik etwas herauszufinden. Ist es das, was wir tun?
Vossenkuhl:
Ja. Wir können aber auch durch die Induktion über das viele, was ist, zu dieser Deduktion kommen. Denn wir haben nur die Wahrnehmung des Vielen.
Dann können wir sagen: Aha, das ist, das ist, das ist, und das auch. Was ist jetzt das Gemeinsame? Wir reden von allem als seiend.
Wir benutzen überall das gleiche Wort. Es muss dann ja wohl etwas Gemeinsames geben. Das heißt, wir kommen zu dem Punkt, an dem wir dann deduktiv weiterdenken.
Lesch:
Für Parmenides, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Deduktion wichtiger als alles andere. Dass er durch logisches Denken etwas über das Sein des Seins erfahren konnte.
Vossenkuhl:
Wir sollten das nicht zu oft sagen, damit unsere Leserinnen und Leser nicht kirre werden. Für Parmenides war wichtig, dass die Wirklichkeit tatsächlich eine ist.
Lesch:
Gut. Also, die Wirklichkeit soll sein.
Vossenkuhl:
Dieses Wort „Sein“ steht für eine Wirklichkeit. Ganz genau. Wir haben übrigens wieder, wie bei Heraklit, einen ganz starken theologischen Hintergrund. Denn das Göttliche ist identisch mit diesem Alles, mit diesem Gesamten. Und das Eine ebenfalls. Das heißt, wir haben hier austauschbare, identische Ausdrücke, die allesamt immer das Eine meinen. Das Sein. Das Sein hat naheliegender weise Kugelgestalt … weil das der Idealkörper ist. Das ist quasi die Seins-Kugel.
Lesch:
Die rollt und rollt.
Vossenkuhl:
Nein, rollen darf sie nicht.
Lesch:
Verstehe. Denn dann gäbe es ja außerhalb der Kugel noch etwas, auf dem die Kugel rollt. Das Sein muss wirklich alles umfassen, was ist.
Vossenkuhl:
Das klingt außergewöhnlich abstrakt und unanschaulich. Dabei war dieser Parmenides ein Mann, der mitten im Leben stand. Er gab seinem Heimatort sogar eine Verfassung. Ein praktischer Kopf.
Lesch:
Obwohl er sich mit „On“ beschäftigt hat. Aber eine Verfassung hat ja wohl auch was mit dem Sein zu tun.
Vossenkuhl:
Das Ganze geschah weit entfernt von Ephesus und Kleinasien. Nicht ganz so weit war es nach Athen. In Süditalien geschah das, fernab von Syrakus, einem der großen Zentren. Syrakus auf Sizilien war ja damals die größte Stadt der Welt. Sie soll 900.000 Einwohner gehabt haben. Wenn man sich überlegt, was das alles im Hinblick auf die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln bis zum Abwasser mit sich brachte. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Elea war eine ganz kleine Gemeinschaft, nicht weit weg von Paestum, wo bis heute diese wunderbaren Tempel zu sehen sind. In Elea hat sich die Schule gebildet, die dann Die Eleaten genannt wurde. Nach dem Ort Elea eben.
Platon hat einen wunderbaren Dialog geschrieben mit dem Titel „Parmenides“, in dem es um das Eine geht. Wunderbar analytisch. Es ist erstaunlich, mit welch´ spekulativer Kraft Parmenides seinen Gedanken entwickelt hat. Dass die ganze Wirklichkeit … alle Dinge, die sind, in einer Einheit zusammengefasst sind.
Lesch:
Jetzt muss ich aber mal dagegen halten. Das kann so nicht sein. Naturwissenschaftler sind Vertreter einer Spezies, die sehr stark auf der Sinneserfahrung besteht. Auch wenn wir heutzutage mit Detektoren arbeiten und mit unseren Sinnen natürlich kaum noch Wissenschaft betreiben können. Aber es geht doch schon darum, dass da etwas ist, an dem wir Veränderungen – womit ich dann wieder bei Heraklit bin – wahrnehmen. In irgendeiner Art und Weise.
Mit einer wissenschaftlichen Grundlage à la Parmenides könnten wir doch überhaupt keine Wissenschaft betreiben. Für uns ist es ja sonnenklar, dass alles, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, nur Illusion sein kann. Das lässt sich dann komplett ignorieren. Wir sollten uns um das Sein kümmern.
Vossenkuhl:
Parmenides hat ein großes Lehrgedicht geschrieben. Die eine Hälfte haben wir noch so gut wie ganz … der „Weg zur Wahrheit“. Da geht’s eben auch um das Sein.
Dann hat er - davon haben wir leider nicht mehr alles - über die „Meinung“, über die Doxa geschrieben. Das betrifft dann das tägliche Leben. Er ist nicht der Meinung gewesen, dass die sinnliche Wahrnehmung Humbug ist oder Illusion. Nein, er glaubte schon daran.
Lesch:
Aber sie hat nicht das letzte Wort.
Vossenkuhl:
Ja. Sie ist nicht das Zuverlässigste. Es ist nicht die Wahrheit. Also, die sinnliche Wahrnehmung ist nicht Träger der Wahrheit. Wir können uns nicht darauf verlassen.
Lesch:
Ist der Parmenides denn als Philosoph wahrgenommen worden? War er erfolgreich?
Vossenkuhl:
Und wie! Er hatte eine ganze Menge Schüler. Der Zenon z.B., der war einer seiner berühmtesten Schüler.
Lesch:
Ach. Das ist doch der mit der Schildkröte.
Vossenkuhl:
Ja, richtig. Erzähl´ doch mal kurz die schöne Geschichte.
Lesch:
Ja, wie war denn das? Das ist doch eine dieser Paradoxien. Also. Wenn die Schildkröte ein bisschen Vorsprung hat … Also, erst mal, es geht um ein Wettrennen zwischen diesem Tier und Achilles. Achill, ein großer Krieger mit verletzbarer Sehne. Wenn die Schildkröte ein bisschen Vorsprung hat, dann kann Achilles diese Schildkröte niemals einholen, weil nämlich jedes Mal dann, wenn Achilles dahin kommt, wo die Schildkröte gerade war, ist das Panzertier schon wieder ein Stück weiter geschlurft.
Vossenkuhl:
Wie so ein Pfeil, nicht? Jedes Stück, das der Pfeil zurücklegt, kann man unendlich halbieren. Immer weiter, immer weiter. Aber nichts Endliches kann unendliche Strecken zurücklegen. Ergo, der Pfeil kommt eigentlich gar nicht weiter, kann nicht irgendwo hin fliegen.
Lesch:
All diese Nüsse lassen sich natürlich knacken, oder?
Vossenkuhl:
Natürlich. Aber man braucht dazu ein anderes Instrumentarium.
Dem Parmenides ging’s in seinem Lehrgedicht einfach darum, das herauszustreichen, was wirklich zuverlässig ist. Ich meine, das ist grundsätzlich ein großes Anliegen von uns Menschen. Worauf kann man sich nun wirklich verlassen?
Parmenides wollte nicht das Andere ignorieren. Er wollte nur das festmachen, was man wirklich wissen kann. Also ein anspruchsvoller Wissensbegriff.
Lesch:
Wir haben jetzt mit Heraklit und Parmenides zwei Positionen: Der eine ist derjenige, der ganz klar checkt: Was ist der Fall? Dann leitet er daraus ein allgemeines Prinzip ab. Und Parmenides sagt: Das kann es noch nicht sein. Das reicht nicht, es muss etwas darüber hinaus geben.
Vossenkuhl:
Wissen kann doch nicht allein darin bestehen, dass ich sage: Es wird alles. Bei Wissen muss ich sagen: Das ist! Das kann sich doch nicht ständig ändern.
Lesch:
Man kann die Veränderungen nicht zum Prinzip erheben, wenn man wissen will, was gerade ist.
Vossenkuhl:
Wenn ich sage: Das ist ein Glas, dann möchte ich mich doch darauf verlassen können, dass das so ist. Das ist ein Glas. Das ist zwar ein blödes Beispiel. Aber wenn es um Aussagen über die Wirklichkeit geht, über den Kosmos, dann möchte man doch schon etwas haben, bei dem man nicht nur einfach darauf verwiesen wird, dass sich das wieder ändert.
Lesch:
Bei einem Rotweinglas stimme ich Dir sofort zu. Es wäre ja auch jammerschade um den guten Chianti, wenn sich während des Einschenkens das Gefäß verändern würde und der edle Tropfen daneben ginge.
Vossenkuhl:
Das würde ja nach Relativismus klingen.
Lesch:
Auch. Es spiegelt aber besonders die Sorgen eines Genussmenschen wieder.
Vossenkuhl:
Das war ja auch der Vorwurf gegen die Heraklitäer: Relativismus. Dagegen bietet Parmenides nun wirklich etwas, was nicht relativistisch ist.
Lesch:
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Vossenkuhl:
Möglicherweise.
Lesch:
Wir werden ja sehen.