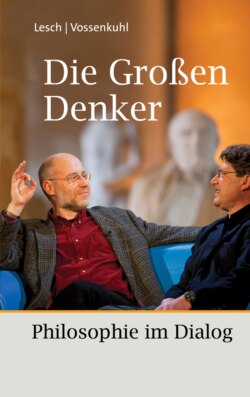Читать книгу Die Großen Denker - Harald Lesch - Страница 13
Empedokles (492-432 v.Chr.) & Philolaos (470-399 v.Chr.)
ОглавлениеEmpedokles
Philolaos
Vossenkuhl:
Jener göttliche Aspekt schwingt bei unserem nächsten Denker-Freund noch immer mit. Empedokles hat schon über die Dinge, die man sieht, über das Stoffliche nachgedacht. Das hat bei ihm aber auch einen dämonischen Hintergrund.
Lesch:
Also war er noch so einer, der diese Mythos-Logos-Trennung nicht vollzogen hat. Hinter jedem vernünftigen Gedanken stand immer noch die Götterwelt.
Vossenkuhl:
Die Trennung Mythos – Logos war in seiner Zeit schon passiert. Aber es ist immer noch dieser mythische, göttliche Hintergrund da. Du hast ja die Kräfte beschrieben: Liebe und Hass – das sind die Kräfte, die die Elemente in Bewegung bringen und die gleichzeitig deren Verbindung und Trennung bewirken. Empedokles hatte die Vorstellung, dass nicht nur die Objekte, die man sieht, wie Steine oder Feuer sich nach diesen Kräften richten, sondern dass sich damit die gesamte Menschheitsgeschichte erklären lässt.
Lesch:
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Vossenkuhl:
Die erste Phase, in der die Liebe herrschte, kannte nur Einheit und Harmonie. Geradezu paradiesisch. So ganz nach dem alten pythagoräischen Harmoniegedanken.
Dann fängt irgendwann der Streit an, die Ordnung aufzubrechen. In der dritten Phase herrscht nur noch Streit, es gibt keine Ordnung mehr. Langsam setzt sich dann die Liebe erneut durch und die Ordnung kehrt wieder. Das Ganze wiederholt sich ständig. Es ist also immer ein Werden und Vergehen.
Lesch:
Da ist eine Krise, und aus dieser Krise erwächst eine Chance. Dann geht’s wieder von vorne los.
Empedokles hat offenbar als Mediziner aus diesem Gegensatz zwischen Liebe und Hass die Vorstellung gewonnen, dass zwei konkurrierende Prinzipien dafür verantwortlich sind, dass überhaupt etwas passiert.
Das scheint sich in der Medizin noch weit bis ins 19. Jahrhundert fortgesetzt zu haben. Das hat den Prozess erschwert, aus der Medizin das zu machen, was ich sowieso nicht möchte, dass sie es wird. Nämlich eine Naturwissenschaft, die nach sogenannten objektiven Kriterien ein Subjekt behandelt. Ich möchte lieber von Medizinern behandelt werden, die mich noch als Mensch sehen und nicht als Biomasse mit ein bisschen Wasser oder Kohlenstoffeinheiten.
Empedokles hatte dadurch, dass er dieses Gegensatzdenken so stark gemacht hat, eine ungeheure Wirkung bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Dabei steht er unter den griechischen Philosophien nicht einmal in der ersten Reihe. Eigentlich spielt er in der zweiten Liga. Trotzdem ist er aber ein starker Denker, würde ich einmal sagen.
Vossenkuhl:
Dass er bis ins 19. Jahrhundert eine große Rolle spielte, hat bei Empedokles erkenntnistheoretisch einen guten Grund. Er meinte, der Mensch kann nur durch Gleiches Gleiches erkennen. Also: Das Fleischliche an uns erkennt das Fleischliche. Das Luftige an uns erkennt das Luftige. Das Feurige an uns das Feurige.
Man hat daraus dann später etwas verfeinerte, begriffliche Prinzipien entwickelt. Man hat nicht mehr vom Fleischlichen gesprochen, sondern hat das in der Erklärung von Ursachen und Wirkungen neu aufgelegt, wissenstheoretisch. Man postulierte: Die Ursache muss der Wirkung entsprechen, also der Art nach müssen Ursachen und Wirkungen nicht nur eng miteinander verbunden, sondern wesenverwandt und aus demselben Stoff sein. Dieses Prinzip herrschte bis ins 18. Jahrhundert vor.
Lesch:
Sogar der Begründer der Homöopathie, der Herr Hahnemann, hat ja auch gesagt: Gleiches muss mit Gleichem behandelt werden. Das ist schon sehr merkwürdig, dass sich so ein Gedanke so lange hält.
Vossenkuhl:
Ja, unglaublich.
Lesch:
Da musste es eine ziemlich positive Rückkopplung aus der Erfahrung gegeben haben. Ich meine, Erfolge sind auch in der Geschichte mit den Kräften und den Elementen vorzuweisen. Ich will das jetzt nicht übertreiben, aber das muss mal gesagt werden.
Wir kennen in der Physik heute Elementarteilchen. Das sind die Teilchen, aus denen die Welt besteht. Dazu kommen vier Kräfte. Die Schwerkraft, also die Gravitation, dann die Kraft, die die Atomkerne zusammenhält, dann eine Wechselwirkung, die dafür sorgt, dass einige der Atomkerne wieder zerfallen, die schwache Wechselwirkung und der Elektromagnetismus. Diese Kräfte wirken zwischen den Teilchen. Genau das, was Empedokles in die Welt gebracht hat: Da gibt es Elemente und dazwischen wirken Kräfte. Das ist eigentlich das Arbeitsprogramm für die moderne theoretische Physik geworden. Und gleichzeitig dieser Evolutionsgedanke, dass eben tatsächlich Dinge entstehen, im Begriffe sind zu werden, und dabei auch immer was …
Vossenkuhl:
… vergeht.
Wie findest Du eigentlich diesen Gedanken, den wir schon einmal angeschnitten haben, dass nichts wirklich vergeht und neu entsteht. Jedes Atom in unserem Körper – ich wiederhole das – wurde schon in mehreren Supernovas geröstet. Ist das nicht ein ähnlicher Gedanke, dass eigentlich nichts wirklich verschwindet?
Lesch:
Es ist schon lange her, dass in diesem Universum wirklich etwas Nennenswertes verschwunden ist. Es gibt ab und zu mal Materie, die in Schwarzen Löchern komplett für immer und ewig verschwindet. Aber das ist verschwindend gering im Vergleich zu dem, was tatsächlich da ist.
Vossenkuhl:
Verschwindet es dort wirklich?
Lesch:
Man weiß es nicht. Es kommt ja nichts mehr raus. Da können wir nur spekulieren. Es gab eine Zeit im Universum – kurz nach dem Urknall -, da sind Dinge tatsächlich komplett verschwunden. In den ganz frühen Phasen, als es sehr heiß war, haben sich Teilchen und Antiteilchen gegenseitig vernichtet. Umso erstaunlicher ist es, dass überhaupt etwas übrig geblieben ist. Seitdem ist das Universum sozusagen materiell komplett ausgerüstet.
Was natürlich passieren kann, ist, wie zum Beispiel im Innern von Sternen, dass materielle Teilchen miteinander verschmelzen und daraus etwas Neues entsteht.
Unser Empedokles ist jemand gewesen, der dieses Werden und Vergehen zum Prinzip erhoben hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der sogar eine Evolutionstheorie entwickelt. Tierische Geschöpfe zum Beispiel sollen teilweise durch zufällige Veränderungen gewisse Verbesserungen erfahren haben. Dadurch sollen sich gewisse neue Entwicklungen breit gemacht haben. Seine Vorstellung über die belebte Welt war ja eine ganz besondere.
Vossenkuhl:
In dem Punkt war er Pythagoräer. Er hat auch an die Wiedergeburt geglaubt. Ich denke, er war der einzige Pythagoräer, von dem wir das heute sicher wissen.
Er war auch - und das ist wirklich erstaunlich - sehr kritisch gegenüber dem religiös motivierten Töten von Tieren in den Tempeln.
Lesch:
Also gegen Blutopfer?
Vossenkuhl:
Da gibt’s eine schöne Passage aus seinem großen Lehrgedicht über die Physik: „Wollt Ihr nicht aufhören“, schreibt er, „mit dem Morden, dem böses Leid bringenden, seht Ihr denn nicht, wie Ihr einander zerfleischt in Unbedachtheit des Sinnes.“
Was er hier meint: Wenn wir Tiere töten, dann töten wir unsere eigenen Verwandten. Denn es sind, schreibt er später, unsere Söhne und Töchter.
Es ist schon interessant, dass jemand in dieser Zeit, 5. Jahrhundert v. Chr. - in dem das rituelle Töten von Tieren praktiziert wurde, eigentlich bis in die christliche Zeit hinein - dieses Töten kritisiert. Es wundert mich, dass er keine Probleme mit den Religionshütern bekam.
Lesch:
Es scheint ein durchgängiges Thema zu sein, dass Philosophen leicht neben der Spur waren. Durch die Reflektion über die Dinge, dem schrittweisen Kennenlernen von dem, was sich möglicherweise hinter der Welt verbirgt, machen Philosophen Aussagen, wo alle anderen nur den Kopf schütteln und meinen: Jetzt hat der aber wirklich einen Sprung in der Schüssel.
Empedokles scheint auch so ein klassischer Fall gewesen zu sein. Er muss aber außergewöhnliche intellektuelle Fähigkeiten gehabt haben. Er macht Aussagen, die deutlich gegen alles sind, was die braven Bürger für gut und richtig hielten. Mainstream eben.
Vossenkuhl:
Dieses Recht, neben der Spur zu sein wurde - neben den wirklich Verrückten - auch den Philosophen zugestanden.
Lesch:
Das ist ja überhaupt ein Grundproblem von Philosophie, dass Menschen auf einmal anfangen, sich mit Fragen zu beschäftigen, die so völlig weg sind von den normalen, alltäglichen Verrichtungen und Gewohnheiten. Wenn Menschen aus dem Fluss heraustreten, um sich mal umzuschauen. So nach dem Motto: Was machen wir hier eigentlich?
Das ist immer ein Problem für die etablierte Umwelt, für den träge dahinfließenden Strom. Der rechtsschaffende Bürger fragt sich dann gerne: Wovon spricht denn der eigentlich?
Vossenkuhl:
Man muss sich natürlich immer bewusst machen, was das dann letztlich für eine Wirkung hatte.
Lesch:
Wir haben noch einen Schüler von Empedokles, Philolaos heißt der.
Vossenkuhl:
Der stammt aus dem heutigen Kalabrien, aus Kroton, da, wo auch Pythagoras gelebt hatte. Von dort musste er schleunigst weg, aber das ist eine andere Geschichte.
Jedenfalls hat er nun wieder ganz stark die pythagoreische Seite bei Empedokles betont. Das Stichwort ist bei ihm: Viele Welten und ein Zentrum.
Für Philolaos war das Zentrum das Feuer, das von den Planeten umkreist wird. Ich finde es interessant, dass der Philolaos einen Gedankenstrang von Empedokles radikalisiert hat. Da sieht man schön, wie sich ein Gedanke weiterentwickelt und fortsetzt.
Lesch:
Was mich besonders an Philolaos begeistert, ist, dass der versucht hat zu argumentieren. Pythagoras hat nicht argumentiert. Er hat einfach gesagt, was Sache ist. Philolaos hat versucht, das pythagoreische Denken in eine Philosophie zu gießen und daraus wirklich was zu machen. Auf ein Argument folgte ein Gegenargument. Er setzte sich nicht in Positur und manifestierte: Hugh, ich habe gesprochen!
Rückblickend war Pythagoras in diesem Sinne ein Religionsstifter. Für den hatte Wissen etwas mit der Erlösung der Seele zu tun. Bei Philolaos ging es mehr in Richtung Mensch. Es gab bei Pythagoras schon ganz wichtige Gedanken, wie die Sache mit der Harmonie und der so wichtigen Zahl. Er hat das zur Philosophie gemacht.
Es gibt aber auch in den Naturwissenschaften immer wieder Entdeckungen, vor allen Dingen in der Theorie, die einzig und allein von dem Gedanken an die Harmonie und die Mathematisierbarkeit der Welt getragen sind.
Das geschieht völlig ohne Phänomen, ohne dass es einen Anlass dafür gibt. Da setzt sich jemand hin und sagt: Also, wenn dieses Prinzip trägt, dann muss es so und so sein.
Und das Erstaunliche ist, dass dann aus diesen Theorien Experimente abgeleitet worden sind - was soll ich Dir sagen - man hat es gefunden! Nehmen wir die Geschichte mit Materie und Antimaterie. Nicht weil man jetzt ein Phänomen vor sich hatte, auf das sich das zurückführen lässt, sondern im Gegenteil. Alle haben gesagt: Das kann doch nicht sein!
Es wurde aber dann im Experiment bestätigt. Dieser Harmoniegedanke ist ein unheimlich tragfähiger. Und Philolaos war sicherlich derjenige, der diesen pythagoreischen Gedanken von der Harmonie und der Zahl, der Mathematisierbarkeit, als allererster richtig sauber bis zum Ende durchdacht hat.
Vossenkuhl:
Ich finde es gut, dass Du diese direkte Verbindung von heute zu diesen allerersten Prinzipienforschungen herstellst. Da sieht man überdeutlich, wie diese Denker die Gestalt Europas geprägt haben.
Lesch:
Es gibt da einen netten Aphorismus: Genial! Das ist, einen einfachen Gedanken als allererster gedacht zu haben. Wenn er dann mal gedacht ist, dann kommt man nicht wieder dahinter zurück. Wenn er einmal in die Welt gesetzt worden ist, dann kann man sich nicht mehr dagegen wehren.
Gerade in der Entwicklung von Wissenschaften in den letzten 500 Jahren ist dieser Rückgriff auf die Wurzeln aus Griechenland so wichtig. Das ist wirklich eine lange, eine zweieinhalbtausend Jahre lange Karawane. Man kann immer wieder vergleichen: Was haben die denn damals so gedacht? Ist das noch tragfähig? Das ist für mich ein ganz wichtiger Beweggrund gewesen, mich mit Philosophie zu beschäftigen. Die Naturwissenschaften, so wie sie sich heute darstellen, gehen auf dieses Wurzelwerk zurück, das uns wirklich durchdringt.
Vossenkuhl:
Vor allem kann man diese Wurzeln verfolgen. Sie sind nicht einfach abgeschnitten.
Aber ich will noch einmal zu Empedokles zurückkommen.
Es gilt oder galt lange der sogenannte Satz der
„Erhaltung der Substanz“.
Also, Substanzen sind unzerstörbar, unvergänglich. Dieser Gedanke spielte in der Philosophie eine ebenso große Rolle wie in der Physik. Empedokles war zwar noch kein Materialist im Sinne der Atomisten, über die wir ja auch noch sprechen werden, also Leukipp, Demokrit – aber er hat mit den vier Elementen natürlich materielle Grundelemente angenommen, und deren Substantialität war in seinen Augen ewig und unvergänglich.
Lesch:
Ja. Stimmt so.
Vossenkuhl:
Und dieser Determinismus, also dieses Prinzip, dieses metaphysische Prinzip, dass alles kausal determiniert und gesetzmäßig bestimmt ist, wird immer durch den Gedanken ergänzt, dass die Substanzen und ihr Gesamtbestand sich nicht verändern.
Also die Menge der Teilchen in der Welt ist immer dieselbe.
Lesch:
Genau. Du hast weiterhin so Recht.
Vossenkuhl:
Und deswegen gibt es viele, die sagen: Wenn das so ist, kann es auch keine Freiheit geben, und so fort.
Lesch:
Es gibt nichts Neues unter der Sonne, oder was?
Vossenkuhl:
Und jetzt die Frage: Was ist aus Deiner physikalischen Sicht heute noch anzufangen mit diesen Gedanken der Konstanz, der Substantialität, der Unvergänglichkeit der Substanzen?
Lesch:
Es mag ja sein, dass die Substanz unvergänglich ist. Entscheidend scheint mir aber zu sein, dass sich im Laufe der Jahrmilliarden zum Beispiel auf unserem Planeten die Substanzen in völlig unterschiedlicher Form miteinander verbunden haben.
Ich sage gerne: Ist es nicht ein Wunder, dass das Atom fast völlig leer ist. Es gibt dieses schöne Bild: Wenn das Wasserstoffatom ein Fußballstadion wäre, und das Elektron saust auf dem äußersten Tribünenrang ganz oben rum, dann ist ein Atomkern gerade einmal ein Reiskorn am Anstoßpunkt. Dazwischen ist nichts.
Warum werde ich dann besoffen, wenn ich eine Flasche Cognac trinke? Wenn da im Wesentlichen nichts drin ist? Es hat offenbar etwas damit zu tun, wie die Dinge sich miteinander verbinden. Also die Gewichtungen, die Relationen zwischen den Elementen. Damit sind wir wieder bei Empedokles’ Vorstellung von Kräften. Die spielen eine ganz entscheidende Rolle.
Es mag sein, dass die Bausteine in der Welt mehr oder weniger erhalten bleiben. Mögen ein paar verschwinden, aber im Großen und Ganzen bleibt es so, wie es war. Entscheidend ist, wie sich im Laufe der Zeit Dinge miteinander verbinden.
Ob es ein Karpfen wird oder eine Kiefer oder gar ein Mensch, das ist im Prinzip keine Frage der Anzahl der Kohlenstoffatome, sondern es ist eine Frage, wie die Verbindungen stattfinden. In dieser Welt ist etwas zwischen den Dingen.
Es gibt den Satz: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Bestandteile. Ich glaube, da liegt der Hund begraben. Man sollte nicht vergessen, dass es da noch mehr gibt als nur die Substanz.
Eine Diskussion über menschliche Freiheit ist ja keine Diskussion für einen Naturwissenschaftler. Freiheit ist kein naturwissenschaftlicher Begriff. Ein Atom hat keine Freiheit, ein Atom unterliegt gewissen Gesetzen, basta. Aber die Verbindung von Atomen kann durchaus Eigenschaften haben, die weit über die Eigenschaften eines einzelnen Atoms hinausgehen.
Und die Verbindungen zwischen den Atomen sind lernfähig. Die können sich etwas aneignen, die haben Potentialitäten.
Vossenkuhl:
Genau. Potentialitäten sind Möglichkeiten, die vorher nicht da waren.
Das darf man nicht vergessen. Denn in dem Moment, wo man einem System sozusagen die „Freiheit“ lässt, sich zu entwickeln, wird es das auch tun.
Ob aus einer Möglichkeit etwas wird, das weiß man allerdings vorher nie. Es müssen die richtigen Bedingungen herrschen.
Und in diesem Sinne ist das, was Empedokles da angestoßen hat, im Grunde genommen nur ein erster Schritt.
Lesch:
Du würdest aber jetzt nicht so weit gehen, Liebe und Hass in so quasi Anziehungs- und Abstoßungskräfte direkt zu übersetzen.
Vossenkuhl:
Auf keinen Fall. Ich glaube, an der Stelle zeigt sich, dass die Möglichkeiten eines Mannes wie Empedokles eben nur durch das Denken etwas über die Welt zu erfahren, deutlich begrenzt sind. Wenn man wirklich etwas über die Welt erfahren will, reicht das reine Denken nicht aus. Man muss mit der Welt in irgendeiner Art und Weise wechselwirken. Sich nur in sein Kämmerlein zu verziehen und zu sagen, ja, die Welt ist so und so, das wird nicht ausreichen. Die Wechselwirkung ist das entscheidende. Man muss dem Phänomen auf die Spur kommen. Man muss etwas darüber wissen.
Übrigens, der Empedokles hat ja auch festgestellt, dass Luft ein Stoff ist und nicht nur ein Element. Der hatte glatt durch ein Experiment festgestellt: Wenn man ein Glas umgekehrt in Wasser hineinsteckt, dann dringt das Wasser nicht in diesen Luftraum ein. Offensichtlich drückt die Luft gegen das Wasser.
So wurde aus dem Element Luft, als einem der Prinzipien, plötzlich etwas ganz Stoffliches.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man merkt tatsächlich: Das ist nicht nur irgendein Gedanke, den ich diesem Element da unterschiebe. Das geht ja gar nicht.
Lesch:
Diese Geschichte hat der Philolaos auch noch mal vertieft. Er hat dem Feuer eine Kugelgestalt zugeschrieben und hat den Inhalt und die Oberfläche als Äther bezeichnet, also er meinte, das sei so quasi ein Luftäquivalent.
Vossenkuhl:
Hat der Philolaos nicht auch die Erde und die Sonne gemeinsam um dieses Feuer laufen lassen?
Lesch:
Ja, ja.
Vossenkuhl:
Es drehte sich also nicht alles um die Erde, sondern die Erde war eine von vielen anderen Himmelskörpern, die da rund um das Feuer unterwegs waren.
Das ist natürlich ein Gedanke, der doch eine ganze Weile zur Reifung gebraucht hat. Wir wissen heute, dass sich nichts mehr um ein zentrales Feuer dreht und dass die Erde eben nicht das Zentrum der Welt ist. Es gibt überhaupt kein Zentrum.
Lesch:
Schön, was Du gerade mit der Luft beschrieben hast.
Der Empedokles war nicht einer, der mal kurz beim Kaffee oder beim Ouzo nachdachte, sondern der hat beobachtet, was so passiert. Also, er hatte diesen Gedanken der Gleichheit des Erkennens, also quasi das Weinhafte in mir…
Vossenkuhl:
Ach, das Weinhafte in Dir erkennt den Wein?
Lesch:
Erkennt den Wein, ja. Nach Empedokles. Ganz philosophisch.
Vossenkuhl:
Aha.
Lesch:
Meldet sich das Weinhafte nicht auch so in Dir?
Vossenkuhl:
Hm.
Lesch:
Wahrscheinlich haben manche Leute nichts Weinhaftes in sich.
Vossenkuhl:
Die haben dann vielleicht das Bierhafte?
Und manche haben das Zwanghafte. Gut, dieses Spielchen sollte man nicht zu weit treiben. Aber Empedokles ist tatsächlich darauf aus, dass es in uns Teile gibt, die das jeweils ähnlich geartete erkennen.
Lesch:
Wir sind ja auch aus Erde, Wasser, Feuer und Luft zusammengesetzt.
Wir haben, wie Du das gerade beschrieben hast, eine besondere Art der Zusammensetzung, und zwar über die Atome.
Die besondere Synthese ist im Hinblick auf den Erkenntnisprozess immer wieder so zu verstehen, dass jedes Element immer das Element des zu Erkennenden identifiziert. Also das Stoffliche.
Vossenkuhl:
Wie soll es auch sonst gehen? Ich meine, dass wir ohne Sinne etwas über die Welt erfahren, das geht wohl nicht.
Aber was sind die Sinne? Empedokles hat die Sinne eigentlich ganz klug aufgelöst. Er hat da nicht was Zusätzliches in die Welt gesetzt. Die Sinne drücken sich – wie er meinte - eben in dieser Vergleichbarkeit der Stoffe, im Erkenntnisprozess aus.
Lesch:
Wann lebte der Empedokles eigentlich? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Vossenkuhl:
Ungefähr 492 bis 432. Auch Aristoteles erwähnte ihn mit einem Lebensalter um die 60 Jahre.
Lesch:
Für die damalige Zeit ein langes Leben.
Vossenkuhl:
Sicher, ein hohes Alter. Bei einem Durchschnittsalter von 30 Jahren.
Lesch:
Ein weiterer Grund, um Philosophie zu betreiben. Es hält jung und man bleibt am Leben.
Vossenkuhl:
Man muss halt das Stoffliche erkennen können.
Lesch:
Man muss das Weinhafte in sich haben.
Vossenkuhl:
Bier war noch nicht so angesagt.
Lesch:
Hat man denn zu dieser Zeit so was wie medizinische Forschung gemacht? Hat man sich den menschlichen Organismus einmal genauer von Innen angeschaut?
Vossenkuhl:
Nein.
Lesch:
Man konnte also praktisch nur von außen etwas über eine Krankheit erfahren?
Vossenkuhl:
Ja. Es gab zwar schon Mediziner, die sich auch die Toten genau angesehen haben.
Aber man hat nicht wirklich gewusst, wie das, was im Körper zu finden ist, funktioniert. Der Blick in den Körper hinein, der ist wahrscheinlich erst im 17. Jahrhundert besser verstanden worden.
Lesch:
Wenn Empedokles ein Wunder-Mediziner gewesen ist, muss er einen unheimlich guten Blick für den lebenden Patienten gehabt haben.
Vossenkuhl:
Das Stoffliche muss sich entsprechen. Entscheidend sind die Mischverhältnisse – das war bei ihm die Grundidee. Da fällt mir Dein Vergleich mit der Homöopathie von Hahnemann wieder ein. Vielleicht war das schon bei Empedokles das Erfolgsrezept.
Lesch:
Es ist schwierig, mit dieser Philosophie wirklich in die Naturwissenschaften zu gehen. Man kann das schon machen. Man kann diese Dinge übernehmen. Das haben wir ja vorhin auch gemacht.
Empedokles lebt aber immer noch von einer Vorstellung, die eher, na ja, mystisch ist. Da ist noch etwas dahinter, was sich dem gestandenen Naturwissenschaftler nicht so ohne weiteres erschließt.
Vossenkuhl:
Da hast Du glasklar Recht.