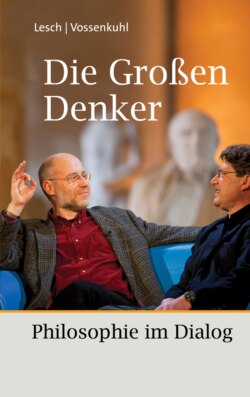Читать книгу Die Großen Denker - Harald Lesch - Страница 16
Die Sophisten
ОглавлениеLesch:
Es geht jetzt um Leute, die vor 2.400 Jahren in Griechenland ihr Wesen, oder Unwesen – da scheiden sich die Geister – getrieben haben. Zumindest waren sie bekannt wie bunte Hunde. In die heutige Zeit übersetzt wäre es ungefähr so vergleichbar: Sie schalten das Radio an, erfahren, ein Philosoph ist in die Stadt gekommen und Sie rennen sofort auf die Straße, auf der bereits Hunderte andere Menschen eiligst unterwegs sind. Alle rufen: Der große Philosoph ist gekommen! Ein Superstar, ein Meister des Wortes. Einer der berühmten Sophisten!
Willi, was sind oder waren die Sophisten?
Vossenkuhl:
Die Sophisten waren kluge Leute. Eine der Bedeutungen von „sophistes“ ist: Jemand, der weise, aber auch kunstverständig ist. Ein Künstler eben. Dann gibt es allerdings auch noch die Bedeutungen Scheinphilosoph und Betrüger. Mixt man das alles wie einen Cocktail zusammen, dann ahnen wir schon etwas von dem Ruf, den die Sophisten in ihrer Zeit, in Athen vor allem, hatten. Es war kein besonders Guter. Wir wollen hier und jetzt etwas zu ihrer Ehrenrettung tun.
Lesch:
Das haben die auch dringend nötig. Es klingt geradezu wie ein Schimpfwort: Du bist ja ein richtiger Sophist! Gemeint ist: Spiegelfechter, Wortverdreher. Diese Leute können das Opfer vor Gericht genauso vertreten wie den Täter.
Aber sind die Sophisten nicht eigentlich Sprachphilosophen? Sie beschäftigen sich doch als allererstes mit der Sprache.
Vossenkuhl:
Und wie. Die waren geradezu Sprachkünstler. Die Sprachphilosophen gehen theoretisch mit der Sprache um und fragen z.B.: Wie kann eine Sprache Trägerin von Bedeutungen sein, enthält sie selbst die Bedeutungen oder bildet sie Bedeutungen nur ab? Wie verstehen wir diese Bedeutungen? Was sind die Grundeinheiten, die Bedeutungen enthalten können? Sind es die Wörter oder die Sätze? Bedeuten Sätze, die in verschiedenen Sprachen denselben Sachverhalt ausdrücken, auch wirklich dasselbe oder nicht? So fragen die Sprachphilosophen. Die Sophisten dagegen interessierte vor allem, was man mit der Sprache machen kann.
Protagoras (490-411 v. Chr.) oder Gorgias (ca.480-380 v. Chr.), über die beiden reden wir vor allem. Sie glaubten, dass Sprache ein Mittel zum Zweck, so ähnlich wie Gift, sein kann. Manchmal kann man Gifte benutzen, um jemanden zu heilen, dann aber auch, um jemanden zu schädigen.
Lesch:
Vor allem dann, wenn die Dosis erhöht wird. Dann kann die Sprache wie ein zerstörerisches Gift wirken. Wenn das Wort zur Waffe wird, dann ist die Rhetorik sozusagen der Gebrauch dieser Waffe. Die Dialektik ist die Benutzung der Waffe in Form eines Sports. Die Politik ist dann die Wirkung dieser Waffe. Und die Grammatik…
Vossenkuhl:
… das Instrument.
Lesch:
Das Instrument, genau. Die Sophisten waren echte Wortpragmatiker. Die haben ihren Opfern die Worte einfach im Munde herumgedreht.
Vossenkuhl:
Das geschah aber nicht immer in böser Absicht. Nehmen wir den bereits eben schon erwähnten Protagoras. Der stammte aus dem gleichen Kaff wie Demokrit, aus Abdera in Thrakien.
Er war der Meinung, dass man jede Sache oder jeden Sachverhalt einmal so, aber auch andersherum, also als Gegenteil darstellen kann, also einmal als wahr und dann als unwahr.
Lesch:
Also, jede Medaille hat zwei Seiten. Könnte man das so verstehen?
Vossenkuhl:
Das trifft des Pudels Kern. Für Protagoras lässt sich jede Sache auf zweierlei Wahrheiten zurück führen, die sich widersprechen. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass das eine Betrügerei sein könnte. Er war vielmehr der Meinung, dass es immer auf die Perspektive ankommt.
Da gibt es diesen Satz des Protagoras: „Aller Dinge Maß ist der Mensch“. Es ist nicht vom Menschen im Allgemeinen die Rede, sondern von Dir und mir. Jeder Mensch ist ein Maß. Und dann heißt es weiter: „Wie alles einzelne mir erscheint, so ist es für mich, wie Dir, so ist es wieder für Dich.“
Das heißt: Wie die Dinge wirklich sind, unabhängig, wie jeder sie für sich sieht, davon wissen wir gar nichts. Wir wissen nur, wie sie uns erscheinen. Deren Erklärung ist dann die Sache des Sophisten. Er vermittelt uns die Dinge, weiß aber auch nicht, wie sie in Wahrheit sind. Sie könnten ganz anders sein, als sie uns erscheinen.
Lesch:
Bevor sich uns die Sinne vollends verwirren, ein kleiner historischer Exkurs. Wir haben ja schon die berühmten Vorsokratiker abgearbeitet. Die Sophisten gehören teilweise ebenfalls zu den Vorsokratikern, obwohl einige von ihnen bereits auf Erden wandelten als Sokrates noch lebte. Er hat die wohl auch gekannt.
Ich werde einmal die These vertreten, dass ohne die Sophisten Sokrates gar nicht hätte so wirken können, wie er es dann getan hat. Wir sind in der Zeit 400 …
Vossenkuhl:
4. und 3. Jahrhundert vor Christus.
Lesch:
Wir sind also noch nicht wirklich im klassischen Athen angekommen, oder?
Vossenkuhl:
Doch, doch. Das ist schon klassisches Athen.
Die lebten eben gleichzeitig mit anderen Kollegen. Platon lebte da auch schon, wirkte, und schrieb. Gorgias war für ihn ein Zeitgenosse.
Lesch:
Der wurde über 100 Jahre alt. Kann man sich das in der damaligen Zeit vorstellen? Ohne Herzschrittmacher und Vitamin C aus der Dose? Vor immerhin 2.500 Jahren wurde ein Mann, der als der berühmteste Redner seiner Zeit galt, über 100 Jahre alt. Daran merkt man mal wieder, wie gesund es ist, sich mit Philosophie zu beschäftigen.
Vossenkuhl:
Der hat wahrscheinlich so einen ähnlichen Wein getrunken wie wir gerade.
Gorgias stammte nämlich aus Sizilien, aus Leontinoi, und der hat dort sicher – solange er überhaupt dort war – den guten sizilianischen Wein getrunken, nehme ich mal an.
Heute heißt der Wein z.B. „Nero d’Avola“. Allerdings ging Gorgias bald nach Griechenland. Wie der Wein dort war, ist schwer zu beurteilen.
Lesch:
In Vino veritas und ein langes Leben. Das ideale Philosophen-Getränk.
Mir ist aufgefallen: Es gab ja einige hundert Jahre griechische Philosophie. Da hat man sich mit Fragen beschäftigt wie: Was ist das Sein? Was steckt in den Dingen? Was ist deren Natur? Mit naturphilosophischen Konzepten versuchte man, dem nahe zu kommen. Gibt es Veränderungen oder eben keine? Fließt alles oder gibt es überhaupt nichts? Und dann kommen die Sophisten.
Die Sophisten scheinen mir geradezu eine Gegenbewegung zu sein. So etwas wie eine reinigende Aufklärung. Jetzt haben wir diesen ganzen ontologischen Kram über das Sein, die Existenz von dem, was hinter den Dingen steckt. Aber das hilft uns doch im alltäglichen Leben überhaupt nicht! Wir brauchen jetzt endlich einmal auf neuhochdeutsch eine „down to the earth“-Philosophie, also das Runterholen der Philosophie vom Himmel auf die real existierende Erde.
Damit hat die Philosophie aber auch gleichzeitig einen austauschbaren Inhalt bekommen. Denn wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist und somit jeder Mensch das Maß aller Dinge, dann sind natürlich Deine und meine Vorstellungen von der Welt mindestens genauso wichtig und richtig wie die Vorstellung von jedem anderen.
Vossenkuhl:
Deshalb nannte man diese ganze Haltung relativistisch, skeptisch. Insofern waren diese Sophisten, da hast Du ganz Recht, Aufklärer. Man kann das sogar ganz konkret mit dem in Verbindung bringen, was bei uns in Europa im 18. Jahrhundert – also im Zeitalter der Aufklärung - im Hinblick auf die Gottesvorstellung passierte.
Die Sophisten, gerade Protagoras, waren die Ersten, die sagten: Über die Götter können wir nichts wissen. Was immer wir Menschen unter den Göttern verstehen, ist das Produkt der eigenen Fantasie und Vorstellung. Es gab sogar Sophisten, die meinten, dass der ganze Glaube an die Götter von einem klugen Menschen erfunden worden sei. Der wollte damit nur bewerkstelligen, dass die Menschen besser zu disziplinieren wären, wenn sie sich von den Göttern quasi ständig beobachtet fühlen. Das ist schon sehr aufklärerisch.
Protagoras sagte: „Über die Götter allerdings habe ich keine Möglichkeit zu wissen, weder dass sie sind, noch dass sie nicht sind, noch wie sie etwa an Gestalt sind; denn vieles gibt es, was das Wissen hindert: die Nichtwahrnehmbarkeit und dass das Leben des Menschen kurz ist.“ Ist das nicht auch aufklärerisch?
Lesch:
Also, die Herren … wieder sind es nur Männer! Bis zu einem gewissen Zeitpunkt reden wir eigentlich nur über Männer in der Philosophie.
Vossenkuhl:
Das stimmt. Obwohl einige Sophisten zumindest meinten, die Menschen sind alle gleich, Frauen und Männer. Das hat übrigens Platon dann interessant gefunden.
Lesch:
Also, diese Männer haben sich dann mit viel weniger zufrieden gegeben als diejenigen, die vorher versucht hatten, einen Gesamtzusammenhang zu entdecken. Die beschränkten sich auf das, womit man auch unmittelbar etwas anfangen konnte. Nicht zuletzt deshalb, weil die auf Honorar-Basis gearbeitet haben.
Den Ratschlag eines Thales oder eines Anaximander oder Anaximenes, den gab es höchstwahrscheinlich umsonst. Zumindest ist nichts davon bekannt, dass sie damit ihren Lebensunterhalt bestritten haben.
Die Sophisten waren dann die Vorläufer der Profis, also eigentlich der Lehrer. Derjenigen, die Geld dafür erwarteten, dass sie andere in einer Kunst wie zum Beispiel der Rhetorik oder der Philosophie unterrichteten.
Vossenkuhl:
Heute ist das schwer vorstellbar, weil es so was nicht mehr gibt. Es war eine Mischung aus Rechtsanwalt, Philosophie-Lehrer und Politiker. Junge Menschen wurden in der Kunst, ein Argument möglichst erfolgreich über die Rampe zu bringen unterrichtet. Da gehörten alle möglichen Dinge dazu. Wenn heute einer als Pianist Erfolg haben will, dann muss er nicht unbedingt Grimassen schneiden. Der Liszt hat das gemacht. Ich nehme an, die Sophisten hatten auch eine Menge Mimik und Gestik drauf.
Die Sophisten haben sich mit den aktuellen Tagesthemen beschäftigt. An den großen Fragen waren die nicht interessiert. Aber pfiffig wie sie waren, haben sie eine geschliffene Dialektik entwickelt, um nachzuweisen, dass es eigentlich gar nichts Wirkliches gibt.
Lesch:
Da steckt dieser Gorgias dahinter.
Vossenkuhl:
Genau dieser Methusalem Gorgias aus Sizilien. Der sagte also: Es gibt nichts. Nichts ist da. Sollte überhaupt etwas sein, dann können wir es nicht fassen. Sollten wir es aber trotzdem fassen können, dann können wir es nicht mitteilen. Und damit ist Ende der Fahnenstange.
Lesch:
Wie ist der 100 Jahre alt geworden? Der muss sich ja jeden Tag dem Trunke hingegeben haben, nach dem Motto: Ob ich was trinke oder nicht, spielt keine Rolle. Es kann ja sowieso nichts sein. Und wenn was ist … Am Ende konnte er wohl berauscht tatsächlich nichts mehr mitteilen, das stimmt.
Aber das ist Skepsis in Reinkultur. Da bleibt ja überhaupt nichts mehr zu tun übrig.
Vossenkuhl:
Man kann sich gut vorstellen, dass so eine geistige Haltung nicht von großer Dauer ist. Für diese Art von Aufklärung war das Ende absehbar. Das konnte nicht lange anhalten. Es brachte aber frischen Wind in die intellektuelle Kultur. Vor allem in Athen. Und das war wichtig in der damaligen, etwas erstarrten Zeit.
Lesch:
Was mir gut daran gefällt, weil ich auch ein Vertreter der These bin, dass die Wissenschaft und die Philosophie unter die Menschen müssen, ist, dass die ganze Bewegung der Sophistik etwas ganz Pragmatisches an sich hatte.
Diese Leute sind aus dem Umfeld heraus zu verstehen. Es gibt demokratische Bewegungen, die Polis kommt in Schwung. Es gibt mehr und mehr Gerichtsverhandlungen. Die Philosophie ist nicht mehr nur das Werk von Einzelnen, von Leuten, die etwas „neben der Spur gehen“, die sich mit irgendwas beschäftigen, was den Otto Normalverbraucher nicht besonders berührt.
Jetzt wird die Philosophie ganz schnell ganz praktisch. Die Sophisten gehen zur Sache. Wenn man sich überlegt, wie viele Politiker in einer Stadt wie Athen zugange waren. Ständig gab es Gerichtsverhandlungen. Die Archonten haben sich getroffen, um die Stadt zu regieren. Es gab Auseinandersetzungen auf der Wortebene. Ein idealer Nährboden.
Die Sophisten taten genau das, was die Gemeinschaft von Lehrern erwartete. Nämlich genau diejenigen auszubilden, die diese Stadt regieren sollten. Auf der einen Seite gab es die Ehrgeizlinge, die als einfache Bürger in der Demokratie nach oben wollten, auf der anderen Seite die Verlustängste der Aristokratie. Beide mussten quasi „gecoached“ werden. Die Sophisten brauchten nur die Hände aufzuhalten: Give me ten piaster, please.
Vossenkuhl:
Du hast das vorher sehr schön mit dem Beispiel geschildert: Ein Philosoph kommt an. Alle rennen zum Bahnhof.
Man erwartete von diesen Männern Wunderdinge allein durch die Rede. Man hat sich völlig dem, was die sagten, hingegeben und ließ sich bewegen. Das war wie in der Tragödie, wie im Theater.
Der Protagoras war der Meinung, die Kunst bestehe darin, etwas, was schwach erscheint, stark zu machen.
Denk doch mal, was heute los ist! Diese Art von Sophismus ist wieder enorm gefragt! Wir sollen in den Universitäten etwas, was schwach erscheint, stark machen. Der Chef der Deutschen Bank will etwas, was schwach erscheinen könnte, schon vorab, bevor es so erscheint, stark machen. Man will doch ständig etwas anders erscheinen lassen, als es möglicherweise ist. Das ist doch eine hochmoderne Haltung!
Dass diese Männer vor 2.500 Jahren es verstanden, durch ihre Redekunst die Menschen so zu beeindrucken, das deutet darauf hin, dass sie richtige Superstars gewesen sein mussten. Das gibt es heute nicht mehr.
Übrigens habe ich vorher vorschnell gesagt, dass die Wortkünstler keine Zukunft hatten. Die Sophistik, die Kunst der Rede, hat noch in römischer Zeit, einige Jahrhunderte später gut funktioniert. In Rom wäre sogar einmal ein Grieche fast gesteinigt worden, weil er an einem Nachmittag eine These vehement vertreten hatte und am anderen Tag die gegenteilige ebenso überzeugend. Diese Art von Humor verstanden die Römer nicht. Oder besser: Sie wussten diese hohe Kunst nicht zu schätzen.
Lesch:
Schade eigentlich.
Vossenkuhl:
Die Griechen hatten da mehr Humor. Sie waren da lockerer – oder vielleicht auch klüger.
Lesch:
Das kann aber auch ausarten. Dieses: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Wie oft haben wir schon erlebt, dass jemand gesagt hat: Hier stehe ich und kann nicht anders. Tags darauf konnte er dann doch ganz anders. Das sah sehr nach einem 180 Grad-Schwenk aus.
So gesehen haben die Sophisten ganz gut durchgehalten. In 2.500 Jahren haben sie sich offenbar noch vermehrt. Die Politik scheint ja weltweit zu einer gepflegten Sophistik geworden zu sein.
Vossenkuhl:
Einspruch, Euer Ehren! Ein guter Sophist hätte die Vorzüge der Magnetschwebebahn zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Flughafen sicher etwas überzeugender rüberbringen können als ein unfreiwillig als Komiker dilettierender bayerischer Spitzen-Politiker. Das gilt sicher für den Bahnhof in Stuttgart 21, das Atomendlager-Problem und einiges Deutschland-Bewegendes auch.
Lesch:
Einspruch stattgegeben. Nach dem Studium der Sophisten würde ich sogar sagen, man hätte sie dringender nötig als bisher. Die Leute, die Meinungsbildner und Entscheider darin ausbilden könnten, ein Wort so zu führen, dass es auch tatsächlich etwas aussagt und verstanden wird. Dass es nicht so ein Sprachbrei wird, in dem du am Ende nicht weißt, was er jetzt eigentlich sagen wollte.
Die Sophisten haben in dieser Hinsicht etwas geleistet.
Vossenkuhl:
In jedem Fall. Wir sollten noch fragen: Worin unterscheiden sie sich eigentlich von dem, was gleichzeitig und davor war? Dieser Blick auf den Menschen. Kann man sich eigentlich Sokrates ohne die Sophisten vorstellen? Nein. Weil Sokrates etwas ganz Wesentliches von den Sophisten übernommen hat. Übrigens wurde er von manchen auch noch als Sophist gehandelt.
Es ist die Hinwendung zum Menschen. Nicht mehr der Kosmos, nicht mehr die Urgründe und die Urelemente zählen, sondern das, was der Mensch ist, und wie der Mensch die Welt sieht, das zählt. Das ist schon eine gewaltige Wendung. Weg vom metaphysisch Abstrakten, hin zum konkreten Menschen.
Lesch:
Ist das damals ein Thema gewesen? Hingen solche naturphilosophischen Großkonzeptionen nach einer Weile wirklich zum Halse heraus? Musste dann wieder einer kommen, der ein anderes Element zu etwas ganz Wichtigem erhob?
Vossenkuhl:
Seit es Menschheitskulturen gibt, war es immer wieder – in Sinuskurven schwingenden Intervallen – so, dass sich bestimmte Ideen verbrauchten. Ich glaube, wenn man eine Idee einmal verstanden hat, dann ist eine gewisse Spannung weg. Man gewöhnt sich an sie, zerlegt und verfeinert sie. Dann gibt’s Widerlegungen, dann Alternativen. Irgendwann verflüchtigten sich diese Verästelungen der Entwicklung, diese Diversifikationen oder diese Vervielfältigungen einer Idee so, dass man die Übersicht verliert. Dann wendet man sich wieder dem Klaren, Einfachen, Simplen zu. Das hat eine gewisse Eigendynamik.
Die Hinwendung zum Menschen hatte sicherlich auch zeitgeschichtliche Gründe. Man wollte einfach in der Zeit denken, in der man lebte. Und das war ja eine hochproblematische Zeit.
Kriege und sonstige Auf’s und Ab’s. Ich glaube, die Zeit verlangte nach etwas Menschennahem. Nicht mehr diese doch sehr abstrakten Theorien, ob nun das Sein Werden ist oder welche Grundelemente es gibt, also diese „Archai“. Ich glaube, dass das Bedürfnis nach etwas Konkretem immer stärker geworden ist.
Lesch:
Aber ist es wirklich das Einfachere, zu dem man sich da hingewandt hat? Ich behaupte ja immer, Physik sei relativ einfach, vor allen Dingen die Kosmologie. Das Universum ist halt groß, leer, alt und kalt und es lässt sich berechnen. Das kann man in Differentialgleichungen hinschreiben. Über Menschen geht das nun mal nicht.
Man vergleiche nur das, was die Sophisten gemacht haben mit den naturphilosophischen Vorstellungen von dem, was hinter dem sichtbaren Sein ist, also mit der Seinslehre von Parmenides. Der war ja gewissermaßen der Urvater der Ontologie. Verglichen damit ist doch das, was die Sophisten versucht haben, wahnsinnig viel schwieriger.
Dieser Satz: „Aller Dinge Maß ist der Mensch, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind“. Wenn man diesen Satz ganz falsch versteht, dann könnte man sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Er bestimmt alles das, was um ihn herum ist. Das wäre ein ganz starker Subjektivismus. Die Welt ist so wie sie ist, weil ich sie so empfinde, oder so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme, und damit ist die Sache erledigt. Es gibt gar keinen objektiven Grund, über den wir beide uns einigen könnten. Noch nicht einmal über Farben oder sonst irgendwas.
Daraus erwächst eine Methode, eine Kunst, die es sich zur Aufgabe macht, das Instrumentarium des Menschen bei der Kommunikation mit der Welt zu schärfen: die Sprache.
Dass die Sophisten das gewagt haben, finde ich enorm. Das müssen sehr selbstbewusste Männer gewesen sein.
Vossenkuhl:
Es ist ihnen auch nicht immer so gut bekommen. Wegen seiner Infragestellung des Wissens von den Göttern bekam Protagoras große Schwierigkeiten. Das passte den damaligen Autoritäten gar nicht ins Konzept. Protagoras hat dann auch die Stadt verlassen. Gorgias hat solch heiße Eisen erst gar nicht angepackt. Auch deswegen ist er wohl so lange friedlich auf Erden gewandelt.
Es gab aber andere Sophisten, die vor allem in den „Platonischen Dialogen“ zu Wort kommen. Mit denen hat sich Platon sehr intensiv beschäftigt. Das ist ein Zeichen dafür, dass die ernst genommen wurden. Auch die Gefahren, die von ihnen ausgingen.
Heute ist man daran gewöhnt, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen den Gesetzen der Menschen und den Naturgesetzen. Das war damals so noch nicht in den Köpfen.
Lesch:
Aber es gab schon Gesetze, die von Menschen gemacht wurden. Von so jemand wie dem Gesetzgeber von Athen, dem Solon.
Vossenkuhl:
Das schon. Gerade Solon war einer der ganz großen Gesetzgeber. Theoretisch haben die Sophisten aber versucht zu erklären: Wann begann das denn mit den Gesetzen? Zumindest einer von ihnen dachte: Vorher gab’s einen Urzustand. So wie später bei Thomas Hobbes. Alle kämpften gegen alle. Da waren die Menschen sehr tiernah, sehr tierisch. Dann kamen die Gesetze und alles wurde besser.
Die Sophisten haben auch überlegt: Was ist nun der wirkliche Unterschied zwischen den Gesetzen, die die Menschen machen, die durch Übereinkunft zustande kommen, und denen der Natur. Da ist ein großer Unterschied!
Den merkt man vor allem - und das ist eine sehr interessante sophistische Einsicht - an den Folgen des Verstoßes gegen Gesetze. Wenn man gegen menschliche Gesetze verstößt, dann muss nicht unbedingt etwas passieren, vor allem dann nicht, wenn es keiner sieht. Sich nicht erwischen lassen. Es war eine sophistische Einsicht, dass das möglich ist.
Wenn du aber gegen Naturgesetze verstößt, da fällt dir einfach etwas auf den Kopf – im Zweifelsfall das Dach oder gleich der ganze Himmel.
Lesch:
Keine Chance. Gesetze, die von Menschen gemacht oder von Menschen und Göttern geschrieben werden, sind ja immer „du sollst nicht Gesetze“, die auch die menschliche Freiheit zum Thema haben. Du kannst dich zwar so verhalten, aber eigentlich solltest du dich anders verhalten.
Naturgesetze sind „du kannst nicht Aussagen“. Da gibt es keine Alternativen.
Während es bei Menschen oder eventuell auch bei Göttern einen Gerichtshof gibt, falls doch jemand mitkriegt, wie das Gesetz gebrochen wurde, so gibt es bei Naturgesetzen weder einen Gerichtshof, noch ein in „dubio pro reo“. Man kann nicht um Gnade winseln, es hilft alles nichts.
Vossenkuhl:
Die Einsicht, dass es da einen großen Unterschied gibt, hat zu viel Verwirrung geführt. Dieser Schwung der Aufklärung hat die Ordnung, die Denkordnung, so verändert, dass damit auch die politische Ordnung ins Wanken geriet.
Lesch:
Ach was.
Vossenkuhl:
Ja. Denn wenn die menschlichen Gesetze nicht mehr als ehern gelten, und nicht mehr für so stabil gehalten werden wie die Naturgesetze, also wie die Gesetze der Kosmologie, dann fragt der Mensch sich: Warum muss ich mich denn daran halten? Warum muss ich bei Rot an der Ampel stehen bleiben? Warum kann ich nicht weiter fahren?
Lesch:
Würde man heute sagen, dass die Sophisten nicht nur Wortkünstler und –Lehrer waren, sondern so eine Art „think tank“, also eher strategische Berater? Es waren ja sogar einige Sprach-Kämpfer dabei, die versucht haben in der Politik mit zu mischen.
Vossenkuhl:
Natürlich. Die waren zum Teil Politiker. Die haben mit vollem Risiko politisch agiert. Das waren nicht die selbstzufriedenen Bachus-Jünger in ihrem schattigen Gedanken-Hain. Die Pragmatiker haben sich richtig ins Getümmel geworfen.
Lesch:
Würdest Du heute sagen, dass dieser Zweig etwas ganz Besonderes, Einmaliges in der Philosophie gewesen ist? Können wir darauf hoffen, dass so was wieder passiert? Oder hat sich die Philosophie für immer in den kühlen Schatten ihrer Gedanken zurückgezogen?
Vossenkuhl:
Ich glaube, die Professionalisierung der Philosophie als Hochschulfach ist für ihre Rückkehr ins Getümmel des täglichen politischen Lebens eher ein Hindernis. Das waren ja damals keine verbeamteten Hochschullehrer. Es gab zwar Schulen. Die wurden aber erst in jener Zeit gegründet. Die Sophisten gehörten zu keiner Schule. Die waren auch nicht organisiert, hatten keine Gewerkschaft.
Lesch:
Das waren Einzelkämpfer. Also freischaffende Redner, die man engagieren konnte.
Vossenkuhl:
Das war immer eine „one man show“.
Lesch:
Die Guten waren auch im breiten Volk bekannt. Stars, die bei ihrem Erscheinen für Massenauflauf sorgten. Wenn ein Sophist in die Stadt kam, dann rannten wirklich alle hin und wollten ihn sehen und hören.
Vossenkuhl:
Ja, das war so wie heute „Bayern München“ gegen „Borussia Dortmund“.
Lesch:
Man muss sich das noch einmal vor Augen führen, was für einen Schritt die Philosophie da eigentlich getan hatte. Auf einmal schlagartig weg vom Universum und dem, was hinter den Dingen steht. Auf einmal steht da einer auf dem Marktplatz und sagt: Es ist nichts. Wenn etwas ist, dann können wir es nicht erkennen. Und wenn wir es erkennen können, dann können wir es nicht wiedergeben. Die Leute müssen doch gedacht haben: Jetzt ist es aber gut. Jetzt schlägt es dem Fass den Boden raus.
Vossenkuhl:
Um mit einer netten Dame irgendwo ins Gespräch zu kommen, ist das auch nicht die richtige Einleitung.
Trotzdem: Die Sophisten als Meister des Wortes und dessen Verdrehung schafften es – zumindest einige Zeit – die antike Welt in Atem zu halten.