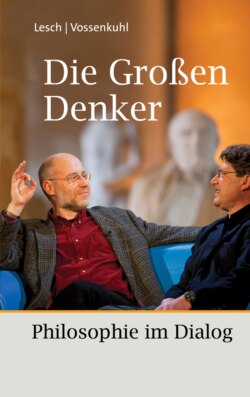Читать книгу Die Großen Denker - Harald Lesch - Страница 9
Zur Weisheit:
ОглавлениеLesch:
Weise zu sein lohnt sich auf lange Sicht. Nicht unmittelbar, aber es lohnt sich. Weisheit ist heutzutage geradezu ein Produkt und wird gerne gekauft. Da stapeln sich Bücher, DVDs, CDs, was immer man will. Nur, es nützt so nichts. So macht es nicht weiser.
„Wir brauchen die Weisheit dann am nötigsten, wenn man am wenigsten an sich glaubt“, sagt Hans Jonas, einer der Weisheitslehrer.
Große Liebhaber der Weisheit sind natürlich die Philosophen. Als Wissenschaftler habe ich mit Weisheit gar nichts am Hut. Ich habe mein Wissen, und das ist es dann schon.
Willi, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit?
Vossenkuhl:
Da gibt es viele Unterschiede. Wissen kann man erweitern und vertiefen. Wissen kann man sich aneignen, und das ganz gezielt. Bei der Weisheit geht das nicht so einfach nach Plan. Um weise zu sein, bedarf es einer Menge Dinge, die mit Wissen im engeren Sinn gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Menschenliebe, Nächstenliebe, Sympathie und Wohlwollen für Andere, Desinteresse an bestimmten materiellen Gütern, menschliche Wärme, Mitgefühl und so fort. Das sind alles Dinge, die mit Wissen gar nichts zu tun haben, die aber zur Weisheit gehören. Der Weise beurteilt die Dinge auch auf der Basis von Wissen. Aber die weise Entscheidung, die ist nicht primär wissensabhängig. Wissen ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Weisheit.
Lesch:
Kann man denn herausfinden, ob jemand weise oder ob er eher ein Wissender ist? Kann man erkennen: Das ist ein Weiser und das ist eher so ein Besserwisser?
Vossenkuhl:
Es gab schon leuchtende Beispiele für Weisheit: Salomon, Sokrates, Jesus. Es gibt auch Beispiele für weise Entscheidungen. Kennst Du Brechts Geschichte vom kaukasischen Kreidekreis?
Lesch:
Nein.
Vossenkuhl:
Zwei Frauen, die eine ist mit einem Gouverneur verheiratet, die andere ist eine Magd, behaupten – jede für sich - vor einem Richter, sie seien die leibliche Mutter eines Kindes. Das Kind war in Kriegswirren seiner leiblichen Mutter entrissen worden und von der Magd aufgenommen und liebevoll versorgt worden. Der weise Richter, der früher ein einfacher Dorfschreiber gewesen war, überlegt nun, wie er zwischen diesen Ansprüchen entscheiden soll. Äußere Merkmale gibt es keine. Wie soll er dann herausfinden, wessen Kind es ist? Es gibt keine DNA-Untersuchung, keinen genetischen Fingerprint wie heute. Also, wie kann er gut und richtig entscheiden?
Er schlägt vor - und das ist sehr weise – das Kind in einen weißen, mit Kreide gezogenen Kreis zu stellen und die beiden Frauen an jeweils einem Arm des Kindes ziehen zu lassen. Die rechtmäßige Mutter würde – so die Idee – schon kräftig genug ziehen. Tatsächlich reißt die Gouverneursgattin, die übrigens die wirkliche leibliche Mutter des Kindes ist, das Kind mit Gewalt an sich. Die Magd läßt den Arm los, um dem Kind nicht weh zu tun. Sie bekommt das Kind, obwohl sie nicht die leibliche Mutter ist. Sie zeigt aber, dass sie das Kind liebt.
Das ist eine weise Entscheidung.
Lesch:
Das heißt auch, dass Bertolt Brecht ein Weiser war, weil er sich diese Geschichte hat einfallen lassen?
Vossenkuhl:
Zumindest wusste er, was Weisheit ist.
Lesch:
Was man heute gerne wissen möchte, ist doch: Wie werde ich weise? Es gibt ja alle möglichen Übungen, um in acht Stufen zum Erleuchteten zu werden. Kann man aber Kriterien finden, über die es sich zu sprechen lohnt, an denen man Zeichen von Weisheit fest machen kann? Die Philosophie ist doch die Liebe zur Weisheit. Da fühle auch ich mich angesprochen. Tummeln sich doch die Wissenschaften in der Nähe der Philosophie.
Vossenkuhl:
Ein untrügliches negatives oder indirektes Kennzeichen von Weisheit ist, dass man von sich selbst nicht behaupten kann, ein Weiser zu sein. Also, wenn ich sagen würde, ich bin ein Weiser, dann dürftest Du gerne auf meine Kosten lachen.
Lesch:
Das mache ich immer wieder gerne.
Vossenkuhl:
Ich könnte Dir, wenn Du mich fragst, sagen, wie viel Uhr es ist. Das weiß ich.
Aber man kann von sich selbst nicht wirklich sagen, man sei weise. Das muss sich zeigen. Natürlich gilt das auch für das Wissen. Nehmen wir als Beispiel das eigentliche Thema des kaukasischen Kreidekreises, die Gerechtigkeit.
Ein weiser Richter, der so gerecht wie im Fall des kaukasischen Kreidekreises entscheiden will, muss schon eine Menge über das wissen, worum es geht. Er muss aber auch umsichtig sein, er muss Übersicht haben. Er muss in der Lage sein, nach hinreichender Abwägung zu sagen: Ich weiß vieles nicht, ich kann vieles gar nicht wissen, aber ich muss trotzdem jetzt entscheiden. Und in dem, was er tut, muss sich zeigen, dass er gerecht ist, dass er nicht sich sondern den Menschen und der Sache der Gerechtigkeit dienen will. Das ist Weisheitsliebe am Beispiel der Gerechtigkeit. Sie setzt voraus, dass derjenige, der gerecht entscheidet, nichts für sich selbst will. Das ist ein wichtiges Kennzeichen der Weisheit.
Wenn man nur über Wissen verfügt, neigt man zum Recht Haben Wollen und damit indirekt zum Egoismus. Wenn ich meine, mehr zu wissen als andere, glaube ich auch mehr Recht als andere zu haben. Wir leben in einer Zeit, in der genau dieser Charakterzug des Mehr-Wissens Vorrang vor der Weisheit genießt. Wer heute denkt, dass er mit seinem Wissen etwas gewinnen kann, wird es auch versuchen, egal wie groß das Risiko dabei ist.
Lesch:
Wenn man etwas gewinnen kann, dann versucht man’s auch. Genau.
Vossenkuhl:
Während der Weise sagt: Wozu soll ich gewinnen?
Lesch:
Das klingt so, als ob es Voraussetzungen für Weisheit gibt. Weisheit erfordert zum Beispiel, dass man überhaupt in die Situation kommt, weise sein zu müssen. Man muss z.B. eine Entscheidung treffen. Entweder für andere oder für sich selbst. Es scheint etwas in uns drin zu sein – zumindest dann, wenn wir genügend Erfahrung haben – das wir fühlen können: Ach, das passt so, das ist gut so.
Es scheint mir so zu sein, dass es durchaus bestimmter Voraussetzungen bedarf, um überhaupt nur in die Nähe dieses Anspruchs der Weisheit zu kommen. Ich habe den Eindruck, dass derjenige schon gar nicht weise wird, der ständig versucht, weise zu werden. Nein, das geht nicht zusammen.
Die Weisheit entzieht sich eher, wenn man danach sucht. Warum haben wir eigentlich – Ausnahmen bestätigen die Regel - so einen unglaublich starken Drang dazu, Wissen zu sammeln? Was Weisheit betrifft, da sind wir doch eigentlich eher sehr, … na, wie soll ich es sagen, zögerlich. Es gibt zweifellos weise Personen, die werden aber nicht so gut bezahlt, wie diejenigen, die „nur“ was wissen.
Vossenkuhl:
Das ist richtig, ja.
Lesch:
Wie kommt das?
Vossenkuhl:
Das kann ich Dir auch nicht erklären. Aber ein Unterschied zum Wissen bleibt wichtig. Es gibt sehr viele Arten des Wissens, und es gibt mindestens ebenso viele Arten von Weisheit. Der Unterschied ist, dass das Wissen allein die Weisheit nicht ausmacht.
Es gibt Menschen, die keinerlei Schulbildung haben, also keine sog. „formale Bildung“, die aber trotzdem einfach weise sind, weil sie aus der Lebenserfahrung so viel an Bildung und Wissen mitgenommen haben, dass sie zum Beispiel wissen, wann sie was tun sollen, wann sie sich zurückhalten sollen, wann sie dem anderen seinen Vortritt lassen sollen, wann sie höflich oder hilfsbereit sein sollen, wem sie trauen können und wem nicht.
Das sind Erfahrungsgrößen, zu denen natürlich auch Wissen gehört, Erfahrungswissen, nicht formales Wissen. Und der Einsatz dieses Wissens „wie“, das kann ein Klempner, eine Putzfrau oder ein Schuhputzer genauso einsetzen wie ein Akademiker oder ein Bankdirektor.
Lesch:
Gerade Letzterem könnte ein kräftiger Schuss Grundweisheit nicht schaden. Nun denn.
Das wäre ja durchaus dann ein Begriff aus der heutigen Welt, die sich sehr stark auf Quantifizierbares, also Nachvollziehbares konzentriert. In deinem Lebenslauf muss alles drin stehen, was du kannst, und der Eindruck, den man von dir hat – auch, ob du weise bist – der ist entscheidend. Obwohl du, - sagen wir mal – der Papierform nach nicht unbedingt als Bester unter den Kandidaten erscheinst. Da würde ich mir wünschen, dass die Leute dann sagen: Hm, weise ist er auch noch. Das riskieren wir, wir nehmen ihn.
Weisheit hat so was völlig Unzählbares. Das ist nicht quantifizierbar. Und damit wird es natürlich immer schwieriger. Da muss ich mal ganz kurz einen tiefen Griff in die Kiste machen: Bei den Griechen gab es sieben Weise, mindestens. Thales zählte als einziger Philosoph zu diesem erlauchten Kreis. Die anderen Namen habe ich jetzt nicht parat. Aber es finden sich da so Aussagen wie „Maß halten“, „nicht über die Stränge schlagen“ usw. Das gehörte da wohl dazu.
Vossenkuhl:
Man hat auch versucht, ein Training, so einen Grund-Codex, einen Aufbau-Kurs „Wie wird man Weise“ anzubieten. Da gab es aber keine Abschlussprüfung. Das musste sich einfach zeigen. In der Antike war klar, Tugend, Mut, Dankbarkeit, Gerechtigkeit, das muss man üben. Irgendwann mal hat man’s drauf. Und so ist es eben mit der Weisheit auch. Weisheit, irgendwann hat man sie verinnerlicht.
Das geht aber nicht in jedem Beruf, in jedem Lebenslauf. Ein weiser Fußballer ist nicht leicht vorstellbar. Vielleicht ein weiser Trainer, der im Umgang mit seinem Team weise ist. Der nicht einen gegen den anderen ausspielt, zum Beispiel.
Lesch:
Das sollte er seinen Spielern auf dem Platz überlassen. Aber ein weiser Fußballer könnte doch einer sein, der merkt: Hier fühle ich mich wohl. Ich habe zwar Angebote, die mehr Geld versprechen, aber das ist mir nicht so viel wert, wie andere Dinge, deren Wert ich höher schätze. Familie, Freunde.
Vossenkuhl:
Das wäre ein weiser Entschluss als Privatmann. Aber als Fußballer auf dem Feld?
Lesch:
Eher nicht. Da hat Du schon recht.
Vossenkuhl:
Oder noch extremer, ein weiser Rennfahrer.
Lesch:
Der muss Gas geben. Bleifuss. Aber auch rechtzeitig bremsen. Das ist es dann.
Vossenkuhl:
Oder ein weiser Radfahrer.
Lesch:
Da wo ich bin, ist vorne. Und wenn ich hinten bin, ist hinten vorne. Nö. Geht wohl auch nicht.
Vossenkuhl:
Aber weiser Politiker. Das geht.
Lesch:
Das geht, ja.
Vossenkuhl:
Oder ein weiser Arzt, der nicht einfach Rezepte ausstellen will, sondern sagt: Ich glaube, Sie sind gesund.
Lesch:
Aber das hat ja dann durchaus etwas damit zu tun, dass jemand da ist, für den gehandelt oder Entscheidungen getroffen werden müssen. Also gerade bei Politikern, bei Ärzten, Richtern usw., also immer dann, wenn andere Menschen involviert sind. Bei so einem Rennfahrer, mein Gott, der sitzt in seiner Kiste drin und gibt einfach Gas.
Vossenkuhl:
Richtig.
Lesch:
Der kann ja gar nichts machen.
Vossenkuhl:
Und wenn er nicht als Erster ankommt, dann hat er verloren.
Es ist was Komisches mit der Weisheit. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der der Wert der Weisheit nicht richtig anerkannt wird.
Lesch:
Es glaubt ja auch keiner dran.
Vossenkuhl:
Wie hat Jonas das noch einmal formuliert?
Lesch:
Wir brauchen die Weisheit am nötigsten, wenn man am wenigsten an sie glaubt. Mit Weisheit kannst du doch heute keinen mehr umreißen. Im Gegenteil. Wenn sich jemand Zeit nimmt, um über eine Entscheidung nachzudenken und nicht sofort eine schnelle Antwort parat hat - auch nicht die entsprechenden Floskeln - der wird doch gar nicht mehr ernst genommen.
Ich habe den Eindruck, dass Weisheit etwas mit Langsamkeit zu tun hat.
Vossenkuhl:
Langsamkeit ist ein gutes Wort dafür. Man kann auch sagen: Zurückhaltung oder sich zurücknehmen, also nicht puschen, nicht vordrängeln.
Lesch:
Nicht so leicht, in Zeiten des Wettbewerbs.
Vossenkuhl:
Da wird Zurückhaltung sogar bestraft.
Lesch:
Es gibt ja Unternehmen, bei denen Mitarbeiter, die nicht mehr aufsteigen oder vorwärts wollen, ins Austragshäusel abgeschoben werden. Die Firma möchte unbedingt Leute haben, die motiviert sind, die durchbrechen wollen. Weisheit als Qualifikation? Nein, danke!
Vossenkuhl:
Du siehst schon an der Sprache dieses Milieus, wie unweise das Ganze ist. Wenn Leute entlassen werden, spricht man von „Freisetzen“. Das klingt so nach „Freilandversuch“.
Lesch:
Wie Hühner oder Gen-Mais.
Vossenkuhl:
Das ist doch absurd. Die Sprache verrät den Mangel an Weisheit. Man sollte eher Mitleid oder Mitgefühl für solche Menschen haben. Aber nein. Man redet von Freisetzen.
Langsamkeit ist sicher eine gute Voraussetzung für Weisheit. Nicht übereilen, nicht zu schnell. Aber wer hat denn heute noch Zeit?
Lesch:
Wir sitzen hier ganz entspannt…
Vossenkuhl:
… und trinken ein Gläschen Rotwein.
Und können das in Ruhe angehen.
Lesch:
Wir erzählen anderen Leuten, dass sie weise sein sollen oder dass sie´s langsam angehen lassen sollen. Währenddessen bei denen aber unter Umständen irgendwas unter den Nägeln brennt.
Ich meine, der große Trick scheint mir die Sache mit dem leichten Gepäck zu sein. Da könnte uns die Philosophie ja durchaus einen ganz wichtigen Weg hin zur Weisheit weisen. Wenn man nämlich sagen könnte: Schauen wir uns doch mal unsere Situation an. Je mehr wir uns in Zwänge hinein begeben, umso unfreier werden wir. Und Unfreiheit, unfrei zu sein, das kann doch nicht richtig sein. Man könnte sich auch fragen: Wie würde ich mich eigentlich am wohlsten fühlen?
Sicher nicht unter all den Zwängen, die ich mir möglicherweise selber an den Hals gehängt habe. Da könnte ja Lebensweisheit über eine Art von philosophischer Betrachtung sehr wohl helfen. Ich würde die Philosophie immer noch gerne mit Weisheit in Verbindung bringen und sie nicht nur als reine Wissenschaft behandeln.
Vossenkuhl:
Das würde ich auch gerne. Aber …
Lesch:
Das hört sich nicht gut an, wenn Du das so sagst.
Vossenkuhl:
Ich habe vorhin gesagt: Niemand kann von sich selber sagen, dass er weise ist. Entweder es zeigt sich oder nicht. Man kann auch nicht von sich selber sagen, dass man gut oder ein guter Mensch ist. Entweder man handelt so oder hält ansonsten den Mund. Das passt allerdings so gar nicht in unsere Zeit. Der Spruch, der viel kolportiert wird: „Tue Gutes und sprich darüber“, der ist ja das Unweiseste, was man sich vorstellen kann. Aber es macht Eindruck. Der Weise allerdings will gar keinen besonderen Eindruck machen.
Lesch:
Eindruck machen macht nicht weise.
Vossenkuhl:
Eindruck schinden. Aber wenn du Philosoph sein willst, brauchst du Aufmerksamkeit. Du musst dich bemerkbar machen.
Lesch:
Quak, quak, quak.
Vossenkuhl:
Du musst die Trommel rühren. Das ist natürlich gar nicht weise. Aber du brauchst Aufmerksamkeit. Es kann wiederum weise sein, wenn du dich zeigst. Die Frage ist: Wie? Hinzu kommt erschwerend, dass von den Leuten, die dir zuhören, auch nicht besonders viele weise sein werden. Es ist ein Dilemma.
Man darf aber nicht vergessen, dass in der guten alten Antike die Philosophen, wie man heute sagt, Jobs hatten. Entweder sie waren von Haus aus wohlhabend oder sie haben sich mit dem Wenigen, das sie hatten, zufrieden gegeben.
Heute kannst du als Philosoph nicht überleben. Wie soll der Philosoph leben, wo sind die Nischen? Ich kenne keinen einzigen, der nicht irgendeine formelle Tätigkeit ausübt oder sich mit einer philosophischen Praxis selbstständig gemacht hat. Der also nicht auf eine relativ unweise Art in seine Weisheits-Lehrerrolle gerutscht ist.
Lesch:
Das ist natürlich jammerschade. In dem Moment, wo die Philosophie angefangen hat, sich so zu benehmen wie eine normale Wissenschaft, ist sie dem ganz normalen Trott verfallen. Sie hat offenbar etwas ganz Wichtiges hinter sich gelassen. Immerhin den Kern oder zumindest einen gewichtigen Teil ihres Ursprungs.
Vossenkuhl:
Man könnte eine quasi therapeutische Untersuchung dieses Prozesses machen und überlegen, was da alles schief gegangen ist. Eines ist sicher: Von dem Moment, als die Philosophen nicht mehr daran glaubten, dass sie im gesellschaftlichen Leben eine vernünftige Rolle spielen könnten, von da an haben sie angefangen, nur noch zurückschauen und die Geschichte zu betrachten. Nur noch zu lesen und nachzugrübeln, was andere dachten. Als Training ist das gut. Der Weise muss natürlich auch historisch gebildet sein.
Lesch:
Er muss was wissen, damit er weise werden kann.
Vossenkuhl:
Aber die Geschichtsbetrachtung ist eigentlich mehr oder weniger zu einer Ersatzhandlung geworden. Man flüchtet sich in das, was andere dachten. Damit weicht man dem Druck aus, dem man ausgesetzt ist. Entweder man macht Klamauk oder flüchtet sich in die Geschichte oder man tut so, als wäre man wahnwitzig clever.
Das sind alles Ausweichmanöver. Wenn man nichts weiß, wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man den Mund halten. Der Satz 7 am Ende des „Tractatus“ von Wittgenstein sagt: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“. Aber das wird natürlich heute mehr oder weniger als Spruch fürs Poesiealbum benutzt.
Was der Satz meint, ist natürlich sehr ernst. Wenn du nichts zu sagen hast, Mann, dann halt den Mund. Und das auch zu tun, ist dann eine weise Entscheidung.
Lesch:
Gilt übrigens auch für das weibliche Geschlecht.
Wäre es nicht jetzt geboten, bei den vielen Problemen, die es namentlich in Europa, vor allem aber auch in Deutschland gibt, dass man sich mal überlegt: Unter welchen Bedingungen werden Entscheidungen getroffen? Das ist ja zunächst einmal bis zu einem gewissen Punkt ein rationaler Prozess. Dann allerdings wird es irrational.
Ich habe schon den Eindruck, dass Weisheit nicht etwas ist, das ich so dahin sagen kann: Ach, guck mal hier, das ist die Weisheit. Also so etwas, das ich mit der Ratio erfassen kann. Das ist eher so ein Gemisch. Eine Mixtur aus möglicherweise Herz und Hirn, um es mal so zu sagen.
Vossenkuhl:
Ja, ja, gut.
Lesch:
Es müsste ein Gefühl für etwas Gutes sein. Wäre es nicht schön, wenn es gelänge, eine geistige Strömung in Europa zu entwickeln, bei der eben nicht alles über den Aktienindex abzurechnen ist und nicht alles über den unmittelbaren Nutzen beurteilt wird. Wenn es zum Beispiel gelänge, Manager dazu zu bewegen, sich doch mal zu überlegen, ob ein unmittelbarer Vorteil eher langfristig ein Nachteil ist. Das wäre doch schön, wenn die Freunde der Weisheit sich mal wieder auf ein solches Gebiet hinaus wagen würden. Sie haben doch was zu sagen.
Ich glaube, die Philosophie hat da schon fast einen Minderwertigkeitskomplex, wenn sie einen ihrer wichtigsten Bereiche, nämlich die Weisheit preis gibt. Ich sage das mal - wir sind ja unter uns – dieses hohe Gut sogar noch irgendwelchen dahergelaufenen Lebens-Beratern überlässt, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die füllen ganze Bücher damit, was Philosophen zum Thema Weisheit gesagt haben. Das wird dann in irgendeinem XYZ-Verlag veröffentlicht. Das ist doch Mist!
Vossenkuhl:
Ja, natürlich. Machen wir einfach ein Gedankenexperiment. Man macht so etwas, was Du vorgeschlagen hast. Da wäre – nehmen wir an – ein Bank-Manager, der vorher noch sagte, wir steigern jetzt die Gewinnmarge von sagen wir mal 20 auf 25 %, für die Inhaber der Bankaktien. Nachdem er erfahren hat, was eigentlich weise wäre, nämlich Menschlichkeit, Mitgefühl und soziale Verantwortung zu pflegen, etwas für die anderen zu tun, Geld für Kultur und Wissenschaft zu stiften, kommt er in seine Bank zurück und sagt: Leute, ich glaube, ich hab einen völlig falschen Weg gewählt. Seinen Aktionären sagt er: Ich empfehle euch, verzichtet auf Gewinne, macht etwas, was den Menschen nützt, einen Akt der Menschenliebe.
Den würde der Aufsichtsrat sofort rausschmeißen, oder? Der würde doch nicht lange auf seinem Stuhl sitzen?
Lesch:
Sagt er nichts, bleibt er sitzen.
Vossenkuhl:
Er macht das, was die Leute wollen. Es wird also der Egoismus bedient. Unweise daran ist, dass aus dem Egoismus, der eine natürliche menschliche Anlage ist, dass daraus ein Recht, ein Anspruch abgeleitet wird, der nicht der Menschlichkeit dient. Das ist unweise.
Lesch:
Ein weiser namhafter Manager, wenn der aus einer solchen Erkenntnis heraus handeln und sich vor seine Aktionäre hinstellen würde - das wäre schon eine beachtliche Verstärkung der Truppen. Mit solchen Leuten könnte man dann weiterarbeiten. Man könnte sagen: Jetzt ist aber Schluss, es gibt grundsätzliche Handlungsanleitungen. Wichtig wäre es dann noch, diese Weisheit zu untermauern.
Wir haben ja heutzutage durchaus solche Begriffe, die meiner Ansicht schon geradezu inflationär benutzt werden und deswegen ihren Wert wieder verlieren. Eines dieser Schlagworte ist „Nachhaltigkeit“.
Es ist ein Irrtum, etwas Gutes kaufen zu wollen, und es auch noch für `nen Appel und ein Ei zu kriegen. Das ist doch irrsinnig, das kann nicht sein. Etwas Gutes kann nicht billig sein.
Vossenkuhl:
Du meinst jetzt dieses „Geiz ist geil“
Lesch:
Ja. Ganz genau.
Vossenkuhl:
Ich erinnere mich. Eine große deutsche Luftfahrtgesellschaft hat mal vor Jahren etwas sehr weises gemacht. Die haben, um diese Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, große Anzeigen geschalten. Da stand drin: „Wir fliegen nicht überall hin“.
Lesch:
Ja, schön.
Vossenkuhl:
Und da waren die letzten Reservate der Menschheit auf dem Globus drauf. Das fand ich sehr weise zu sagen, wir wollen nicht überall hin. Ich glaube, das war eine sehr weise Entscheidung, weil es die Glaubwürdigkeit dieses Unternehmens unterstrichen hat.
Lesch:
Ganz genau. Getreu dem Motto: Wir machen nicht alles, was Geld bringt. Wir drucken nicht jeden Blödsinn, wir fliegen nicht weiß Gott wo überall hin. Wir haben heutzutage Billigfluglinien, die zu Preisen zu buchen sind, bei denen man nicht mehr nachvollziehen kann, ob die überhaupt noch Gewinn machen können. Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, wie ich das eigentlich bezeichnen soll. Es ist dieses „Rolls-Royce-Bewusstsein“. Es geht einfach darum zu wissen, wo die Grenzen sind, bis wohin etwas Sinn macht. Und da ist dann aber auch Schluß.
Vossenkuhl:
Klingt gut.
Lesch:
Ja, Rolls Royce, jedenfalls wie die früher waren. Die haben dir nicht gesagt, wie viel PS die Maschine hat. Schon gar nicht, was sie kostet.
Vossenkuhl:
Genau. Musst man auch nicht wissen, wenn man in der Liga spielt.
Lesch:
Es ist genug. Its enough. Mehr als genug.
Es ist wichtig zu wissen: Es gibt gewisse Dinge, die macht man, und gewisse Dinge, die macht man nicht. Ich habe den starken Eindruck, dass Weisheitsverlust damit zu tun hat, dass ausgerechnet dieser Fundamentalbestand an dem, was man nicht tut, völlig zu verschwinden scheint. Geiz und Maßlosigkeit sind zwei dieser Todsünden.
Vossenkuhl:
Grauenvoll.
Lesch:
Wie kann man so was machen? Das sollte man nicht tun. Eines ist klar: Weise ist das nicht.
Vossenkuhl:
Ganz anders beim Wissen: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Das gilt allemal für das Wissen. Wissen ist immer unbescheiden. Um Wissen zu wollen, muss man unbescheiden sein. Man muss immer gegen die Grenzen stoßen – auch darüber hinaus.
Lesch:
Immer nach vorne.
Vossenkuhl:
Weisheit ist bescheiden. Ich neige mein Haupt vor dem Großen, vor den großen Geistern. Der Grund, warum ich die Schriften lese und das Denken der anderen kennen lernen will, ist Bescheidenheit. Es ist weise zu schauen: Was hat ein anderer über Wahrheit, über Freiheit, über das Gute gesagt. Aber man darf sich dann nicht damit begnügen, man darf sich nicht flüchten. Sonst wird es eine Ersatzhandlung, ein Ersatz für die Pflicht, selbst zu denken.
Lesch:
Dann ist natürlich auch klar, warum uns Weisheit heutzutage so wenig bedeutet. Weil viele von uns der Meinung sind, vor ihnen sei nichts gewesen und nach ihnen würde nichts mehr kommen. Sich nicht in einem historischen Prozess zu sehen, dass man letztlich, wie Newton das ausgedrückt hat, dass man als Zwerg auf den Schultern von Riesen steht und nur so ein bisschen zum Ganzen beitragen kann. Wenn dieses historische Bewusstsein nicht da ist, warum auch immer, dann wird natürlich Weisheit auch keinen Stellenwert bekommen.
Vossenkuhl:
Wir sollten also, wenn wir nach Weisheit streben, durchaus in den Rückspiegel schauen, in den Rückspiegel der Geschichte der großen Denker. Aber nicht als Ersatz dafür, auch nach vorne zu schauen. Wenn wir nur den Rückspiegel im Auge haben, dann sind wir Historisten. Dann sind wir nicht weise. Wir müssen schon den Mut haben, uns dem Hier und Jetzt auszusetzen. Egal, wie stark oder schwach wir uns fühlen.
Menschenliebe und Bescheidenheit, das sind die Charakterzüge der Weisheit, auf die wir auch heute nicht verzichten können, auch wenn sie noch so wenig anerkannt werden.