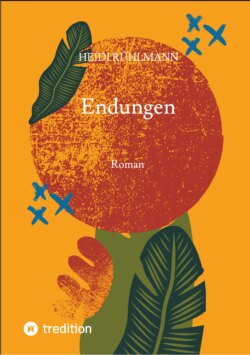Читать книгу Endungen - Heidi Rühlmann - Страница 11
ОглавлениеKapitel 7
Eberhard September
Das Zimmer, das er im Voraus für zwei Tage gebucht hatte, befand sich in Spandau in einem funktionalen Cityhotel zwischen Ikea, Kaufland und der S-Bahn Haltestelle Stresow. Von dort konnte er am nächsten Morgen direkt nach Elzin in den westlich von Berlin gelegenen Teil Brandenburgs starten, ohne sich durch den Berufsverkehr quälen zu müssen. Als er abends im Hotel eincheckte, hatte er sich kaum noch auf den Beinen halten können. Die Fahrt war anstrengend gewesen. Mit Unfällen, Staus, Dauerregen und Sturm hatte er wertvolle Stunden seiner knappen Lebenszeit vergeudet. Das nächste Mal würde er an einem Sonntag nach Berlin fahren. Montags war auf Autobahnen der Teufel los. Und dazu dieses Wetter.
Sein Magen grollte immer noch wegen der unzumutbaren Raststätten-Mahlzeit aus einer fetttriefenden Frikadelle und gerösteten Kartoffelecken, die an die Epidermis eines betagten Säugetiers erinnert hatten. Trotzdem war er noch hungrig. Im Hotelrestaurant blätterte er unkonzentriert die vielseitige Speisekarte durch und wählte eine schlichte Kürbiscremesuppe, die er so gierig verschlang, dass er sich den Mund verbrannte und ihn mit einem Glas Weißwein kühlen musste. Todmüde fuhr er anschließend mit dem Lift in die zehnte Etage, fiel in seinem Zimmer rücklings auf das Bett, trat die Schuhe von den Füßen und schlief auf der Stelle ein.
Er musste laut und lange geschnarcht haben, denn sein Hals war vollkommen ausgetrocknet, als er Stunden später aufwachte und verwundert feststellte, dass er angekleidet auf dem Bett lag. Das Handy zeigte 2:20 Uhr an. Seine Blase drückte, was ihn an die heiße Kürbiscremesuppe erinnerte, und daran, dass Kürbis eine entwässernde Wirkung hatte. Er stemmte sich hoch, schaltete die Nachttischlampe ein und schlurfte in das angrenzende Bad. Nachdem er sich erleichtert, Hände und Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt hatte, schlüpfte er in den Pyjama. Dann zog er die Gardine ein Stück zur Seite, ließ seinen Blick über die verregnete Stadt schweifen und fragte sich, was zum Teufel er eigentlich hier machte.
Gloria hatte recht. Es reichte! Er musste mit dieser zeitraubenden und im Grunde sinnlosen Arbeit aufhören und stattdessen die ihm verbleibende Lebensspanne mit schöneren Dingen ausfüllen. Darüber, was das sein könnte, wollte er sich hier und jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Das würde sich schon finden. Und plötzlich fasste er einen Entschluss. Es war ganz einfach und fühlte sich vollkommen stimmig an. Der morgige Beratungstermin würde sein letzter sein! Mit diesem Gedanken kroch er unter die Hoteldecke und versetzte sein Gaumensegel wieder in Schwingung.
Vier Stunden später wachte er ohne Weckruf auf und fühlte sich trotz der nächtlichen Unterbrechung vollständig erholt. Er duschte, rasierte sich, suchte frische Unterwäsche, Socken, ein schwarzes T-Shirt und ein graues Leinenhemd aus dem Koffer und fand, dass er die Jeans vom Vortag noch einmal tragen konnte. Schließlich fuhr er nicht zu einem Empfang in die Hauptstadt, sondern zu einem Bauernhof im Osten.
Vom Frühstückstisch sandte er Merle eine Nachricht, dass er in Berlin sei und sich gerne mit ihr verabreden würde. Dann wählte er Glorias Nummer. Sie nahm nicht ab. Vielleicht stand sie gerade unter der Dusche oder hatte das Handy wieder irgendwo hingelegt und vergessen. Bestimmt rechnete sie um diese Zeit nicht mit seinem Anruf. Er versuchte es noch einmal ohne Erfolg und wählte dann die Festnetznummer in seinem Büro. Nach fünfmaligem Klingeln meldete sich seine eigene Stimme und bat, eine Nachricht zu hinterlassen oder es später noch einmal zu versuchen. Er gab auf. Wo war Gloria? Was machte sie eigentlich morgens um acht, wenn er nicht da war? Er musste zugeben, dass er sich darüber zum ersten Mal Gedanken machte. Kurzzeitig wurde seine gute Laune von Besorgnis getrübt, die jedoch schnell wieder verflog. Er ging zum Buffet, zapfte heißes Wasser aus einem Samowar in sein Teeglas, tunkte einen Teebeutel hinein und setzte sein Frühstück fort. Er würde Gloria später noch einmal anrufen. Sie sollte seine nächtliche Entscheidung als erste erfahren.
Die alte Heerstraße führte schnurgerade aus der Stadt nach Westen. Eberhard überquerte die Autobahn und erreichte das flache Land, auf dem sich hunderte Windräder drehten. Irgendwo hinter Nauen bog er nach Süden ab und wurde von seinem Navi über immer schmalere und buckligere Landstraßen geleitet. Je schmaler die Straßen umso wilder die Drängler, dachte er, als erneut ein Audi älteren Baujahrs über Kilometer hinweg am Heck seines Volvos klebte und, nachdem Eberhard kurz die Bremse angetippt hatte, mit aufheulendem Motor und wütendem Hupen vorbeizog.
„Wohin so eilig? Der Weg ist das Ziel! Nicht die Straße“, rief er dem Fahrer nach, von dem er nur den Schirm seiner Baseball kappe wahrgenommen hatte. Er wunderte sich über sich selbst. War die Gelassenheit, mit der er neuerdings selbstmörderischem Verhalten im Straßenverkehr begegnete, plötzlich erwachte Altersweisheit? Oder Erleichterung darüber, dass er eine Entscheidung getroffen hatte, die vielleicht alles verändern würde?
Er durchquerte kleine Dörfer mit hübsch renovierten Häusern zwischen halb verfallenen Höfen und ehemaligen Ziegeleien, auf deren Dächern Birken wuchsen. Dann wieder abgeerntete, braune Maisfelder soweit das Auge reichte. Und über allem spannte sich ein blauer, weiter Himmel, in dem weiße Wolken segelten. Das Breskow' sche Anwesen lag abseits des kleinen Dorfes Elzin, das vollkommen ausgestorben wirkte. Ob es hinter den zugezogenen Gardinen Leben gab, konnte er nicht erkennen. Auch auf der Dorfstraße ließ sich keine Menschenseele blicken, die er nach dem Hof, von dem er keine genaue Adresse hatte, fragen könnte. Er parkte das Auto auf einem Stellplatz vor der Kirche und beschloss, da er noch Zeit hatte, einen Spaziergang zu machen, um sich die steifen Beine zu vertreten.
Bei seinem Rundgang um das Dorf stieß er auf eine schmale, alte Straße, die mit buckligen Feldsteinen gepflastert war, und folgte ihr. Nach einigen hundert Metern bog sie in einen Park mit altem Baumbestand ein, umrundete einen Teich, schlängelte sich unter riesigen Eichen bis zu einem offenstehenden, schmiedeeisernen Tor, hinter dem eine schnurgerade, gekieste Auffahrt bis an die Freitreppe eines alten Gutshauses führte. Eberhard trat durch das Tor und blieb vor dem Gebäude stehen. Er war in Architekturgeschichte nicht sonderlich bewandert, vermutete aber, dass dieser Backsteinbau aus dem 17. vielleicht sogar 16. Jahrhundert stammte. Das hohe Satteldach war mit roten Dachziegeln neu eingedeckt und die facettenartig gegliederten Fenster denkmalgerecht in Stand gesetzt. Über dem Portal entdeckte er das Sandsteinrelief eines Familienwappens, ebenfalls fachmännisch restauriert. Er stieß einen anerkennenden Pfiff aus. Hier hatte jemand richtig viel Geld in die Hand genommen.
„Gefällt es Ihnen?“
Eberhard fuhr herum. Hinter ihm stand eine Frau mit kurzgeschnittenen, grauen Haaren, die fast so groß war wie er, mindestens aber 1,80. Sie trug einen grünen Overall und geblümte Gummistiefel, die ihr etwas Britisches verliehen.
„Sehr eindrucksvoll“, stammelte er und war nicht sicher, ob er damit die Frau, das Gebäude oder beides meinte.
„Sind sie der Herr von ÖkoLa?“
„Ja, mein Name ist Eberhard Holm. Ich bin zu früh gekommen.“
Sie trat näher und gab ihm die Hand.
„Bettina von Breskow. Ich habe Sie schon erwartet. Kommen Sie rein.“
Sie schob sich an ihm vorbei, streifte die Stiefel ab, warf sie unter eine Bank und schlüpfte in bereitstehende Pantoletten.
Er ging in die Hocke, um seine Schnürsenkel aufzubinden, was ihn einige Mühe kostete. Am liebsten hätte er sich dazu auf die Bank gesetzt, wollte sich aber keine Blöße geben.
„Die können Sie anlassen. Auf das bisschen Sand kommt es nicht an“, sagte sie mit Blick auf seine Füße.
Erleichtert richtete er sich wieder auf.
„Der Rücken. Man wird nicht jünger.“
Mit einem Nicken gab sie ihm zu verstehen, dass ihr nur allzu bekannt war, was er meinte.
Er fuhr kräftig mit den Sohlen über einen Fußabtreter und folgte ihr durch die massive doppelflügelige Holztür. War er von der Fassade schon überwältigt gewesen, machte ihn das Hausinnere sprachlos. Der Eingang mündete in ein Vestibül mit sternförmiger Gewölbedecke, und einem riesigen, offenen Kamin. Im Hintergrund war eine barocke Treppe zu erkennen, die in das Obergeschoss führte. Zwei Männer mit staubbedeckten Overalls und Atemschutzmasken standen auf einem Gerüst, klopften alten Putz von der Wand und legten das rote Ziegelwerk frei. Frau von Breskow nickte ihnen kurz zu und bedeutete Eberhard, ihr zu folgen. Er schlängelte sich hinter ihr zwischen Schubkarren, Wannen voller Staub und Schutt, Werkbänken und Maschinen hindurch, bemüht, nicht über die Falten einer graue Bauplane zu stolpern, die den Boden bedeckte.
Schließlich erreichten sie einen bereits renovierten Raum mit einem rundum verglasten Erker, anscheinend die Basis des Turmvorbaus, den Eberhard draußen wahrgenommen hatte. Dort gruppierten sich elegante Designerstühle um einen antiken Tisch aus poliertem Eichenholz.
„Bitte nehmen Sie Platz! Kaffee oder Tee?“
„Tee wäre gut“, sagte Eberhard, dem einfiel, dass er seine Unterlagen im Auto vergessen hatte.
„Darjeeling, Earl Grey oder lieber Kräutertee? Ich kann Ihnen Pfefferminze, Hagebutte und Melisse anbieten.“
Er entschied sich für Pfefferminztee.
Sie nickte und verschwand durch eine helle Holztür hinter der sich vermutlich die Küche befand.
Eberhard trat an das Fenster und schaute in den Park. Er hatte einen kleinen Hof mit heruntergekommenen Gebäuden, veralteten Maschinen und einer hoch verschuldeten Bauernfamilie erwartet. Stattdessen war er in das Ambiente eines alten märkischen Adelssitzes geraten. Selten hatte er sich so unsicher gefühlt, was auch an Bettina von Breskow liegen konnte, die gerade mit einem Tablett zurückkam und es auf dem Eichentisch absetzte.
Sie zündete das Teelicht in einem Stövchen an, setzte die Glaskanne, in der ein Zweig frischer Pfefferminze schwamm, darauf und schob ein Teeglas zu ihm hin.
„Leider habe ich keine Kekse im Haus, nur ein wenig Shortbread“.
Er meinte sich zu erinnern, vor ewigen Zeiten in Schottland Shortbread probiert zu haben, wusste aber nicht mehr, wie es geschmeckt hatte. Während sie Tee einschenkte, nahm er ein mürbes Gebäckstück aus einer Schale und biss ab.
Es schmeckte köstlich. Das feine Aroma von gesalzener Butter und Vanille passte hervorragend zu dem Pfefferminztee, der seinen Mund, seinen Leib, ja seine ganze Existenz mit wohliger Wärme erfüllte.
„Hmm!“, brummte er genießerisch, zog seine Jacke aus und hängte sie über die Stuhllehne.
„Belstaff?“ fragte sie.
Er nickte überrascht.
„Gutes Material! Mein Mann besaß eine ähnliche Jacke. Er trug sie immer, wenn er Motorrad fuhr.“
Eberhard bemerkte einen Anflug von Trauer in ihrer Stimme und verkniff sich eine Frage.
Nachdem sie eine Weile geschwiegen hatten, schöpfte sie hörbar Atem und nahm den Faden wieder auf.
„Ich will es kurz machen und Ihnen die Einzelheiten der Vorgeschichte ersparen, nur so viel: meine Familie floh 1945 vor der Roten Armee nach England. Später wurde das Gut von der DDR enteignet und in eine LPG umgewandelt. Nach der Wende haben wir in einem langjährigen, komplizierten Verfahren die Rückgabe erreicht und 2005 mit der Bewirtschaftung begonnen. Inzwischen ist der Betrieb biozertifiziert. Zurzeit bauen wir hauptsächlich Kartoffeln und etwas Gemüse an. Einen Teil des Landes hatten wir an einen benachbarten Bauern verpachtet, der ausschließlich Mais für eine Biogasanlage produziert.“
Eberhard nickte, er hatte die Monokulturen auf der Herfahrt wahrgenommen und wusste, was das für einen Biobetrieb bedeutete, der davon umzingelt war.
„Und nun befürchten sie Eintragungen von Herbiziden und Pestiziden auf Ihre Anbauflächen“, stellte er fest und nahm noch einen Schluck Tee.
Sie sah ihm in die Augen und lächelte, sichtlich erfreut, dass er so schnell verstand.
„Ein benachbarter Imker musste kürzlich seinen gesamten Honig vernichten, weil er mit Rückständen belastet war. 50000 Euro Schaden. Ähnliches blüht uns auch, wenn wir nicht gegensteuern.“
„Ja, die sogenannten Pflanzen-Schutzmittel“, Eberhard zeichnete Anführungszeichen in die Luft, „sind überall“.
„Sie wurden sogar im grönländischen Eis nachgewiesen. Winde verteilen diese toxischen Partikel über den ganzen Planeten. Das Schlimmste ist, dass die Konzerne ihre Pflanzen gegen das Zeug resistent gemacht haben, aber nicht den Menschen. Es ist eine Pest!“
Aufgebracht schlug sie mit der flachen Hand auf den Tisch und brachte die Tassen zum Klirren.
Eberhard nickte verständnisvoll.
„In Sachen Pflanzenschutzeintrag aus der Umgebung kann ÖkoLa Ihnen leider nicht helfen. Das ist ein politisches Problem. Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass wenigstens die giftigsten Pestizide verboten werden und die Hersteller für die Schäden aufkommen müssen.“
Er nahm noch ein Shortbread und sah sie fragend an.
„Was können wir also für Sie tun?“
„Der Pachtvertrag mit dem Maisproduzenten endet dieses Jahr. Ich werde ihn ganz sicher nicht verlängern. Aber was soll ich mit den Flächen anfangen? Was wächst überhaupt noch auf dem ausgelaugten, verseuchten Boden? Wie kann die Erde vitalisiert und Humus gebildet werden?“
„Verstehe“, meinte Eberhard nachdenklich. „Sie wollen sich der Maismafia entgegenstemmen.“
„Genau das habe ich vor. Das muss man sich mal vorstellen, auf 2, 5 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in Deutschland wird ausschließlich Mais angebaut“, sie schüttelte den Kopf, „und nicht etwa als Nahrung für Mensch oder Tier, sondern für Biogasanlagen.“
„Was daran Bio sein soll, verstehe ich auch nicht“, stimmte er zu.
Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und meinte:
„Wir müssen unser Gespräch leider schon beenden. Ich muss wieder auf' s Feld. Meine Leute erwarten mich.“
„Wenn Sie möchten, erarbeitet ÖkoLa ein Nutzungskonzept für ihre neuen Flächen. Bitte schicken sie uns alle verfügbaren Unterlagen über Größe, Bodenbeschaffenheit, Lage, Witterung, Personal et cetera. Wir unterbreiten Ihnen dann einige Vorschläge.“
„In Ordnung“, sagte Bettina von Breskow und fuhr sich durch das kurze Haar, wobei Eberhard weiße Flecken auf ihrem gebräunten Handrücken bemerkte.
„Verbrennungen?“ fragte er besorgt und hoffte, dass er nicht allzu indiskret war.
„Nein, Vitiligo, eine harmlose Pigmentstörung. Tut nicht weh und ist nicht ansteckend. Ich habe das am ganzen Körper.“
„Blaue Augen und weiße Wolken auf brauner Haut. Wie die Landschaft hier“, sagte Eberhard und wurde rot.
Sie lächelte. Dann begleitete sie ihn schweigend zur Tür und reichte ihm zum Abschied ihre feingliedrige, aber kräftige Hand. Er umschloss sie, führte sie zu seinen Lippen und deutete einen Kuss über der weißen Wolke an. Dann starrte er Bettina von Breskow ungläubig an. Hatte er das eben wirklich getan? Sie schien jedoch kein bisschen erstaunt zu sein.
„Ein Abschied für immer?“ fragte sie und zog ihre Hand zurück.
„Wir bleiben in Kontakt“, antwortete Eberhard und wandte sich zum Gehen.
Dann fiel ihm noch etwas ein.
„Haben sie eine Ahnung wie man Maulwürfe vertreibt?“
Sie zuckte die Achseln und lachte.
„Wenn Sie es nicht wissen…“