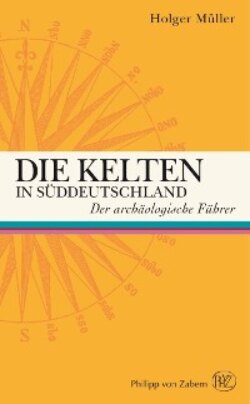Читать книгу Die Kelten in Süddeutschland - Holger Müller - Страница 10
Fürstengrab-/Fürstensitzdebatte
ОглавлениеEine weitere für die keltischen Bodendenkmäler in Süddeutschland relevante Debatte ist die so genannte Fürstengrabdebatte (die sich auch auf die Fürstensitze übertragen lässt). Im Grunde rankt sich diese Debatte um die Bezeichnung eines mit reichen Beigaben in einem monumentalen Grab Bestatteten als „Fürsten“, da diese Bezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch auf eine machtpolitisch hervorgehobene Person schließen lässt. Als 1877 die Goldfunde im Grabhügel im Wald Gießübel-Talhaus nahe der Heuneburg alles bis dahin gefundene in den Schatten stellten, sprachen die Ausgräber von einem „Fürstengrab“. Der Begriff war geprägt, wurde gerne und viel benutzt und zugleich setzte die Diskussion über Macht und soziopolitische Stellung des/der Bestatteten ein. Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wird um den Begriff Fürstengrab eine heftige Diskussion geführt, da man allein aus dem Wert der Beigaben eines Grabes keine hundertprozentigen Rückschlüsse auf die Position des Bestatteten ziehen kann, sondern allenfalls die Art der Beigaben solche Rückschlüsse erlauben könnten (ausschlaggebend für die Diskussion war u.a. der von Wolfgang Kimmig 1969 vorgelegte Kriterienkatalog für keltische Fürstensitze). Weiterhin wurde im Rahmen der Diskussion gezeigt, dass der auf den ersten Blick große Aufwand, der für eine der heute auffälligen Bestattungen betrieben wurde, weit weniger umfangreich war, als lange vermutet. Wurde ursprünglich angenommen, dass der Bau eines Fürstengrabes über ein Jahrzehnt in Anspruch genommen hat und nur von einer mehrere Gemeinschaften umfassenden Gruppe (nämlich der, welcher der Bestattete dann vorgestanden hätte) zu bewerkstelligen sei, wurde in dieser Diskussion gezeigt, dass auch durch die Arbeitskraft einer einzigen, relativ kleinen Dorfgemeinschaft innerhalb weniger Jahre ein imposantes Grab hätte errichtet werden können. Hierdurch würde der überregional einflussreiche Fürst aber zu einem Dorfoberhaupt degradiert werden. Als weiteres Indiz für ein Fürstengrab wird häufig die räumliche Nähe zu einem Fürstensitz gesehen (auch für die Bezeichnung „Fürstensitz“ sind die Ausgräber der Heuneburg verantwortlich, wurde doch bereits 1877 ein solcher in der Nähe des Fürstengrabes vermutet – eine Vermutung, welche die Ausgrabung von 1950 zu bestätigen schien). Da andererseits ein Fürstensitz oft durch die Nähe zu einem so genannten Fürstengrab definiert wird, ist man auch hier in einer Argumentationsschleife gefangen.
Obwohl bereits 1974 Georg Kossak die Bezeichnung „Prunkgräber“ als Alternative genannt hat, hat sich diese Formulierung bislang nicht durchsetzen können. Inwieweit das mit eventuell verletzten Egos einiger Ausgräber zu tun hat (es klingt ja bekanntlich besser, wenn man sagen kann, dass man einen Fürsten ausgegraben hat), sei an dieser Stelle dahingestellt. Sicherlich gibt es aber auch touristische Gründe, da ein Fürstengrab einer Gemeinde mehr Besucher bringt, als nur ein Grab. Ist eine Bestattung im Vergleich zu anderen derselben Region und Epoche durch Aufwand und Ausstattung aufwändiger, so muss dies natürlich irgendwelche Gründe haben. Vielleicht war der Bestattete bedeutend (religiös, politisch, etc.), vielleicht beliebt oder einfach nur reich, aber auf ein genaues politisches Amt, gar eine Anführerschaft, kann anhand eines Grabes nur in Ausnahmen (z.B. in Hochdorf) geschlossen werden. Georg Kossak hält dies treffend fest, indem er in der Bestattung nur die „Reaktion der Nachwelt auf den Tod außergewöhnlicher Zeitgenossen“ (Kossak 1974; 13) sieht. Trotz allem wird in diesem Führer auch von „Fürsten“ gesprochen, da sich diese Bezeichnung bei den meisten Gräbern durchgesetzt hat.