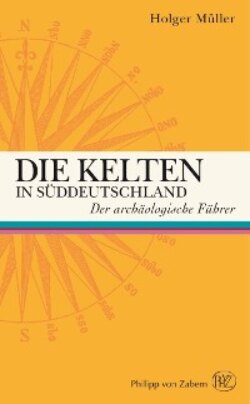Читать книгу Die Kelten in Süddeutschland - Holger Müller - Страница 9
Keltizitäts-Debatte
ОглавлениеUm die Kelten rankt sich trotz einer langen Forschungsgeschichte immer noch eine Vielzahl von Fragen. Wer sind sie? Wo kamen sie her? Eine lange Zeit in der Forschung vertretene Meinung besagte, dass das keltische Ursprungsgebiet in Böhmen sei und sich keltische Stämme von dort aus zuerst in Richtung Westen ausbreiteten, um anschließend in großen Süd- und Südostwanderungen in das Blickfeld der mediterranen Kulturen zu geraten. Doch zumindest die Vorstellung einer Wanderung aus einem gemeinsamen Ursprungsgebiet nach Westen muss heute als überholt angesehen werden. Vielmehr werden eher kulturelle Errungenschaften verbreitet worden sein, als große Personengruppen gewandert. Die Süd- und Südostwanderung keltischer Stämme ist hingegen anhand historischer Quellen gut belegt, auch wenn exakte Wanderwege und selbst die genaue Chronologie der Wanderung heftig diskutiert werden. Dies liegt unter anderem daran, dass eindeutige archäologische Belege für keltische Wanderbewegungen eher selten zu finden sind (zwar ist es möglich, mittels Strontiumisotopenanalyse an Zähnen Wanderungsbewegungen von Individuen nachzuweisen, aber ist diese Methode, vor allem aufgrund des Fehlens von Fundmaterial in statistisch relevanter Größenordnung ungeeignet, um Völkerwanderungen zu belegen).
Für den süddeutschen Raum sind zwei Exzerpte von Interesse. Den frühesten Beleg für Kelten in Süddeutschland scheint der griechische Historiker Herodot (ca. 484–424 v. Chr.) zu liefern. Er berichtet: „Denn der Fluss Istros [Anm. Autor: gemeint ist die Donau] beginnt bei den Kelten und der Stadt Pyrene und fließt mitten durch Europa.“ (Hdt. 2,33)
Gern wird in dieser Textstelle ein Indiz für die Existenz von Kelten im süddeutschen Raum gesehen. Bereits Henri d’Arbois de Jubainville nahm dieses Zitat 1877 als Beweis, dass die Heimat der Kelten in Süddeutschland zu suchen sei. Allerdings muss beachtet werden, dass Herodot weiter berichtet, die Kelten wohnten jenseits der Säulen des Herakles (Gibraltar) und allein hieran erkennt man die geographischen (Un-)Kenntnisse Herodots. Er unterteilte, wie viele seiner Zeitgenossen, aufgrund mangelnden Wissens den Norden der Welt in ein Gebiet der Kelten (Westen) und eins der Skythen (Osten). Dies spiegelt sich auch in den rekonstruierten Weltkarten des Eratosthenes (ca. 254–202 v. Chr.) und des Hekataios (ca. 550–490 v. Chr.) wieder (hierzu später mehr im Kapitel Heuneburg). Doch haben wir mit dieser Erwähnung der bei Herodot (und auch bei Hekataios von Milet, der noch vor Herodot schrieb) die erste namentliche Erwähnung einer mitteleuropäischen Bevölkerungsgruppe.
Eine Art Ursprungslegende wiederum wird durch den römischen Annalisten Livius (ca. 59 v. Chr. – 17 n. Chr.) überliefert. Dieser berichtet vom gesamtgallischen König Ambigatus, der seine Söhne Bellovesus und Segovesus mit freiwilligen Siedlern auswandern lässt, um sein Reich von Überbevölkerung zu befreien (Liv. 5, 34). Bellovesus zieht nach Italien, Segovesus in die Hercynii saltus. Iulius Caesar (100–44 v. Chr.) folgend (der von Hercynia silva spricht), sind hiermit die Mittelgebirge vom Rhein bis in die Karpaten gemeint (Caes. Gall. 6, 24), d.h. auch der süddeutsche Raum. Nun schreiben aber Caesar und Livius in Lt D (um die prähistorische Zeiteinteilung zu benutzen) und der in Lt A schreibende Herodot liefert nur allzu vage Informationen. Hier setzt ein Teilproblem der Keltizitäts-Debatte ein, deren Grundlage im Prinzip die Frage ist, wie und woran man Kelten definieren kann. Wissenschaftshistorisch wurden ursprünglich die sogenannten keltischen Sprachen definiert, und das aufgrund der Tatsache, dass George Buchanan (1509–1582) die Schotten als Kelten bezeichnete. Auf eben dieser Basis wurden schließlich die keltischen Sprachen bestimmt, die allerdings nur auf den Britischen Inseln und Irland vertreten sind (abgesehen von wenigen Sprachtrümmern auf dem Festland wie das Lepontische). In die Bretagne (Bretonisch ist ebenfalls eine keltische Sprache) kamen keltische Sprachen durch walisische und kornische Einwanderer im 5. Jahrhundert n. Chr. Es leuchtet aber leicht ein, dass man anhand einer frühneuzeitlichen linguistischen Definition eine Bevölkerung eines weit entfernten Gebietes, deren Sprache man nicht kennt, nur schwer definieren kann. Archäologische Methoden können hier nur bedingt helfen, da man mit ihnen in erster Linie Kulturkreise (z.B. die Hallstatt- oder La-Tène-Kultur) definieren kann. Hier gibt es aber mehr regionale Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Archäologisch muss der Keltenbegriff also als Teil eines umfassenden Kulturbegriffs gesehen werden, der damit seit Gustav Kossina (1858–1931) eine auf die materielle Kultur reduzierte Ausprägung hat. Es wird versucht, über die antiken Quellen eine Verbindung der Definitionen zu schaffen bzw. die eine oder andere Definition zu untermauern. Doch dies ist auch nur bedingt möglich, stammen die zu Rate gezogenen Quellen doch meist nicht aus derselben Zeit wie die archäologischen Funde. Genaugenommen wurde also eine sprachwissenschaftliche Einteilung mittels einer ethnischen Bezeichnung definiert, eine Definition, die sich lange Zeit durchgesetzt hat und hierdurch gravierende Folgen, vor allem für die archäologische Forschung, nach sich zog. Das (zumindest vorläufige) Ergebnis der Debatte ist, dass es mit Sicherheit keine, das gesamte Mittel- und Westeuropa umfassende, keltische Kultur gegeben hat (wie es bis heute Verbreitungskarten in einigen Büchern und Museen suggerieren, die sich auf ein nicht haltbares archäologisch-linguistisches Keltenkonzept stützen), sondern vielmehr eine Vielzahl von Gesellschaften, die die eine oder andere Ähnlichkeit aufwiesen. Ein keltisches Reich, wie es ältere Literatur gerne suggeriert, hat es nie gegeben und die kulturellen Überlieferungen erlauben es ebenfalls nicht, von einem einheitlichen keltischen Europa in Hallstatt- und Latènezeit zu sprechen. Demnach ist die Bezeichnung Kelten eine Sammelbezeichnung, die „selbst keine Erklärungskraft besitzt und nur zu unserer vereinfachten Verständigung dient“ (Karl 2005; 106). Sie ist ungemein problematisch, aber ebenso nützlich und soll aus diesem Grund auch hier weiter verwendet werden.