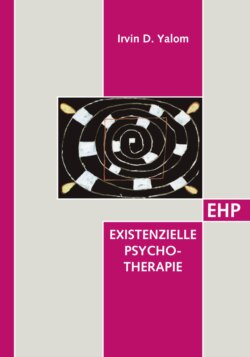Читать книгу Existenzielle Psychotherapie - Irvin D. Yalom - Страница 38
Freuds Meiden des Todes
ОглавлениеFreuds erster bedeutsamer klinischer und theoretischer Beitrag erschien in den Studien über Hysterie, die er mit Josef Breuer 1895 schrieb.82 Es ist eine faszinierende Arbeit und verdient Aufmerksamkeit, denn sie illustriert auf überzeugende Weise eine selektive Unaufmerksamkeit für den Tod, und sie legt die Grundlage für den Ausschluss des Todes aus dem gesamten Bereich dynamischer Therapie, die aus ihr hervorging. Das Buch führt fünf Hauptfälle auf, einen (Anna O.) von Breuer und vier von Freud. Mehrere andere Fälle tauchen in den Fußnoten und Diskussionsabschnitten in fragmentarischer Form immer wieder einmal auf. Jeder der Patienten beginnt die Therapie mit starken Symptomen, die Lähmung, Anästhesie, Schmerz, Ticks, Müdigkeit, Zwangshandlungen, Erstickungsgefühle, Geschmacks- und Geruchsverlust, linguistische Desorganisationen, Amnesie und so weiter einschließen. Auf Grund der Untersuchung dieser fünf Patienten stellten Freud und Breuer eine Ätiologie der Hysterie und die systematische Form einer Therapie auf, die auf dieser Ätiologie gründet.
Die fünf Patienten litten alle an einem wichtigen emotionalen Trauma, das sich früh in ihrem Leben ereignete. Freud bemerkt, dass ein Trauma, obwohl es störend ist, keine anhaltenden Wirkungen hervorbringt, weil die Emotionen, die dadurch ausgelöst wurden, zerstreut werden: entweder sie werden abreagiert (die Person geht durch eine Katharsis, indem sie die Emotion auf eine effektive Weise zum Ausdruck bringt) oder auf andere Weise durchgearbeitet (Freud stellt fest, dass die Erinnerung an Traumata in »den großen Komplex der Assoziationen eintritt. Sie (Erinnerung) rangiert dann neben anderen, vielleicht ihr widersprechenden Erlebnissen«und wird dann »korrigiert«, richtig gestellt oder einem Realitätstest unterzogen, zum Beispiel indem man mit einer Beleidigung umgehen kann, wenn man an seine Errungenschaften und Stärken denkt.)83
Bei diesen fünf Patienten verteilte sich das Trauma nicht, sondern verfolgte das Opfer stattdessen kontinuierlich. (»Der Hysterische leidet größtenteils an Reminiszenzen.«84) Freud wies darauf hin, dass die Erinnerung an das Trauma und die dazugehörenden Emotionen aus den bewussten Gedanken verdrängt wurden (der erste Gebrauch des Begriffs der Verdrängung und des Unbewussten) und daher nicht für den normalen Prozess der Affektverteilung verfügbar waren. Der eingeklemmte Affekt blieb jedoch mit frischer Stärke im Unbewussten bestehen und fand einen bewussten Ausdruck durch Konversion in körperliche Symptome (daher »Konversionshysterie«).
Die Implikationen für die Behandlung sind klar: Man muss den Patienten befähigen, das Trauma zu erinnern und dem eingeklemmten Affekt Ausdruck zu verleihen. Freud und Breuer verwandten Hypnose, und später benutzte Freud die freie Assoziation, um den Patienten zu helfen, die Erinnerung an die ursprüngliche Kränkung wiederzugewinnen und den Affekt verbal und verhaltensmäßig auszudrücken.
Freuds Spekulationen über den Aufbau und die Verteilung von Affekten über die Bildung von Symptomen und über ein System der Therapie, das auf diesen Annahmen beruht, sind von entscheidender Bedeutung und kündigen viel von der dynamischen Theorie und Therapie, die ihm folgte, an. Am relevantesten für meine Diskussion ist Freuds Ansicht über die Quelle des dysphorischen Affekts – das Wesen des ursprünglichen Traumas. Die Theorie der Symptome und der therapeutische Ansatz bleiben im gesamten Text konsistent. Aber Freuds Beschreibung des Wesens des Traumas, das für die Symptome verantwortlich ist, erlebt eine faszinierende Evolution vom ersten bis zum letzten Patienten. (In seiner Einführung stellt er fest, »Ich kann niemandem, der an der Entwicklung der Katharsis in der Psychoanalyse interessiert ist, einen besseren Rat geben, als mit den Studien über Hysterie zu beginnen und damit dem Weg zu folgen, den ich selbst bereitet habe.«)85
In den ersten Fällen des Buches scheinen die Traumata trivial zu sein: Es strapaziert die Glaubwürdigkeit, dass der tief greifend neurotische Zustand einer Person daher rühren könnte, dass er von einem bösartigen Hund gejagt wurde86 oder dass er von einem Arbeitgeber mit einem Stock geschlagen wurde; oder dass man entdeckt, dass das Dienstmädchen dem Hund erlaubt hat, Wasser aus seinem Glas zu trinken,87 oder dass man in seinen Arbeitgeber verliebt ist und dessen ungerechte Vorwürfe erleiden muss.88 Im Weiteren werden die Erklärungen von Falltraumata im Buch Freuds immer verwirrender in ihrer Ausgeklügeltheit: Er glaubte schließlich, dass seine Patienten von archetypischen Sorgen verfolgt wurden, die es wert gewesen wären, von einem griechischen Tragödienschreiber festgehalten zu werden – Hass auf Kinder (da sie die Fähigkeit einer Frau zur Versorgung ihres sterbenden Ehemanns anzweifelten)89, inzestuöse Handlungen mit einem Elternteil,90 das Miterleben einer Zeugungsszene91 und die Freude (gefolgt von Schuldgefühlen) bei dem Tod einer Schwester, deren Ehemann die Patientin liebte.92 Diese letzteren Fälle, die Fußnoten und Freuds Briefe93 legen alle Zeugnis ab von der unbeirrbaren Richtung in Freuds Denken über die Quelle der Angst: (1) Er verschob die Zeit des »wirklichen« Traumas, das für die Angst verantwortlich war, allmählich in eine frühere Periode im Leben; und (2) kam er zu der Ansicht, dass das Wesen des Traumas ausdrücklich und ausschließlich sexuell sei.
Freuds Nachsinnen über die emotionalen Traumata seiner fünf Patienten entwickelte sich allmählich zu einer formalen Theorie der Angst. Angst war ein Signal für antizipierte Gefahr; die Angst wurde früh im Leben gesät, wenn ein bedeutsames Trauma eintrat: Die Erinnerung des traumatischen Ereignisses wurde verdrängt und der dazugehörige Affekt in Angst verwandelt. Die Erwartung der Wiederkehr des Traumas oder einer analogen Gefahr konnte die Angst erneut hervorrufen.
Welche Art von Trauma? Welche Ereignisse sind so grundlegend bösartig, dass ihre Echos einen Menschen sein ganzes Leben lang hindurch verfolgen? Freuds erste Antwort hob die Bedeutung des Affekts der Hilflosigkeit hervor. »Angst ist die ursprüngliche Reaktion auf Hilflosigkeit im Trauma, die dann später in der Gefahrsituation als Hilfssignal reproduziert wird.«94 Dann besteht die Aufgabe darin zu bestimmen, welche Situationen Hilflosigkeit hervorrufen. Da das Thema der Angst das Herzstück psychoanalytischer Theorie ist, und da Freud während seiner gesamten Laufbahn die grundlegende Theorie beliebig änderte, ist es nicht überraschend, dass es viele Aussagen über Angst gibt, dass sie vielfältig sind und teilweise widersprüchlich.95 Zwei primäre Ursprünge der Angst überleben die rastlosen Veränderungen durch Freud: der Verlust der Mutter (Verlassenheit und Trennung) und der Verlust des Phallus (Kastrationsangst). Andere Quellen schließen das Über-Ich oder die moralische Angst ein, die Furcht vor den eigenen selbstzerstörerischen Tendenzen und die Furcht vor Ich-Verlust – die Furcht, von den dunklen irrationalen Mächten der Nacht, die in uns wohnen, überwältigt zu werden.
Obwohl Freud oft andere Quellen der Angst erwähnte, legte er seine Hauptbetonung auf Verlassenheit und Kastration. Er glaubte, dass diese beiden psychischen ›Katzenjammer-Kids‹ uns in immer neuer Verkleidung unser ganzes waches Leben lang verfolgen, und in unserem Schlaf die Nahrung für unsere zwei üblichen Albträume liefern: des Fallens und des Gejagt-Werdens. Freud, der immer ein Archäologe war und immer nach noch grundlegenderen Strukturen suchte, weist darauf hin, dass Kastration und Trennung eine gemeinsame Eigenschaft haben: Verlust – Verlust der Liebe, Verlust der Fähigkeit, sich mit der Mutter zu vereinigen. Chronologisch gesehen kommt die Trennung zuerst, da sie schon in der Tatsache des Geburtstraumas – des ersten Moments im Leben – angelegt ist; aber Freud entschied sich dafür, die Kastration als die gattungsmäßig primäre Quelle der Angst zu betrachten. Die frühe Trennung, so behauptete er, programmiert die Person für die Kastrationsangst, die die früheren Angsterfahrungen einschließt, sobald sie sich entwickelt.
Wenn man die Datengrundlage (das Fallmaterial der Patienten in den Studien über Hysterie), aus dem Freuds Schlussfolgerungen über Angst und Trauma hervorgehen, betrachtet, ist man von der erstaunlichen Diskrepanz zwischen den Fallgeschichten und Freuds Schlussfolgerungen und Formulierungen beeindruckt: Der Tod durchdringt die klinischen Geschichten dieser Patienten so sehr, dass Freud ihn nur mit einer übermäßigen Anstrengung der Unachtsamkeit in seinen Ausführungen über die Traumata des Fallens herauslassen konnte. Von den fünf Patienten werden zwei nur kurz diskutiert. (Eine Patientin, Katarina, Freuds Kellnerin in einem Ferienort, wurde in einer einzigen Sitzung behandelt.) Die drei Hauptpatientinnen – Anna O., Frau Emmy von N. und Fräulein Elisabeth von R. (die ersten dynamischen Fallberichte in der psychiatrischen Literatur) – sind insofern bemerkenswert, als ihre klinischen Beschreibung vor Anspielungen auf den Tod nur so überströmen. Wahrscheinlich hätte Freud darüber hinaus sogar noch mehr Material über das Todesthema hervorgelockt und berichtet, wenn er an der Todesangst besonders interessiert gewesen wäre.
Anna O.s Krankheit beispielsweise entwickelte sich zuerst, als ihr Vater krank wurde (und er erlag dieser Krankheit zehn Monate später). Sie pflegte ihn zunächst unermüdlich; aber schließlich führte ihre Krankheit, die aus bizarr veränderten Bewusstseinszuständen, Amnesie, linguistischer Desorganisation, Anorexie und Konversionssymptomen der Sinne und Muskeln bestand, dazu, dass sie von ihrem sterbenden Vater ferngehalten wurde. Während des folgenden Jahres verschlimmerte sich ihr Zustand sehr. Breuer bemerkte Anna O.s ständige Besorgnis über den Tod. Beispielsweise kommentierte er, dass, obwohl sie bizarre und rasch wechselnde Störungen des Bewusstseins hatte, »das Bewusstsein davon, dass der Vater gestorben sei, (…) meist doch zu bestehen [schien].«96
Während Breuers Hypnosearbeit mit Anna O. hatte sie erschreckende Halluzinationen, die in Verbindung mit dem Tod ihres Vaters standen. Während sie ihn gepflegt hatte, war sie einmal ohnmächtig geworden, als sie sich einbildete, dass sie ihn mit einem Totenkopf sah. (Während der Behandlung schaute sie einmal in den Spiegel und sah nicht sich selbst, sondern ihren Vater mit einem Totenkopf, der sie anstarrte.) Bei anderer Gelegenheit halluzinierte sie eine schwarze Schlange, die ihren Vater gerade angriff. Sie versuchte, gegen die Schlange zu kämpfen, aber ihr Arm war eingeschlafen, und sie halluzinierte, dass ihre Finger sich in Schlangen verwandelten und jeder Fingernagel zu einem winzigen Totenkopf wurde. Breuer hielt diese Halluzinationen, die von ihrem Todesschrecken ausgingen, für die grundlegende Ursache ihrer Krankheit: »Am letzten Tage [der Behandlung] reproduzierte sie mit der Nachhilfe, dass sie das Zimmer so arrangierte, wie das Krankenzimmer ihres Vaters gewesen war, die oben erzählte Angsthalluzination, welche die Wurzel der ganzen Erkrankung gewesen war.«97
Frau Emmy von N. entwickelte ihre Krankheit, wie Anna O., unmittelbar nach dem Tod des Menschen, dem sie am nächsten stand – ihres Ehemannes. Freud hypnotisierte Frau Emmy von N. und fragte nach wichtigen Assoziationen. Sie rasselte eine Litanei von Erinnerungen herunter, die in Beziehung zum Tod standen: Sie sah ihre Schwester in einem Sarg (im Alter von sieben), sie wurde durch ihren Bruder, der sich als Geist verkleidet hatte, und durch ihre Geschwister, die tote Tiere auf sie warfen, erschreckt, sie sah ihre Tante im Sarg (im Alter von neun), sie fand ihre Mutter bewusstlos von einem Schlaganfall (im Alter von fünfzehn), und dann (im Alter von neunzehn) fand sie sie tot auf, sie pflegte einen Bruder, der an Tuberkulose starb, sie betrauerte (im Alter von neunzehn) den Tod ihres Bruders, sie war Zeugin des plötzlichen Todes ihres Ehemannes. Auf den ersten acht Seiten des klinischen Fallberichts gibt es nicht weniger als elf explizite Bezugnahmen auf den Tod, auf Sterben oder auf Leichen. In der gesamten klinischen Beschreibung spricht Frau Emmy von N. ausführlich über ihre tief greifende Todesangst.
Die Krankheit der dritten Patientin, Fräulein Elisabeth von R., begann während der achtzehn Monate, in denen sie ihren sterbenden Vater versorgt und den unerbittlichen Verfall ihrer Familie beobachtet hatte: Eine Schwester zog weit weg, ihre Mutter litt an einer schweren Krankheit, ihr Vater starb. Schließlich brach Fräulein Elisabeths Krankheit in voller Stärke nach dem Tod einer sehr geliebten älteren Schwester aus. Im Verlauf der Therapie gab ihr Freud (in ganz ähnlicher Weise, wie Breuer sein Beratungszimmer umgeräumt hatte, damit es dem Zimmer ähnelte, in dem Anna O.s Vater gestorben war) die Aufgabe, das Grab ihrer Schwester zu besuchen, um das Auftauchen alter Erinnerungen und Affekte zu beschleunigen.
Freud glaubte, dass Angst durch eine Situation hervorgerufen wird, die eine frühere, lange vergessene Situation des Schreckens und der Hilflosigkeit wachruft. Sicherlich lösten die mit dem Tod in Zusammenhang stehenden Traumata dieser Patientinnen tiefe Gefühle des Schreckens und der Hilflosigkeit in ihnen aus. Aber in der Lösung jedes Falles vernachlässigt Freud das Todesthema entweder gänzlich oder lenkt die Aufmerksamkeit auf den generellen Stress, der durch die Verluste, die jede Patientin erlitten hatte, verursacht wurde. Seine Formulierungen konzentrieren sich auf die erotischen Komponenten der Traumata jeder Patientin.
Robert Jay Lifton macht in The Broken Connection (New York, 1979) fast genau die gleiche Beobachtung über einen anderen von Freuds wichtigen Fällen, Klein Hans, und er schlussfolgert, dass die Libidotheorie den Tod aufhebt. Da Liftons Buch unglück licherweise erschien, nachdem mein Buch fertig war, war ich nicht in der Lage, seine reichen Einsichten in einer sinnvollen Weise aufzugreifen. Es ist ein gedankenreiches, wichtiges Werk, das sorgfältiges Lesen erfordert.
Freud verhalf Fräulein Elisabeth, als ihre Schwester starb, zu der Erkenntnis dass sie sich in der Tiefe ihrer Seele freute (und infolgedessen von Schuld überwältigt wurde), weil der Ehemann ihrer Schwester, den sie begehrte, jetzt frei war, um sie zu heiraten. Eine wichtige Entdeckung: Das Unbewusste, ein Überrest primitiver Wünsche, die im Keller unserer Seele vergraben liegen, weil sie für das Sonnenlicht ungeeignet sind, tauchte kurz im Bewusstsein auf und verursachte große Angst, die schließlich durch Konversionssymptomatologie gebunden wurde.
Es besteht kein Zweifel, dass Freud in jedem seiner Patienten wichtige Konflikte aufdeckte. Aber das, was er ausließ, bedarf der genauen Untersuchung. Der Tod eines Elternteils, eines Partners oder eines anderen Nahestehenden ist mehr als ein generalisierter Stress; es ist mehr als der Verlust eines wichtigen Objektes. Es ist ein Klopfen an der Tür der Verleugnung. Wenn, wie Freud spekulierte, Fräulein Elisabeth auch nur für einen flüchtigen Moment, als ihre Schwester starb, dachte: »Jetzt ist ihr Ehemann wieder frei, und ich kann seine Frau sein«, dann erschauerte sie höchstwahrscheinlich auch bei dem Gedanken: »Wenn meine geliebte Schwester stirbt, dann werde ich auch sterben.« Wie Fräulein Elisabeth beim Tod ihrer Schwester, so Anna O. beim Tod ihres Vaters oder Frau Emmy von N. beim Tod ihres Ehemannes: Jede von ihnen muss auf einer tiefen Ebene und nur für einen Augenblick einen Blick auf ihren eigenen Tod geworfen haben.
In den nachfolgenden Formulierungen, die die Quellen der Angst betreffen, übersah Freud den Tod weiterhin auf höchst seltsame Weise. Er fixierte sich auf den Verlust: Kastration und Verlassenheit – der Verlust des Penis und der Verlust der Liebe. Seine Haltung ist an dieser Stelle untypisch. Wo ist der furchtlose archäologische Gräber? Freud bohrte immer nach dem Fels – nach den frühesten Ursprüngen – der Dämmerung des Lebens – der Lebensweise des primitiven Menschen – der vorsintflutlichen Horde – den grundlegenden Trieben und Instinkten. Aber vor dem Tod hielt er plötzlich inne. Warum tat er nicht einen weiteren, nahe liegenden Schritt, hin zu dem gemeinsamen Nenner von Verlassenheit und Kastration? Beide Begriffe stützen sich auf ontologische Felsen. Verlassenheit ist unentwirrbar mit dem Tod verknüpft: Der verlassene Primat geht immer unter; das Schicksal des Aussätzigen ist unvermeidlicherweise der soziale Tod, dem der physische Tod schnell folgt. Kastration ist, wenn sie im bildlichen Sinn verstanden wird, synonym mit Vernichtung; wenn sie wörtlich genommen wird (und Freud meinte sie leider wörtlich), dann führt sie auch zum Tod, da der kastrierte Mensch seinen Samen nicht in die Zukunft werfen kann, er nicht der Auslöschung entfliehen kann.
In Hemmung, Symptom und Angst betrachtete Freud kurz die Rolle des Todes in der Ätiologie der Neurosen, aber schob sie wieder als oberflächlich beiseite (ich werde später auf die auf den Kopf gestellte analytische Sichtweise von dem, was »Tiefe« und »Oberflächlichkeit« ausmacht, eingehen). In einer Passage, die unzählige Male von Theoretikern zitiert wurde, beschreibt Freud, warum er die Todesfurcht aus seinen Überlegungen über die ursprüngliche Quelle der Angst weglässt.
Es ist nach allem, was wir von der Struktur der simpleren Neurosen des täglichen Lebens wissen, sehr unwahrscheinlich, dass eine Neurose nur durch die objektive Tatsache der Gefährdung ohne Beteiligung der tieferen unbewussten Schichten des seelischen Apparats zustande kommen sollte. Im Unbewussten ist aber nichts vorhanden, was unserem Begriff der Lebensvernichtung Inhalt geben kann. Die Kastration wird sozusagen vorstellbar durch die tägliche Erfahrung der Trennung vom Darminhalt und durch den bei der Entwöhnung erlebten Verlust der mütterlichen Brust; etwas dem Tod Ähnliches ist aber nie erlebt worden oder hat wie die Ohnmacht keine nachweisbare Spur hinterlassen. Ich halte darum an der Vermutung fest, dass die Todesangst als Analogon der Kastrationsangst aufzufassen ist, und dass die Situation, auf welche das Ich reagiert, das Verlassensein vom schützenden Über-Ich – den Schicksalsmächten – ist, womit die Sicherung gegen alle Gefahren ein Ende hat.98
Die Logik kommt hier schlimm ins Schleudern. Zuerst besteht Freud darauf, dass die Erfahrung des Todes im Unbewussten nicht repräsentiert sein kann, weil wir keine Erfahrung davon haben. Hatten wir eine Erfahrung mit der Kastration? Keine direkte Erfahrung, gibt Freud zu; aber er stellt fest, dass wir die Erfahrung von anderen Verlusten haben, die erfahrungsmäßig gleichwertig sind: die tägliche Trennung von den Fäkalien oder die Erfahrung des Abstillens. Sicher ist die Fäkalien-Abstillen-Kastrationskette nicht logisch zwingender als der Begriff von einer angeborenen intuitiven Bewusstheit des Todes. Das Argument, wodurch Tod durch Kastration als ursprüngliche Quelle der Angst ersetzt wird, ist in der Tat so unhaltbar, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn ich es angreife, ganz so als würde ich einen offensichtlich verkrüppelten Gegner bekämpfen. Betrachten Sie beispielsweise die offensichtliche Tatsache, dass auch Frauen Angst haben – die Verrenkungen, die notwendig sind, um die Kastrationstheorie auf Frauen anzuwenden, sind wirklich Spitzenleistungen analytischer Metapsychologie.
Melanie Klein war ausgesprochen kritisch gegenüber Freuds seltsamer Inversion des Primats. »Die Todesangst verstärkt die Kastrationsangst und ist nicht ihr analog … da die Reproduktion eine wesentliche Möglichkeit ist, gegen den Tod zu arbeiten, würde der Verlust der Genitalien das Ende der kreativen Kraft bedeuten, die das Leben erhält und weiterführt.« Klein stimmte auch mit Freuds Ansicht nicht überein, dass es keine Todesfurcht im Unbewussten gäbe. Sie akzeptierte später Freuds Forderung, dass es in der tiefsten Schicht des Unbewussten einen Todesinstinkt (Thanatos) gibt und argumentierte, dass »eine Todesfurcht, die auch im Unbewussten sitzt, in Opposition zu diesem Instinkt aktiv ist.«99 Trotz des Widerspruchs von Klein ebenso wie von Rank und Adler u.a., die in eine Guerilla-Opposition gingen, bestand Freud auf seinen Ansichten und begründete einen Kult der Todesverleugnung für viele Generationen von Therapeuten. Die wichtigsten analytischen Handbücher reflektieren und zementieren diesen Trend. Otto Fenichel stellt fest, dass, »weil die Idee des Todes subjektiv unbegreiflich ist, jede Todesfurcht andere unbewusste Ideen verdeckt.«100 Robert Waelder lässt alle Betrachtungen über den Tod aus;101 während Ralph Greenson den Tod kurz aus der Perspektive von Thanatos, Freuds Todesinstinkt, diskutiert und ihn dann als eine Kuriosität verwirft – eine kühne, aber unhaltbare Theorie.102 Nur allmählich und durch jene, die außerhalb der Freudschen Tradition arbeiteten (oder die sich schnell außerhalb dieser wiederfanden), wurde die notwendige Korrektur vorgenommen.
Warum schloss Freud den Tod aus der psychodynamischen Theorie aus? Warum betrachtete er die Todesfurcht nicht als ursprüngliche Quelle der Angst? Offensichtlich ist dieser Ausschluss nicht ein bloßes Übersehen: Die Todesfurcht ist weder ein tiefgründiges noch ein schwer fassbares Konzept; und Freud konnte diese Fragen kaum übersehen (und absichtlich verworfen) haben. Er ist sich ja 1923 klar darüber: »Der volltönende Satz: jede Angst sei eigentlich Todesangst, schließt kaum einen Sinn ein, ist jedenfalls nicht zu rechtfertigen.«103 Seine Argumentation geht in die gleiche Richtung wie zuvor: Dass es wirklich nicht möglich ist, den Tod zu begreifen – ein Teil des Ich bleibt immer ein lebender Zuschauer. Noch einmal gelangt Freud zu der unbefriedigenden Schlussfolgerung, dass »die Todesangst wie die Gewissensangst als Verarbeitung der Kastrationsangst aufgefasst werden [kann].«104
Bemerkenswert ist auch, dass Freuds Unaufmerksamkeit für den Tod auf die Diskussionen der formalen Angsttheorie, der Theorie der Verdrängung und des Unbewussten begrenzt ist: kurz, auf die inneren Mechanismen – die Zahnräder, Lager und Energiezellen – des geistigen Mechanismus.
Im Alter von vierundsechzig Jahren gibt Freud dem Tod in Jenseits des Lustprinzips in seinem Modell des Geistes Raum; aber sogar in dieser Formulierung spricht er nicht von einer ursprünglichen Todesfurcht, sondern stattdessen von einem Willen zum Sterben – Thanatos wurde als einer der zwei ursprünglichen Triebe konzipiert.105
Wann immer er es sich gestattete, die Zügel locker zu lassen, spekulierte er kühn und kraftvoll über den Tod. Zum Beispiel diskutierte er in einem kurzen eindringlichen Essay, den er am Ende des Ersten Weltkriegs unter dem Titel »Zeitgemäßes über Krieg und Tod« schrieb, die Verleugnung des Todes und den Versuch des Menschen, den Tod durch die Schöpfung von Unsterblichkeitsmythen zu vernichten. Zuvor habe ich einige seiner Kommentare darüber angeführt, wie die Vergänglichkeit des Lebens dessen Würze und Reichtum erhöht. Er berücksichtigte dabei die Rolle, die der Tod in der Gestaltung des Lebens spielt:
Wäre es nicht besser, dem Tode den Platz in der Wirklichkeit und in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm gebührt, und unsere unbewusste Einstellung zum Tode, die wir bisher so sorgfältig unterdrückt haben, ein wenig mehr hervorzukehren? Es scheint das keine Höherleistung zu sein, eher ein Rückschritt in manchen Stücken, eine Regression, aber es hat den Vorteil, der Wahrhaftigkeit mehr Rechnung zu tragen und uns das Leben wieder erträglicher zu machen. Das Leben zu ertragen, bleibt ja doch die erste Pflicht aller Lebenden. Die Illusion wird wertlos, wenn sie uns darin stört. Wir erinnern uns des alten Spruches: Si vis pacem, para bellum. Wenn du den Frieden erhalten willst, so rüste zum Kriege. Es wäre zeitgemäß, ihn abzuändern: Si vis vitam, para mortem. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein.106
»Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein.« Freud glaubte, dass die Aufgabe eines Therapeuten darin besteht, einem Patienten das Leben ertragen zu helfen. Freuds gesamte therapeutische Karriere war diesem Ziel gewidmet. Aber abgesehen von dieser Maxime blieb er für immer stumm gegenüber der Vorbereitung auf den Tod, gegenüber der Rolle und dem Begriff des Todes in der Psychotherapie. Warum?
Wenn man aufzeigt, was Freud übersehen hat, indem man seine blinden Flecken kommentiert, kann man nur so weit gehen, bis man unbehaglich über die eigene Schulter schaut. Vielleicht war seine Vision größer als unsere, sie war es in vielerlei anderer Hinsicht. Vielleicht ist die Frage so schlicht, dass er niemals die Notwendigkeit spürte, die volle Argumentationsbreite für seine Ansicht zu liefern. Wir sind, glaube ich, gut beraten, die Gründe hinter Freuds Ansicht genau zu überdenken. Ich glaube, er ließ den Tod aus seiner dynamischen Theorie aus ungesunden Gründen weg, die aus zwei Quellen stammen: Die eine ist ein überholtes theoretisches Modell des Verhaltens; und die andere ein unnachsichtiges Streben nach persönlichem Ruhm.