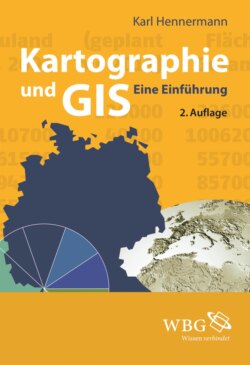Читать книгу Kartographie und GIS - Karl Hennermann - Страница 9
2 Karten als Abbildung von Realität 2.1 Eigenschaften von Karten
ОглавлениеBeispiele
Was ist das besondere an Karten, was unterscheidet sie von anderen graphischen Darstellungen? Um diese Frage zu beantworten, betrachten Sie folgende Abbildungen. Alle haben im weitesten Sinne Ähnlichkeit mit Karten.
Abbildung 2-1: Globus
Zu Abbildung 2-1: Von einer Karte erwarten wir, dass sie die Erde in einer zweidimensionalen Ebene („verebnet“) darstellt. Ein Globus stellt die Erde dreidimensional dar und ist daher keine Karte.
Bei Abbildung 2-2 handelt es sich um ein Luftbild1. Dieses bildet die Realität in allen Details ab. In einer Karte hingegen ist die reale Situation immer generalisiert (vereinfacht) dargestellt. Eine Sonderform sind Luftbildkarten (Luftbilder, die mit kartenähnlichen Inhalten, z.B. Höhenlinien, versehen sind).
Abbildung 2-3 zeigt ein Stadtstrukturmodell. Dabei handelt es sich um die Darstellung einer idealtypischen Stadt, die in der Realität nicht vorkommt. Eine Karte hingegen stellt immer einen Ausschnitt der realen Erdoberfläche dar.
Abbildung 2-2: Luftbild
Abbildung 2-3: Modell der lateinamerikanischen Großstadt
Die Darstellung in Abbildung 2-4 beschreibt die räumliche Lage eines bestimmten, besonders hervorgehobenen Objekts. Eine derartige Darstellung bezeichnet man als Topogramm. Während wir bei Karten eine detaillierte Erläuterung (Legende) erwarten, ist eine solche bei Topogrammen häufig nicht vorhanden. Trotzdem lassen sich Topogramme im weitesten Sinne zu den Karten zählen.
Abbildung 2-4: Lage des Instituts für Wirtschaftsgeographie in München
Abbildung 2-5: Profil
Bei Abbildung 2-5 handelt es sich um ein Geländeprofil, also um die Abbildung eines senkrecht zur Erdoberfläche ausgeführten Schnittes2. Eine Karte hingegen stellt eine Situation immer im Grundriss dar, daher zählen Profile nicht zu den Karten.
Mit den hier gesammelten Charakteristika können wir den Begriff „Karte“ definieren.
Definition: Karte
Eine Karte ist eine maßstäbig verkleinerte, verebnete, im Grundriss dargestellte, generalisierte und erläuterte Abbildung eines Teiles oder der gesamten Erde, anderer Weltkörper und des Weltraumes.
Manche der gezeigten Beispiele weisen einige, aber nicht alle Merkmale der Kartendefinition auf. Diese Darstellungen bezeichnen wir als kartenverwandte Darstellungen. Hierzu gehören Globus, Luftbild, Geländeprofil, etc.
Begriff
Der deutsche Begriff „Karte“ entstand aus dem lateinischen charta (Urkunde), da seit dem Altertum Karten zur Dokumentation von Grundbesitz verwendet wurden. Im deutschen bezeichnen wir großmaßstäbige Karten (bis ca. 1:5000) als Pläne, im englischen unterscheidet man die Begriffe map (Landkarte) und chart (Navigationskarten für die See- und Luftfahrt).
Im Folgenden gehen wir nochmals detailliert auf die Definitionsmerkmale von Karten ein.
Kartenmaßstab
Der Kartenmaßstab M ist das Längenverhältnis einer Strecke in der Karte zu der entsprechenden Strecke in der Natur.
Es gilt also:
M = L' : L
mit
M = Kartenmaßstab
L' = Kartenstrecke
L = Naturstrecke
Zur besseren Lesbarkeit wird der Kartenmaßstab umgeformt, so dass eine eins in Zähler steht:
M = 1: (L : L')
Der Term (L : L') stellt den Verkleinerungsfaktor dar und heißt Maßstabszahl m:
M = 1 : m
Beim Maßstab ist zu beachten:
Ein großer Maßstab entspricht einer kleinen Maßstabszahl (z.B. 1:1000), ein kleiner Maßstab entspricht einer großen Maßstabszahl (z.B. 1:100000)
Der Kartenmaßstab bezieht sich nur auf Strecken. Die Flächenverhältnisse ändern sich im Quadrat der Maßstabszahl.
Man würde erwarten, dass ein Kartenmaßstab über die gesamte Karte hinweg einheitlich ist. Diese Anforderung bezeichnet man als Längentreue. Leider entstehen beim Abbilden der Erdkugel auf eine zweidimensionale Fläche immer Verzerrungen, daher ist absolute Längentreue niemals möglich. So sind die in Abbildung 2-6 unterschiedlich langen Strecken AB und CD in der Realität gleich lang, innerhalb der Karte existieren also verschiedene Maßstäbe. Durch eine geeignete Projektion lässt sich diese Verzerrung jedoch reduzieren.
Abbildung 2-6: Maßstab variiert innerhalb der Karte
Verebnung
Eine Karte ist immer auf einem zweidimensionalen Medium (Papier, Bildschirm) dargestellt. Die dreidimensionalen Geländeformen können dabei durch Hilfsmittel wie z.B. Höhenlinien (Isohypsen), Höhenpunkte oder Höhenschichten dargestellt werden (Abb. 2-7).
Abbildung 2-7: Darstellung von Geländeformen
Grundrissdarstellung
Eine Karte ist immer eine Abbildung aus der Lotrechten, Schrägansichten sind hingegen keine Karten im engeren Sinne.
Durch die Grundrissdarstellung kann die Karte nur Distanzen in einer Ebene (Horizontalstrecke) darstellen, Steigungen und Gefalle werden nicht berücksichtigt. Im geneigten Gelände ist daher die Kartenstrecke immer kürzer als die Naturstrecke.
Die reale Länge geneigter Geländestrecken lässt sich aus der Horizontalstrecke und dem Hangneigungswinkel bzw. dem Höhenunterschied berechnen (Abb. 2-8).
Abbildung 2-8: Abbildung als Grundriss
Die Grundrissdarstellung hat nichts mit der Verebnung (s.o.) zu tun. So entsteht z.B. bei einem Schrägluftbild eine Verebnung (eine Abbildung auf ein zweidimensionales Medium), aber keine Grundrissdarstellung.
Generalisierung
„Generalisierung“ bezeichnet die vereinfachte Wiedergabe der Wirklichkeit im Kartenbild. Sie ist notwendig, um die Realität auf der begrenzten Fläche des Kartenblattes abbilden zu können. So können bei 1:1 Mio. einzelne Gebäude nicht mehr maßstabsgetreu dargestellt werden, man stellt dann z.B. nur noch eine Siedlungsfläche dar. Andere Informationen müssen hervorgehoben werden, z.B. die Breite von Straßen (Abb. 2-9).
Abbildung 2-9: Verschiedene Generalisierungsstufen
Als Generalisierung bezeichnet man die zweckmäßige Auswahl und Vereinfachung der darzustellenden Objekte nach ihrer Wichtigkeit und Wertigkeit für den jeweiligen Kartenzweck.
In jeder Karte finden wir zwei Arten der Generalisierung, die geometrische und die inhaltliche Generalisierung.
Eine geometrische Generalisierung ist notwendig, da die absolut genaue Darstellung der Lage und Form von Objekten meist nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Daher werden Objekte erst ab einer bestimmten Mindestgröße dargestellt oder kleinere Objekte zusammengefasst. So werden z.B. in der Topographischen Karte die Gebäude nur ab einer bestimmten Mindestgrundfläche dargestellt oder in einer Weltkarte die Verläufe der Staatsgrenzen stark vereinfacht.
Das Maß der geometrischen Generalisierung ist abhängig vom
• Kartenmaßstab, da sehr kleine Elemente (ca. < 0,1 mm) aus technischen Gründen nicht gedruckt werden können, sowie vom
• gewünschten Detailgrad der Karte. Der Kartograph legt fest, ab welcher realen Größe Elemente auf der Karte nicht mehr maßstäblich sondern generalisiert dargestellt werden.
Es existiert keine verbindliche Vorgabe, wie stark in einer Karte generalisiert werden soll. Als Entscheidungshilfe kann jedoch folgende Formel herangezogen werden:
m = D : d
Dabei gilt:
m = Maßstabszahl (nicht Maßstab!)
D = reale Größe des kleinsten, in der Karte als Einzelobjekt dargestellten realen Objekts (Entität). Dieses Objekt ist also die kleinste, individuell zu kartierende Entität. Es wird daher auch als Minimum Mapping Unit (MMU) bezeichnet.
d = Größe des kleinsten als Einzelobjekt dargestellten Elements in der Karte (Kantenlänge oder Durchmesser bei flächenhaften Elementen, Streckenlänge bei linearen Elementen)
Ein Beispiel: Sie wollen eine Karte der Stadt München im Maßstab 1:25.000 erstellen und bestimmen, dass darauf nur Elemente größer 0,5 mm dargestellt werden sollen. Siebrauchen also nur Elemente zu berücksichtigen, die real mindestens 0,5 mm × 25.000 = 12.500 mm (= 12,5 m) groß sind (Kantenlänge).
Umgekehrt könnten Sie auch festlegen, dass Sie Elemente ab einer realen Größe von 50 m erfassen wollen, diese wollen Sie in der Karte 2 mm groß darstellen. Mit obiger Formel können Sie die notwendige Maßstabszahl errechnen: m = D:d = 50.000 mm:2 mm = 25.000
Als Faustregel zur geometrischen Generalisierung gilt:
• Alle in der Realität gleichartigen Entitäten müssen in der Karte gleichartig generalisiert werden. Sie sollten also nicht bei drei flächenmäßig gleich großen Siedlungen in der ersten alle Gebäude darstellen, in der zweiten die Siedlungsfläche und die dritte nur als Siedlungspunkt.
• Verschiedene Objektbereiche können verschieden stark generalisiert werden. So können Sie z.B. in einer hydrographischen Karte Gewässer schwach generalisieren, Siedlungen stark.
• Damit eine Karte nicht überladen ist, sollte sie keine Elemente enthalten, die weniger als 0,5 mm Kantenlänge aufweisen.
Neben der geometrischen Generalisierung können wir auch eine inhaltliche Generalisierung vornehmen (Klassifikation): Objekte einer Kategorie werden gleich dargestellt. So können alle Straßen einer Kategorie (z.B. Bundesstraßen) als gleich breite Linien dargestellt werden, unabhängig davon, ob diese Straßen in der Realität gleich breit sind. In einem anderen Fall können Siedlungen ab einer bestimmten Einwohnerzahl als „Großstädte“ klassifiziert und gleich dargestellt werden, obwohl die tatsächlichen Einwohnerzahlen leicht unterschiedlich sind.
Jede Klassifikation muss erläutert werden, z.B. im Titel der Karte oder in der Legende.
Erläuterung
Durch die geometrische und inhaltliche Generalisierung kommt es zu einer Abstraktion der Darstellung gegenüber der Realität. Damit der Leser die Karte trotzdem richtig interpretieren kann, benötigt er eine entsprechende Erläuterung.
Abbildung 2-10: Thematische Karte mit Erläuterung
Zur Erläuterung gehören:
• Titel/Thema der Karte
• Zeichenerklärung (als Legende oder Text)
• Maßstabsangabe, falls der Maßstab einheitlich ist
• ggf. Richtungsangabe (Nordpfeil), Kartengitter, Koordinatennetz, weitere erläuternde Texte, etc.
Die Erläuterung sollte alle im Kartenbild vorkommenden graphischen Elemente erklären (Abb. 2-10). Hierzu gehören alle Symbole, Farben und bei manchen Karten auch Schriften. Nur Elemente, deren Bedeutung dem Leser offensichtlich ist, z.B. Staatsgrenzen bei Weltkarten, müssen nicht unbedingt erläutert werden.
Abbildung 2-11: Karte ohne Erläuterung
Das folgende Beispiel (Abb. 2-11) zeigt eine Karte, wie sie oftmals zur Illustration verwendet wird: Die Flächenfärbung repräsentiert nicht thematische Inhalte, sondern dient nur als graphischer Effekt. In bestimmten Zusammenhängen kann eine derartige Gestaltung durchaus sinnvoll sein (z.B. Werbung), in wissenschaftlichen Publikationen ist sie jedoch irreführend und daher zu vermeiden.
Räumliche Abdeckung
Eine Karte stellt einen Ausschnitt des realen Raumes dar, in den Geowissenschaften handelt es sich dabei meist um Ausschnitte der Erdoberfläche oder um die gesamte Erdoberfläche.
Alternativen zu Karten
Es muss nicht immer eine Karte sein: Viele Sachverhalte lassen sich zwar als Karte darstellen, es kann aber sinnvoller sein, eine andere Darstellungsform zu wählen:
• Ein Profil anstatt einer Höhenschichtenkarte
• Ein Luft- oder Satellitenbild anstatt einer Landnutzungskarte
• Ein Diagramm, falls die räumliche Lage eines Sachverhalts nicht relevant ist
• Eine Tabelle, falls exakte Daten abzulesen sein müssen
Die Erstellung einer guten Karte ist mit hohem Aufwand verbunden, daher sollten Sie genau überlegen, ob Sie für eine bestimmte Aussage wirklich eine Karte benötigen.