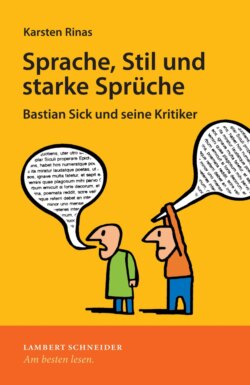Читать книгу Sprache, Stil und starke Sprüche - Karsten Rinas - Страница 9
3. Aufstieg und Niedergang der Sprachpflege
Оглавление| Ein Augenblick – ein Stundenschlag – tausend Jahre sind ein Tag! (Udo JÜRGENS: Tausend Jahre sind ein Tag) |
Die Sprachpflege stand seit jeher in engstem Kontakt zur Rhetorik sowie zu deren Haupterbin, der Stilistik. Daher ist es hier erforderlich, zumindest einen scheuen Blick auf die Entwicklung auch dieser Disziplinen zu werfen.1
Bereits die Rhetorik des ARISTOTELES (384–322 v. Chr.) enthält einen umfangreichen Teil (im dritten Buch), welcher stilistischen Fragen gewidmet ist [1999: 152–183]. Es handelt sich um eine systematische Formulierungslehre, in der unter anderem das Problem der Stilebenen angesprochen wird. Des Weiteren werden auch diverse unzulängliche Ausdrucksweisen (Stilfehler) kritisiert. Zur Illustration mögen ein paar Belege genügen:
„Das erste Prinzip des Stils ist gutes Griechisch.“ [1999: 162] Hierzu rechnet ARISTOTELES u.a.
1 a) den korrekten Gebrauch der Konjunktionen, „wenn man sie entsprechend ihres natürlichen zeitlichen Verhältnisses zueinander einsetzt“ (S. 162);
2 b) das Prinzip, „Dinge mit ihren eigentlichen Bezeichnungen zu benennen und nicht mit Umschreibungen“ (S. 163);
3 c) den Grundsatz, „keine unklaren Ausdrücke […] zu verwenden“ (S. 163).
Diese Grundlagen sind aber durchaus nicht als starre Gesetze zu verstehen, sondern als Empfehlungen, die variabel gehandhabt werden sollen. Beispielsweise kann von dem obigen Prinzip b) auch aus stilistischen Gründen abgesehen werden:
„Zur Erhabenheit des Stils trägt unter anderem bei, eine Umschreibung anstelle des betreffenden Wortes zu verwenden“ (S. 164)
Diese flexible Sicht manifestiert sich auch in der Feststellung:
„Man darf aber auch nicht vergessen, daß für jede Gattung eine andere Ausdrucksweise paßt.“ (S. 181)
Wie so vieles von ARISTOTELES waren auch diese Darlegungen traditionsbestimmend.2 Vergleichbare Ausführungen finden sich beispielsweise in der sehr einflussreichen Rhetorik von Marcus Fabius QUINTILIANUS (ca. 35–100 n. Chr.). Dort werden gleich im ersten Buch – im Zusammenhang mit der Behandlung grammatischer Probleme – auch Fragen der Sprachrichtigkeit angeschnitten, wobei Kriterien wie Analogie, Sprachgeschichte, Logik, Gebräuchlichkeit sowie die Berücksichtigung vorbildlicher Autoren diskutiert werden [1972: 87–105]. QUINTILIANUS legt ausführlich dar, dass diese Kriterien miteinander in Konflikt geraten können. Dies sei hier an einem – anachronistischen – Beispiel aus dem Deutschen illustriert:
Im Deutschen werden die Vergangenheitsformen der Verben vorwiegend auf folgende Weise gebildet:
(1) ich kaufe – ich kaufte – ich habe gekauft
(2) ich lenke – ich lenkte – ich habe gelenkt
Die Bildung erfolgt hier also (unter anderem) durch die Anhängung von -t. Dieses Muster gilt für sehr viele Verben im Deutschen, vor allem auch für sprachhistorisch jüngere Verben, etwa importierte Fremdwörter:
(3) ich investiere – ich investierte – ich habe investiert
(4) ich foule – ich foulte – ich habe gefoult
Analogie ist ein nützliches Instrument zur Bestimmung sprachlicher Regularitäten, doch stößt es an seine Grenzen. So gibt es etwa auch (sog. ‚starke‘) Verben, die sich nicht nach dem gerade skizzierten Muster verhalten:
(5) ich gebe – ich gab – ich habe gegeben
(6) ich finde – ich fand – ich habe gefunden
(7) ich schlafe – ich schlief – ich habe geschlafen
Nun würde wohl niemand gemäß dem Analogieprinzip ernsthaft die Forderung erheben, auch solche Verben ‚regelmäßig‘ zu konjugieren, also etwa:
(8) ich gebe – ich gebte – ich habe gegebt …
Zwar gibt es in gewissem Sinne immer wieder ‚Reformer‘, die sich um solche Vereinheitlichungen bemühen, und zwar kleine Kinder, die Deutsch als Muttersprache lernen. Bildungen wie (8) sind im Spracherwerb sehr üblich.3 Jedoch werden diese grundsätzlich als Fehler korrigiert und dann auch irgendwann von den Kindern unterlassen. In Bezug auf viele häufige Verben wie geben, lesen, kommen, schlafen, trinken usw. duldet die deutsche Sprachgemeinschaft bis heute keine derartigen Systematisierungen bzw. Vereinfachungen, sondern hält an den – sprachhistorisch viel älteren – starken Konjugationsmustern fest. Mit anderen Worten: Neben dem Analogieprinzip ist auch der faktische Sprachgebrauch zu berücksichtigen. Gerade diesen Grundsatz vertritt auch bereits QUINTILIANUS [1972: 93].
Gleichwohl wird das Analogieprinzip mitunter auch mit der Absicht herangezogen, den faktischen Sprachgebrauch zu modifizieren. Dies wurde – im kleineren Rahmen – auch wiederholt im Bereich der deutschen Konjugation versucht. So erschien in der ersten deutschen sprachwissenschaftlichen Zeitschrift, den Beyträgen zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit, im Jahre 1735 ein anonymer Beitrag zur Klassifikation der unregelmäßigen Verben, in welchem u.a. Konjugationsmuster wie die folgenden kritisiert werden:
(9) singen – ich sang – gesungen
(10) verschwinden – ich verschwand – verschwunden
Obwohl diese Muster auch zur damaligen Zeit etabliert waren, plädiert der Autor für eine regelmäßigere Flexion nach dem Muster:
(11) schinden – ich schund – geschunden Er plädiert also für Formen wie:
(12) singen – ich sung – gesungen
(13) verschwinden – ich verschwund – verschwunden
„Man würde viel Abweichungen vermeiden, und richtiger reden, wenn man entweder auch allezeit verschwund, oder, wenn man dieß nicht wollte, verschwanden, verschwände, sagte“. (ANONYMUS 1735: 96)
Dies war ein reichlich gewagter Vorschlag, der auch nicht Schule machen sollte. Wie wir jedoch sehen werden, gibt es bis heute im Bereich der Konjugation Bemühungen zur Regulierung nach dem Analogieprinzip (vgl. Kapitel 4).
Es gab allerdings auch schon früh mahnende Stimmen. So spricht sich ADELUNG (1787: 66f.) – mit deutlicher Anlehnung an QUINTILIANUS – dezidiert gegen solche Maßnahmen und für die Berücksichtigung des Sprachgebrauchs aus.
Zurück zu QUINTILIANUS: Im VIII. Buch seiner Rhetorik werden intensiv Probleme der sprachlichen Gestaltung behandelt, also auch stilistische Fragen, etwa unter dem Gesichtspunkt der Deutlichkeit und der Angemessenheit [1975: 125–249]. Dies illustriert QUINTILIANUS anhand vieler Beispiele. An dieser Stelle möge es jedoch genügen, einige seiner Grundsätze wiederzugeben:
„Vermeiden werden wir alles, was unanständig, schmutzig und niedrig klingt. Niedrig aber klingt, was unter dem Rang ist, der dem betreffenden Gegenstand oder der Person zukommt.“ (S. 139)
„Für uns gelte die Durchsichtigkeit als Haupttugend des Ausdrucks, die eigentliche Bedeutung im Gebrauch der Wörter, ihre folgerichtige Anordnung, kein Schluß, der zu lang hinausgeschoben wird, nichts, das fehle, und nichts, das überflüssig sei“. (S. 149)
„Die Entscheidung für die hervorleuchtenden und erhabenen Wörter hängt meist von dem Stoff der Rede ab. Ein Wort, das hier prächtig wirkt, wirkt an anderer Stelle geschwollen, und Wörter, die bei großen Gegenständen niedrig wirken, wirken bei kleineren passend.“ (S. 157)
In der Rhetoriktradition werden solche stilistischen Fragen der Teillehre der elocutio zugewiesen, worunter der sprachliche Ausdruck, das ‚Einkleiden von Gedanken in Worte‘ verstanden wird.4
In der Neuzeit entstanden diverse deutsche Rhetoriken, die sich oft eng an QUINTILIANUS und andere antike Rhetoriker anlehnten. Ein frühes Werk dieser Art ist der erstmals 1493 veröffentlichte Spiegel der waren Rhetoric: vß Marco Tullio Cicerone: und andern geteutscht … von Friedrich RIEDERER.5 Trotz der engen Anlehnung an die lateinische Rhetorik-Tradition finden sich hier bereits Beobachtungen und Empfehlungen zu speziellen Erscheinungen der deutschen Sprache. So beschreibt RIEDERER – offenbar früher als irgendein Grammatikschreiber–, dass sich das Hilfsverb haben auf mehrere Partizipien beziehen kann (Blatt xlb), wie etwa in:
(14) Frank hat gearbeitet und gesungen.
Und er äußert sich kritisch über die Sitte, dieses Hilfsverb in Nebensätzen wegzulassen (ebd.), er kritisiert also Verkürzungen wie (16) anstelle des vollständigen Satzes (15):6
(15) Dies ist, wie ich bereits gesagt habe, ein weites Feld.
(16) Dies ist, wie ich bereits gesagt, ein weites Feld.
Auch spätere deutsche Rhetoriken fügen sporadisch solche normativkritischen Bemerkungen in ihre Darlegungen ein. Beispielsweise wurde die Weglassung der Hilfsverben in Nebensätzen auch von GOTTSCHED (1739: 324) verurteilt.7 In den meisten deutschsprachigen Rhetoriken hielten sich diese sprachkritischen Bemerkungen aber in Grenzen. Und die Diskussionen zur Sprachrichtigkeit stützten sich oft auf konstruierte, recht albern und unnatürlich wirkende ‚Fehler‘. So fordert etwa UHSE (1704: 323) – letztlich im Anschluss an das von ARISTOTELES formulierte Prinzip a) (s.o.) – den korrekten Gebrauch von ‚Connexiones‘ im Deutschen und führt in diesem Zusammenhang das folgende Beispiel für eine falsche Verwendung an:
(17) Wofern es wahr ist/daß die Menschen sterblich seyn: So laß dir doch ein sauber Kleid machen.
Dieser Gebrauch sei falsch, „denn das letzte fliesset gar nicht aus dem ersten“ (ebd.). Dieser Belehrung hätte es wohl kaum bedurft.
Des Weiteren sei erwähnt, dass bereits im 17. Jahrhundert diverse Poetiken entstanden, die stilistische Ratschläge enthielten, welche zumeist ebenfalls stark der Rhetoriktradition verpflichtet waren. Ein solches Werk ist etwa die Anleitung zur deutschen Poeterey (1665) von Augustus BUCHNER.8
Auch in manchen Briefstellern fanden sich stilistische Anweisungen.9 Die Tradition diesbezüglicher Mustersammlungen ist alt, und auch die theoretische Auseinandersetzung mit dieser Gattung reicht letztlich bis in die Antike zurück.10 Solche Überlegungen reflektiert z.B. die Praktische Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen (1751) von Christian Fürchtegott GELLERT.
Obwohl auch in der Neuzeit zahlreiche Rhetoriklehrwerke entstanden und auf erhebliche Resonanz stießen, wurden sie bereits im Humanismus teilweise scharf kritisiert, vor allem von dem französischen Philosophen Petrus RAMUS, welcher 1549 seinen ‚Anti-Quintilian‘ veröffentlichte. Dieses Werk zeigt einen ebenso respektlosen wie ungerechten Umgang mit der Rhetorik des QUINTILIANUS. Auf Details von RAMUS’ Kritik muss hier nicht eingegangen werden.11 Wichtig ist für unseren Zusammenhang, dass RAMUS sich entschieden gegen die antike Konzeption der Rhetorik als einer zentralen, integrierenden Disziplin der Erziehung und höheren Bildung wendet. RAMUS möchte demgegenüber der Rhetorik nur wenige Aufgaben zuweisen und sie zugleich möglichst scharf von anderen Disziplinen wie z.B. Logik (,Dialektik‘) und Grammatik abgrenzen. Diese Attacke gegen die ‚Zentralwissenschaft‘ Rhetorik sollte sich auf längere Sicht als folgenreich erweisen.
Die kritische Einstellung der klassisch-antiken Rhetorik gegenüber findet schließlich in der Aufklärung weite Verbreitung. Die Rhetorik wird nun zunehmend als eine Art ‚Manipulationskunst‘ wahrgenommen und verdammt.12 Ein bekanntes Diktum dieser Art findet sich in KANTS Kritik der Urteilskraft (1790), § 53: KANT unterscheidet zwischen der ‚Beredsamkeit‘ als „Kunst zu überreden, d.i. durch den schönen Schein zu hintergehen (als ars oratoria)“ und der ‚Wohlredenheit‘, d.i. „Eloquenz und Stil“. Erstere sei für Juristen oder Priester nicht zu empfehlen, denn es sei „unter der Würde eines so wichtigen Geschäftes, auch nur eine Spur […] von der Kunst, zu überreden und zu irgend jemandes Vorteil einzunehmen, blicken zu lassen“. Hier kommt also eine starke Ablehnung der klassischen Rhetorik (Beredsamkeit, ars oratoria) zum Ausdruck, der eine schlichtere, nicht auf Figuren und anderen ‚Kniffen‘ basierende Stilistik (,Wohlredenheit‘) entgegengestellt wird.13
Dieselbe Differenzierung von ‚Beredsamkeit‘ und ‚Wohlredenheit‘ nimmt auch Johann Christoph ADELUNG14 in seinem 1785 veröffentlichten Werk Ueber den Deutschen Styl vor,15 und er will seine Stillehre in den Dienst der letzteren stellen (S. 19f.).16 Es geht ihm somit um die Vermittlung der „Fertigkeit, sich in allen Fällen so auszudrücken, daß man mit Wohlgefallen verstanden werde“ (S. 20). Dies zu lehren sei gerade angesichts des Zustands der deutschen Sprachkultur seiner Zeit notwendig. So habe die neuere deutsche Literatur zwar die ältere „an Erfindung und Lebhaftigkeit des Ausdruckes“ übertroffen, doch mangele es ihr an „Sprachrichtigkeit, Reinigkeit, Klarheit, Angemessenheit und Würde“ (S. 23). Deshalb seien „Vorschriften nothwendig, […] auf die unveränderlichen Gesetze der Schönheit aufmerksam zu machen, und so entstehen dann die Wissenschaften, welche sich mit den Gedanken und ihrem Ausdrucke beschäftigen“ (S. 24).
Auf diese Weise gelingt es ADELUNG, die Notwendigkeit von Formulierungsregeln auch für seine rhetorikkritische Gegenwart zu begründen, nur dass diese Regeln nun nicht mehr im Rahmen einer Rhetorik, sondern einer Stilistik präsentiert werden.17
In seinen Ausführungen ist ADELUNG in erheblichem Maße der antiken Rhetorik verpflichtet, woraus er auch gar kein Hehl macht; ARISTOTELES, QUINTILIANUS und andere werden ausgiebig zitiert. Gleichwohl geht ADELUNG auch detailliert und kenntnisreich auf spezifisch deutsche Probleme ein und lässt damit die bisherigen deutschsprachigen Rhetoriken weit hinter sich.
Auch heute noch ist ADELUNGS Stillehre eine lesenswerte Schrift. Seine Darlegungen weisen ein theoretisches Niveau auf, das manchem neueren Beitrag zu wünschen wäre:
In deutlicher Anlehnung an QUINTILIANUS diskutiert ADELUNG eine Reihe möglicher Kriterien der sprachlich-stilistischen Wertung, etwa Analogie (S. 64–66) und Gebräuchlichkeit (S. 66–68). (Vgl. auch das oben angeführte Zitat zur unregelmäßigen Konjugation.)
ADELUNG betont, dass Verweise auf die Sprachgeschichte bzw. den älteren Sprachgebrauch kein Beurteilungsmaßstab sein könnten (S. 74). Als wichtigstes Kriterium für die Beurteilung dessen, was als hochsprachlich zu gelten hat, gilt ihm der schriftliche Sprachgebrauch:
„Dieser einzige gut Hochdeutsche Sprachgebrauch nun wird am zuverlässigsten aus den Schriften erkannt, nicht nur, weil er sich nur durch diese allein auf die Zukunft übertragen, und in die Ferne verbreiten läßt, sondern auch, weil er in Schriften wenn anders ihre Verfasser die gehörigen Fähigkeiten besitzen, nothwendig reiner und beständiger erscheinen muß, als in dem vorüberrauschenden mündlichen Ausdrucke, wo die Kürze der Zeit und die große Verschiedenheit der Sprechenden nicht allemahl wohl die strengste Befolgung desselben verstatten.“ (S. 74f.)
„Der einstimmige Sprachgebrauch der meisten und besten macht die Regel, nicht Eigenheiten des Volkes, oder einzelner Personen. Eben das gilt von der Schriftsprache aller Nationen.“ (S. 76)
Die Hochsprache wird damit zu einem fest mit der geschriebenen Sprache assoziierten Konstrukt, das keine exakte Entsprechung in einer der zahlreichen gesprochenen Varietäten des Deutschen haben muss.18 Hiermit steht in Einklang, dass ADELUNG auch den einzelnen deutschen Sprachgegenden ihre jeweiligen Besonderheiten bzw. Regionalismen zugesteht. Gegen diese sei gar nichts einzuwenden; sie seien nur eben nicht Bestandteil der Hochsprache (S. 68).
Vor dem Hintergrund dieser Differenzierungen operiert die ADELUNGsche Stilkritik. Beispielsweise rügt ADELUNG bei GELLERT, dass in dessen Schriften diverse ‚Nachlässigkeiten‘ oder ‚Fehler‘ vorkämen, etwa krank sehen für krank aussehen u.a. (S. 76), doch fügt er hinzu:
„Diese werden bloß darum Fehler, weil sie wider den herrschenden Sprachgebrauch der oberen Classen Ober-Sachsens, und folglich auch der meisten und besten Schriftsteller sind.“ (ebd.)
Unter Umständen kann aber auch selbst der allgemeine schriftliche Sprachgebrauch kritisiert werden, wenn sich nämlich gute, z.B. grammatisch fundierte, Gründe vorbringen lassen:
„Die Präposition ohne wird im Hochdeutschen, wenn sie vor dem Substantivo stehet, nie anders als mit dem Accusativo verbunden; ohne dem ist daher unstreitig ein Sprachfehler, der der Aufmerksamkeit entgangen ist.“ (S. 78)
Es spricht aber für ADELUNGS Umsicht, wenn er sogleich hervorhebt:
„Es ist größte Behutsamkeit und viel Sprachkenntniß nothwendig, wenn man etwas für verwerflich erklären will, was den allgemeinen Sprachgebrauch für sich hat.“ (S. 78)
Erstaunlich differenziert und modern ist auch ADELUNGS Einstellung zu sprachlichen Zweifelsfällen. Für ADELUNG ist es durchaus kein Übel, wenn es zu einem Zeitpunkt zwei konkurrierende sprachliche Formen (gewinkt-gewunken o.ä.) gibt. Solche Schwankungen spiegelten nur den Umstand wider, dass Sprache sich wandle (S. 79–81).
In ADELUNGS Stillehre findet sich vieles, was in der späteren normativen Stilistik bis zum heutigen Tage fortleben sollte, beispielsweise eine Kritik an pleonastischen Konstruktionen, also an überflüssigen Doppelaussagen wie ‚imstande sein, etwas zu können‘ oder etwa auch an doppelten Verneinungen wie Niemand hat nichts gesagt u.a. (S. 194f.). Es findet sich auch eine Diskussion des Fremdwortgebrauchs (S. 107–115). Auch diese erfolgt differenziert; ADELUNG ist keineswegs ein eingeschworener Fremdwortgegner. (Mit dieser Diskussion setzt sich ADELUNG aber natürlich implizit mit jenen puristischen Tendenzen auseinander, die in den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts ihren ersten Höhepunkt erlebt hatten.19)
Manche Bemerkungen ADELUNGS wirken auf heutige Leser überzogen, beispielsweise wenn die Nomina Sterblichkeit und Menschheit als falsch gebildet kritisiert werden, weil deren Bedeutung nicht mit der angeblichen Grundbedeutung der Ableitungssilben -keit/-heit in Einklang stehe (S.S. 123). Die Liste solcher problematischen Beispiele ließe sich leicht fortsetzen. So erklärt ADELUNG etwa die Pluralformen Generäle und Herzöge ebenso für ‚provinziell‘ wie die angeblich rein ‚niederdeutschen‘ Wörter düster, Bucht und blank (S. 101). Bereits Eduard ENGEL (1931: 42f.) zitiert Dutzende solcher Beispiele, um zu demonstrieren, dass ADELUNG „mit der bei all solchen Sprachmeisterern üblichen Grobheit die besten, längst eingebürgerten Schöpfungen“ verwerfe, und andere Autoren, beispielsweise Helmut LUDWIG (1983: 35), haben ENGELS Einschätzung eifrig nachgebetet. Eine solche Beurteilung ADELUNGS ist jedoch äußerst einseitig und ungerecht. ADELUNG war schlicht bemüht, einen schriftsprachlichen Standard zu definieren. Dass er hierbei mitunter auch Entscheidungen traf, die der faktische Sprachgebrauch ignorierte oder revidierte, sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Solche sporadischen ‚Fehlentscheidungen‘ ändern aber nichts daran, dass ADELUNGS normative Stillehre insgesamt sehr reflektiert und differenziert gestaltet ist.
Im zweiten Band seiner Stillehre behandelt ADELUNG „besondere Arten des Styles“, wobei er Stilgattungen und Textsorten unterscheidet. Unter anderem bietet er auch recht ausführliche Darlegungen zum Geschäfts- und Kanzleistil (1787b: 38–60), den er mitunter auch als ‚abenteuerlich‘ oder ‚geschmacklos‘ brandmarkt (vgl. v.a. 1787b: 55–58). Damit ist jener Kritik des Amts- und Bürokratendeutschen der Boden bereitet, die bis heute beliebter Gegenstand der normativen Stilistik ist.20
ADELUNG knüpfte in seiner Stilistik also an die traditionell-rhetorische elocutio-Lehre an. Diese verband er mit dem Detailwissen, das im Rahmen der deutschen Grammatikschreibung seit dem 16. Jahrhundert erarbeitet worden war. Freilich war auch diese Grammatikschreibung stark von der antiken Rhetorik geprägt,21 und so nimmt es nicht wunder, dass auch in älteren deutschen Grammatiken sprachkritische Bewertungen der behandelten Phänomene durchaus nicht selten waren. Als Beispiel sei hier die 1663 veröffentlichte Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt-Sprache von Justus Georg SCHOTTELIUS angeführt. Hier finden sich wiederholt Beurteilungen von Phänomenen nach logischen, ästhetischen oder anderen Kriterien. So wird eine Konstruktion wie auf des Vaters sein Begehr von SCHOTTELIUS als redundant bzw. überflüssig gewertet (S. 736). Ferner verurteilt er etwa den Gebrauch von Partikeln wie schreklich, greulich in Er war schreklich lustig als unnatürlich (S. 780). Wertungen dieser Art waren in der deutschen Grammatikschreibung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts weit verbreitet. Und es kann wohl kaum überraschen, dass auch ADELUNGS einflussreiche Grammatik, seine Deutsche Sprachlehre (1782), normative Elemente enthält.
Im 18. Jahrhundert wurden auch bereits lexikographische Werke veröffentlicht, die sich speziell mit sprachlichen Zweifelsfällen befassten. Diese Ausrichtung hatte schon das Werk Beobachtungen über den Gebrauch und Misbrauch vieler deutscher Wörter und Redensarten (1758) von Johann Christoph GOTTSCHED. 1791 erschien die systematisch aufgebaute Anweisung, die gemeinsten Schreib- und Sprachfehler im Deutschen zu vermeiden von Johann Carl ANGERSTEIN. 1796 veröffentlichte Johann Friedrich HEYNATZ den ersten Band seines Versuchs eines Deutschen Antibarbarus, welcher – wie der Untertitel besagt – ein Verzeichnis solcher Wörter bieten soll, „deren man sich in der reinen Deutschen Schreibart entweder überhaupt oder doch in gewissen Bedeutungen enthalten muss“. Und 1802 wurde erstmals das lexikographisch angelegte Werk Über Mir und Mich, Vor und Für; oder: praktischer Ratgeber in der deutschen Sprache von Johann Christoph VOLLBEDING aufgelegt.
Sinnvolle Sprachpflege bedarf großer Sorgfalt, Umsicht und Ausgewogenheit. ADELUNG hat sich in redlicher Weise um die Einhaltung dieser Bedingungen bemüht. Wenn sich hingegen übereifrige Weltverbesserer der Sprachpflege annehmen, kann diese leicht zu einer lächerlichen oder absurden Angelegenheit werden oder gar in Tyrannei ausarten. Ein erster trauriger Höhepunkt dieser Fehlentwicklung wurde schon Anfang des 19. Jahrhunderts erreicht, und zwar von dem Schulmann Christian Heinrich WOLKE22, welcher 1812 ein Werk veröffentlichte, dessen Titel bereits ein gerüttelt Maß an Größenwahn zum Ausdruck bringt:
Anleit zur deutschen Gesamtsprache oder zur Erkennung und Berichtigung einiger (zu weniger 20)tausend Sprachfehler in der hochdeutschen Mundart; nebst dem Mittel, die zahllosen – in jedem Jahre den Deutschschreibenden 10.000 Jahre Arbeit oder die Unkosten von 5.000.00023 verursachenden – Schreibfehler zu vermeiden und zu ersparen
Dies war gewiss ein Extremfall. Doch darf getrost davon ausgegangen werden, dass in den Schulen des 18. und 19. Jahrhunderts so mancher Westentaschen-WOLKE sein Unwesen trieb.24 Und es dürfte nicht zuletzt solcher Übereifer gewesen sein, der Anfang des 19. Jahrhunderts zur Gegenreaktion führte, zu einer Abkehr von der normativen Ausrichtung. Dieser Bruch lässt sich recht genau datieren: Üblicherweise wird das Erscheinen des ersten Teils von Jacob GRIMMS25 Deutscher Grammatik (1819) als dieser Wendepunkt angesehen.26 Tatsächlich enthält das Vorwort zu diesem Werk Äußerungen, die als direkter Angriff auf die normative Sprachwissenschaft gelesen werden können:
„die sprache gleich allem natürlichen und sittlichen ist ein unvermerktes, unbewustes geheimnis, welches sich in der jugend eingepflanzt und unsere Sprechwerkzeuge für die eigenthümlichen vaterländischen töne, biegungen, Wendungen, härten oder weichen bestimmt […]. wer könnte nun glauben, dasz ein so tief angelegter, nach dem natürlichen gesetze weiser Sparsamkeit aufstrebender wachsthum durch die abgezogenen, matten und misgegriffenen regeln der sprachmeister gelenkt oder gefördert würde […]. frage man einen wahren dichter, der über Stoff, geist und regel der sprache gewisz ganz anders zu gebieten weisz, als grammatiker und Wörterbuchmacher zusammengenommen, was er aus Adelung gelernt habe und ob er ihn nachgeschlagen? vor sechshundert jahren hat jeder gemeine bauer Vollkommenheiten und feinheiten der deutschen sprache gewust, d.h. täglich ausgeübt, von denen sich die besten heutigen Sprachlehrer nichts mehr träumen lassen“. (GRIMM 1890 [1819]: 30f.)
Es ist unschwer zu erkennen, wie tief diese Auffassungen in romantischem Denken verwurzelt sind. Der ältere Sprachzustand wird als der bessere dargestellt, und eben ihm gilt GRIMMS eigentliches wissenschaftliches Interesse. Normative Darstellungen der Gegenwartssprache, etwa für die Zwecke des Schulunterrichts, erscheinen ihm hingegen überflüssig und schädlich, weil die ‚natürliche‘ Sprachentwicklung als vorteilhafter bewertet wird; das sich frei Entfaltende, nicht Reglementierte wird als das Bessere angesehen.
Auch in späteren Jahren sprach sich GRIMM wiederholt gegen normative Bestrebungen aus:
„Pedanten und puristen, was eigentlich eine brut ist, sind mir oft so vorgekommen wie maulwürfe, die dem landmanne zu ärger auf feld und wiese ihre hügel aufwerfen, und blind an der Oberfläche der sprache herum reuten und wühlen.“ (GRIMM 1884[1848]: 215)
Einer von GRIMMS Hauptvorwürfen an die ‚Pedanten‘ bestand darin, dass sie für historische Entwicklungen blind seien:
„alle grammatischen ausnahmen scheinen mir nachzügler alter regeln, die noch hier und da zucken, oder vorboten neuer regeln, die über kurz oder lang einbrechen werden. die pedantische ansicht der grammatik schaut über die schranke der sie befangenden gegenwart weder zurück, noch hinaus, mit gleich verstockter beharrlichkeit lehnt sie sich auf wider alles in der sprache veraltende, das sie nicht länger faszt, und wider die keime einer künftigen entfaltung, die sie in ihrer seichten gewohnheit stören.“ (GRIMM 1864[1847]: 329)
Wie die obige Darstellung gezeigt hat, war sich jedoch auch schon ADELUNG über die Wirksamkeit des Sprachwandels und über die Wichtigkeit seiner Berücksichtigung vollkommen im Klaren. Wenn GRIMM ihn im oben zitierten Passus aus dem Vorwort zu seiner Deutschen Grammatik zu den veralteten, nicht weiter beachtenswerten ‚Sprachmeistern‘ rechnet, dann fällt er über seinen Vorgänger ein apodiktisches und ungerechtes Urteil.27 Dies ist in GRIMMS Werk leider kein Einzelfall.
Die gerade zitierten Äußerungen scheinen die oft zu findende Behauptung zu stützen, Jacob GRIMM habe die rein deskriptive Sprachbeschreibung etabliert. De facto ist dies jedoch nur eine Halbwahrheit, denn GRIMM selbst war weit davon entfernt, sich auf reine Deskription zu beschränken. Selbst in seinem Vortrag „Über das Pedantische in der deutschen Sprache“ (GRIMM 1864[1847]), dessen Titel ein antipuristisches und antinormatives Pamphlet erwarten ließe, wimmelt es nur so von Aussagen, die illustrieren, dass GRIMM an den Sprachzuständen seiner eigenen Zeit irre geworden ist und sich gerade nicht mit ihnen abfinden möchte. Da wird zum Beispiel das Wort Warnungsanzeige als „unnützer pleonasmus“ gebrandmarkt (S. 346), ja es wird gar das Siezen als „am meisten zu verwünschende“ Anredeform attackiert (S. 334). Eine derart anmaßende Kritik am geltenden Sprachgebrauch hätte sich ADELUNG wohl kaum erlaubt! Tatsächlich hat GRIMM zwar wiederholt gegen Normierer gewettert, er selbst hat jedoch in dieser Hinsicht keine Enthaltsamkeit geübt. Dies blieb vielmehr seinen Schülern überlassen, die – wie so oft – weitaus konsequenter waren als ihr Meister.
Bezeichnend ist auch die im obigen Passus aus GRIMMS Vorwort zur Deutschen Grammatik geäußerte Klage über den Sprachverfall. GRIMM greift hier auf einen Topos zurück, der sonst typischerweise den normativen Sprachkritikern zugeschrieben wird.28 Zwar will SANDERS (1992: 58) GRIMM vor einer solchen ‚Unterstellung‘ schützen, indem er zeigt, dass dieser so manche sprachliche Veränderung auch positiv bewertet habe.29 Dadurch werden jedoch GRIMMS wiederholte Sprachverfallsklagen nicht ausgemerzt.30 Vielmehr zeigt sich auch hier, dass GRIMMS Darlegungen letztlich inkonsistent sind und sich jeder aus ihnen das heraussuchen kann, was ihm zusagt.31
Mit diesen kritischen Bemerkungen soll natürlich nicht bestritten werden, dass GRIMMS Werk für die Germanistik äußerst ergiebig und stimulierend war. Seine mit geradezu unglaublichem Fleiß erarbeitete Deutsche Grammatik – die in Wahrheit eine vergleichende Grammatik der germanischen Sprachen ist – hat erstmals eine vertiefte historische Sicht auf die deutsche Sprache ermöglicht und auch in methodischer Hinsicht Maßstäbe gesetzt. Dennoch ist GRIMMS Beitrag zur Sprachwissenschaft ambivalent, vor allem deshalb, weil seine wichtige Forschungstätigkeit oft kaum in Deckung zu bringen ist mit seinen radikalen, überdreht-idealistischen, manchmal auch geradezu wirren programmatischen Äußerungen. Dies gilt keineswegs nur für die Deutsche Grammatik, es gilt etwa auch für das Vorwort zum Deutschen Wörterbuch, welches GARDT (1999: 263) mit Recht als „auf eine eigenartige Weise uneinheitlich“ charakterisiert.
Und wie schon am Beispiel ADELUNGS deutlich wurde, war Jacob GRIMM auch im Umgang mit seinen Vorgängern weder konsistent noch differenziert, sondern oft apodiktisch und ungerecht. Ganz damit befasst, Neuland zu erschließen, hatte er keinen Blick für die wertvollen Errungenschaften der älteren Forschung. Selbst der GRIMM-Bewunderer Wilhelm SCHERER deutet dessen aggressiv-sprunghafte Vorgehensweise an (1885b: 10): Jacob GRIMM „war ein Eroberer, der ein neues Reich gründete“; er „strebte unersättlich von vornherein in’s Grosse, in’s Allgemeine“; er ‚,durchmass eine unregelmässige Bahn, in der es an Umwegen und Irrwegen nicht fehlte“.32
GRIMMS unangemessene und einseitige Urteile sollten sich gerade auch für die normative Sprachbetrachtung als folgenreich erweisen. Seine Schüler, die fortan den Mainstream der Sprachwissenschaft konstituierten, richteten ihr Interesse vornehmlich auf die älteren Sprachzustände und versuchten ‚Fakten‘ zu ermitteln und zu klassifizieren. Die normative Sprachbetrachtung hingegen wurde aus der Wissenschaft hinausgedrängt. Und selbst die Stilistik wurde zunehmend ‚verwissenschaftlicht‘.33 Nicht wenige Stilistiken orientierten sich an der traditionell-rhetorischen elocutio-Lehre, verzichteten aber auf eine Diskussion interessanterer Probleme und Zweifelsfälle im Deutschen. Beispiele für solche Werke sind etwa WACKERNAGEL (1873) oder MEYER (1906). Im Grunde waren diese Stilistiken somit eine Rückkehr zu den wenig ergiebigen elocutio-Lehren älterer deutscher Rhetoriken; die stilkritischen Bemühungen ADELUNGS wurden ignoriert.
Ganz in Vergessenheit gerieten sie jedoch nicht, denn der Wunsch nach Anleitungen zum ‚guten Deutsch‘ und das Bedürfnis nach Rat in sprachlichen Zweifelsfällen waren immer noch vorhanden. Dies lässt sich daran ablesen, dass weiterhin Werke mit dieser Zielsetzung erschienen, von denen einige sehr erfolgreich waren:
In manchen Briefstellern fanden sich nach wie vor detaillierte normative Auseinandersetzungen mit sprachlichen Problemfällen im Deutschen. Exemplarisch genannt sei das Werk Der deutsche Secretär von Johann Daniel Friedrich RUMPF, welches offenbar zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals erschien und dann viele Auflagen erlebte.34
Auch wurden weiterhin einige normativ ausgerichtete Stillehrbücher veröffentlicht. Ein Beispiel hierfür ist S. A. H. HERLINGS Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Stylistik (1837), welches sowohl für Autodidakten als auch für den Schulunterricht konzipiert ist. Dies illustriert auch, dass im Rahmen des Schulunterrichts die normative Tendenz fortlebte. Nicht zuletzt deshalb sollte es im 19. Jahrhundert auch zu einer zunehmenden Entfremdung von Schulgrammatik und Sprachwissenschaft kommen, ein bedauerlicher Zustand, der teils bis heute anhält.35
Am Ende des 19. Jahrhunderts scheint das Interesse an normativen Sprachdarstellungen anzuwachsen. Man könnte dies mit der deutschen Reichsgründung in Verbindung bringen: So, wie die ‚verspätete deutsche Nation‘ in diversen Bereichen – etwa im Kolonialismus – den anderen europäischen Nationen nacheiferte, so versuchte man auch im Bereich der Sprachkultur Anschluss an Vorbilder wie Italien oder Frankreich zu finden.36 Explizit wird dieses Ziel z.B. von SCHMITS (1901[1892]: 53) formuliert. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall erscheinen nun in schneller Folge viele Arbeiten mit dieser Thematik:37
Daniel SANDERS38 setzt die Tradition der lexikographischen Bearbeitung der sprachlichen Zweifelsfälle fort und veröffentlicht 1872 sein Kurzgefaßtes Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten in der deutschen Sprache, dem er 1880 ein noch umfangreicheres Wörterbuch zu derselben Problematik folgen lässt. Beide Werke waren außerordentlich erfolgreich und erlebten viele Auflagen. Mit ihrer Zielsetzung und Konzeption können sie als direkte Vorläufer des weitverbreiteten DUDEN-Bandes Richtiges und gutes Deutsch angesehen werden, der jetzt in 6. Auflage vorliegt (2007).39
Auch erscheinen nun diverse systematische Darstellungen zu Sprachfehlern und Zweifelsfällen, z.B. LEHMANN (1877), KELLER (1879), ANDRESEN (1880), VON WOLZOGEN (1880) und MATTHIAS (1892) sowie VON SOSNOSKYS Blütenlese (angeblicher) sprachlicher Fehler aus Werken der neueren Literatur (1890). Es handelte sich um eine regelrechte Bewegung, die teils in bewusster Absetzung zu den von Jacob GRIMM in Umlauf gebrachten Auffassungen eingeleitet wurde. Deutlich wird dies von Theodor MATTHIAS im Vorwort zu seinem Werk Sprachleben und Sprachschäden (1892) ausgesprochen:
„Auf der Veränderlichkeit auch dieser [grammatischen und stilistischen] Gesetze beruht die Schwierigkeit, sie für alle bindend, d.h. von allen anerkannt zu fassen, beruht die Unmöglichkeit, sie für lange Zeiträume zutreffend zu geben. Weil man Sprachgestaltung eine Zeit lang mit angewandter Logik gleichsetzte, versuchte man trotzdem das letztere; und so herrschten starr und unumschränkt einst Adelung und später Becker, Heyse u.a. Jakob Grimm erst erkannte auf Grund umfassendster geschichtlicher und beschreibender Betrachtung auch der Sprache die Unrichtigkeit jener Gleichsetzung und die Unwahrheit des Beharrens der Spracherscheinungen und räumte mit der Sprachbetrachtung vor ihm erbarmungslos auf. Aber mit dem Wuste unberechtigter Ausstellungen fegte er im Eifer der Entrüstung auch viele berechtigte Bestimmungen der Sprachlehrer, alle Achtung vor Lehren der Grammatik und schließlich deren Pflege hinweg, und seine Schüler stürmten hierin gerade am eifrigsten in seinen Bahnen weiter.
Jetzt erst beginnt man immer deutlicher und schmerzlicher zu erkennen, daß auch die Vertreter der geschichtlichen oder beschreibenden Grammatik zu weit gegangen sind. Den rechten Mittelweg aber erkennt man darin, daß die geschichtliche Entwicklung und Veränderung innerhalb längerer Zeiträume anerkannt, daneben aber die Notwendigkeit zugegeben werde, für eine kürzere Spanne Zeit das in der Flucht ihrer grammatischen Erscheinungen Überwiegende und Üblichere als das Regelrechte, Sprachrichtigere und daher dem gewöhnlichen Schreibenden, nicht den vereinzelten Neuschöpfern und Weiterbildnern der Sprache, als das Musterhafte und Nachahmenswerte vorzustellen.“ (S.#160;IIIf.)
Auch diese Darlegung ist den älteren Grammatikern gegenüber einseitig und ungerecht und ist insofern (wohl unbewusst) dem von GRIMM gezeichneten Zerrbild verpflichtet, doch ist das hier nicht das Entscheidende. Wichtig ist vielmehr, dass hier deutlich das Bedürfnis nach Sprachpflege artikuliert und somit ein Bruch mit der deskriptiven Enthaltsamkeit gefordert wird.40
Von den sprachpflegerischen Arbeiten des ausgehenden 19. Jahrhunderts fand den größten Widerhall ein Werk, das der Lehrer und Archivar Gustav WUSTMANN41 1891 unter dem Titel Allerhand Sprachdummheiten veröffentlichte. Hierbei handelte es sich um eine Sammlung sprachkritischer Glossen, die WUSTMANN seit 1879 für die Zeitschrift Die Grenzboten verfasst hatte.
Die Glossen dieses Buches sind insofern geordnet, als sie verschiedenen Abteilungen der Sprachlehre (Formenlehre, Wortbildungslehre, Satzlehre, Wortschatz) zugewiesen wurden. Dennoch lässt sich konstatieren, dass WUSTMANNS Darlegungen sprunghaft und weitgehend unsystematisch sind. Vor allem aber sind sie in einem schrillen, reißerischen Stil verfasst. Dies gibt neben dem Titel auch der aggressive Untertitel zu erkennen: Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen. – Sprachliche Phänomene pauschal als ‚falsch‘, ‚hässlich‘, ‚abstoßend‘ usw.42 zu werten, das ist die typische Attitüde des eifernden Puristen. Während ADELUNG sich methodisch reflektiert und argumentreich um die Klärung sprachlicher Zweifelsfälle bemüht hatte, war WUSTMANN rechthaberisch und ruppig. Doch gerade dieser forsche Ton fand beim Publikum besonderen Anklang. Noch 1966 erschien eine überarbeitete Neuausgabe der Sprachdummheiten (in 14. Auflage).43
Wenn auch WUSTMANNS Ausführungen nicht derart abwegig sind wie die seines Vorgängers WOLKE, so kann man dennoch auch sein Werk als Pervertierung eines im Grunde sinnvollen Vereinheitlichungsbemühens deuten. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert haben Philologen sich bemüht, in Rechtschreibung, Formenbildung und Wortschatz eine gewisse Vereinheitlichung herbeizuführen. Dem lag das rationale Bestreben zugrunde, die überregionale sprachliche Kommunikation zu fördern. Derartige Bemühungen können allerdings übers Ziel hinausschießen, wenn mit Feuereifer jede Variation bekämpft und jeder auch noch so marginale Einzelfall reglementiert wird.44 Es war letztlich auch dieser Übereifer, der zum Beispiel im 18. und 19. Jahrhundert die Transformation der recht freien, rhetorisch geprägten Interpunktion in ein strikt syntaktisch reguliertes Zeichensetzungssystem herbeiführte, mit dem Ergebnis, dass man sich im 20. Jahrhundert – bis zur Rechtschreibreform von 1996 – allein mit mehr als fünfzig Kommaregeln herumplagen musste.45 Auch die WUSTMANNSchen Sprachdummheiten sind Ausdruck einer Reglementierungssucht, die, nähme man sie ernst, in Despotismus ausarten müsste.
Gerade WUSTMANNS Werk stieß bei vielen Sprachwissenschaftlern auf heftige Ablehnung. Hierauf werden wir in Kapitel 5 zu sprechen kommen.
Es ist nicht verwunderlich, dass WUSTMANNS massenwirksamer pointierter Stil oft – mehr oder weniger getreu – kopiert wurde. Auch im 20. Jahrhundert wurden viele Glossensammlungen veröffentlicht, die sprachkritische Fragen auf unterhaltsame Weise vermitteln wollen und hierbei mal mehr, mal weniger polemisch angelegt sind,46 beispielsweise JANCKE (1936, 1949), HEUER (1972), NÜSSLER (1985), LEONHARDT (1986), HIRSCH (1988a,b). Die meisten dieser Glossen wurden zuvor als Zeitungsbeiträge publiziert: „Der Weg verläuft fast regelmäßig von der Zeitung ins Buch“ (SANDERS 1992: 15).
Von den Sprachglossen können normative Stilistiken abgegrenzt werden, die sich um eine systematische Darlegung bemühen. Eine der einflussreichsten Stilistiken dieser Art ist die 1911 erschienene Deutsche Stilkunst von Eduard ENGEL,47 die bis 1931 in insgesamt 31 Auflagen erschien. In gewisser Hinsicht kann ENGEL als Fortsetzer der sprachkritischen Bemühungen ADELUNGS aufgefasst werden.48 Hierfür spricht nicht nur die systematische Darstellung, sondern auch der beeindruckende Beispielreichtum, mit welchem der äußerst belesene Autor aufzuwarten weiß. Allerdings sind auch die Darlegungen ENGELS ähnlich schrill und ruppig wie die WUSTMANNS.49 Namentlich in der Bekämpfung der Fremdwörter entfaltete ENGEL einen Eifer, der keine Grenzen kannte.50
Auch die ENGELsche Stillehre hat Nachahmer gefunden. Das zweifellos einflussreichste an ENGEL anschließende Werk ist das 1943 veröffentlichte Buch Deutsche Stilkunst von Ludwig REINERS, das seit der zweiten Auflage von 1949 nur noch den verkürzten Titel Stilkunst aufweist.51 Dass dieses Werk ‚an ENGEL anschließt‘, ist allerdings euphemistisch formuliert. Stefan STIRNEMANN hat in mehreren Beiträgen (2003, 2004) überzeugend ausgeführt, dass die Anleihen, die REINERS bei ENGEL macht, ein solches Ausmaß aufweisen, dass man die Stillehre von REINERS durchaus als Plagiat ansehen kann. REINERS hatte diesen geistigen Diebstahl begehen können, weil ENGEL bereits 1938 verstorben war und seine Schriften im Dritten Reich aufgrund seiner ‚jüdischen Abstammung‘ nicht mehr gedruckt wurden.52 REINERS’ Stilkunst dürfte wohl eines der erfolgreichsten Plagiate in der Geschichte des deutschen Buchhandels darstellen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Interesse an Fragen der Sprachpflege erhalten, es nahm wohl sogar zu.53 Sowohl in der BRD als auch in der DDR gab es intensive Bemühungen, die teils auch institutionell verankert wurden.54 So sind auch diverse neuere systematische Stillehren mit normativem Anspruch entstanden. Exemplarisch genannt sei hier das Lehrbuch Wie schreibt man gutes Deutsch? (1969) von Wilfried SEIBICKE, auf das wir in Kapitel 7 eingehen werden, und die Praktische Stillehre (1983) von Georg MÖLLER, die sich durch eine ungewöhnlich intensive Berücksichtigung der Ergebnisse und Konzepte der neueren Sprachwissenschaft auszeichnet. Weitere systematisch angelegte Werke, mit teilweise anderer Konzeption, haben beispielsweise Helmut SEIFFERT (1977), Edith HALLWASS (1979) und Wolf SCHNEIDER (1984) vorgelegt.
Es ist im Übrigen typisch für die modernen populären Sprachglossen und Stillehren, dass sie nicht von professionellen Sprachwissenschaftlern, sondern von ‚Laien‘ (beispielsweise Journalisten oder Lehrern) verfasst werden,55 was freilich nicht ausschließt, dass auch diese studierte Germanisten sind und zudem natürlich grundsätzlich nichts über deren Qualifikation und Fähigkeiten besagen muss. Allerdings zeigt sich in der Praxis doch, dass einige dieser ‚Laien‘ in grammatischen oder auch generell philologischen Fragen recht unbedarft sind.56 Eine eherne Regel ist dies jedoch nicht. Sprachkritischen Autoren wie Edith HALLWASS, Walter ROST oder Helmut SEIFFERT wird man gründliche philologisch-grammatische Kenntnisse schwerlich absprechen können.
Es bleibt noch auf eine Spielart der Sprach- und Stilkritik einzugehen, für die die Sprache nicht das eigentliche Ziel der Bemühungen ist, sondern vielmehr der Ausgangspunkt für eine weiter führende Kultur- oder Gesellschaftskritik. Diese Art von Sprachkritik wird gerne von Philosophen und anderen Intellektuellen praktiziert. Klassische Beispiele hierfür sind etwa Arthur SCHOPENHAUERS Abhandlung „Über Schriftstellerei und Stil“ (1851: 420–452) oder der 11. und 12. Abschnitt aus Friedrich NIETZSCHES Unzeitgemäßen Betrachtungen I (1988: 220–242). (Mit ihrem Eifern und Geifern können diese beiden Philosophen im Übrigen mühelos mit WUSTMANNS rüden Ausfällen konkurrieren.) Auch die sprachkritischen Glossen von Karl KRAUS (1937) wären hier einzureihen. Typisch für die genannten Autoren ist unter anderem eine intensive kritische Auseinandersetzung mit dem ‚schlechten Zeitungsstil‘ oder generell mit dem Stil der modernen massenwirksamen Schriftkultur. In dieselbe Kerbe haut auch Otto SCHRÖDER mit seinem erfolgreichen Buch Vom papiernen Stil (1889), welches wiederum inspirativ auf WUSTMANN gewirkt hat. Schon dieses Beispiel illustriert, dass die Grenzen zwischen primär sprachbezogener Kritik und kultur- bzw. gesellschaftskritischer Sprachkritik durchaus fließend sind. Diese enge Verbindung belegt etwa auch der Umstand, dass Eduard ENGELS Stilkunst stark von SCHOPENHAUER beeinflusst ist (vgl. ICKLER 1988). Generell lassen viele Werke sich nicht eindeutig einer der beiden Richtungen zuweisen. Dies gilt z.B. auch für das viel diskutierte Wörterbuch des Unmenschen (STERNBERGER/STORZ/SÜSKIND 1957) oder für Karl KORNS Sprache in der verwalteten Welt (1958).57
Schließlich sei noch kurz eine Form der philosophischen Sprachkritik erwähnt, die gar nicht darauf abzielt, die Sprache oder den Stil zu reformieren, sondern vielmehr eine philosophische Untersuchung der Sprache anstrebt, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob die Sprache ein geeignetes Instrument der Erkenntnis sei.58 Diese Art von Kritik wird zum Beispiel in dem in letzter Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit findenden philosophischen Werk Fritz MAUTHNERS (1923) praktiziert. Diese philosophische Sprachkritik ist freilich wesentlich älter. Ansätze hierzu finden sich bereits im Dialog Kratylos des ARISTOTELES-Lehrers PLATON (427–347 v. Chr.). Er wird daher mitunter auch als eigentlicher Begründer der Sprachkritik angesehen.59 Eine solche Sichtweise ist nicht unbedingt falsch, aber für unsere Fragestellung unzweckmäßig. Hier sollen diejenigen Ansätze interessieren, die unmittelbar in eine praktische Sprachpflege münden, und diese sind primär im Bereich der Rhetorik zu verorten. Für das Thema dieses Buches sind daher solche rein philosophisch (ontologisch/erkenntnistheoretisch) ausgerichteten Sprachkritiken nicht von Interesse; ich werde sie im Folgenden nicht weiter berücksichtigen.