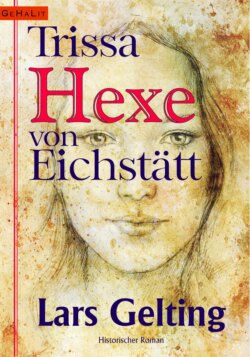Читать книгу Trissa, Hexe von Eichstätt - Lars Gelting - Страница 7
5. Ausgeliefert – im Turm
ОглавлениеZunächst schien es so, als seien ihre Sorgen und Vorkehrungen unbegründet. Christine wurde beerdigt, und ganz selbstverständlich folgte auch Lina dem Sarg. Lisbeth, so hieß es hinter vorgehaltener Hand, sei unversehens wirr im Kopf geworden und musste zu Hause bleiben. Mehr nicht! Alles hatte offensichtlich seine Ordnung, schien zu sein, wie es unter Nachbarn immer war.
Therese kehrte also mit dem Gefühl zurück, eine bedrohliche Situation noch einmal unbeschadet überstanden zu haben. Aber schon einen Tag später wurden die angstvollen Sorgen und Befürchtungen grausige Wirklichkeit.
Therese war gerade dabei, zusammen mit ihrem Sohn die wurmstichigen und morschen Trittstangen einer alten Leiter auszuwechseln, als unversehens ein Soldat auf den Hof geritten kam. Hinter ihm, noch ein ganzes Stück entfernt, ruckelte und polterte ein kleiner, einspännig gezogener Wagen den Berg hinauf: der „Sünderkarren“! Jeder im Ort kannte ihn, jedem grauste davor.
Der Soldat machte sich nicht die Mühe, von seinem Pferd abzusteigen, sondern ritt quer über den Hof auf Therese zu, die sich ahnungsvoll aufgerichtet hatte. „Du bist Therese Driesner?“ fragte er und fuhr gleich fort, ohne eine Antwort abzuwarten „Du wirst auf Beschluss des bischöflichen hohen Gerichtes arretiert!“ Schon diese Anredeform war eine Unverschämtheit und machte Therese unvermittelt klar, dass man in ihr keine achtenswerte Person mehr sah. Der Sünderkarren, ein zweirädriger Karren, auf dessen Ladefläche nichts anderes, als eine einfache Holzbank mit einem Fußschloss stand, kam holpernd hinter dem großen Holunderbusch her auf den Hof gefahren. Plötzlich wurde es auf dem kleinen Hof ungewöhnlich eng: Lina eilte um die Hausecke, die Hände noch voller Gartenerde, ihr vorweg in raschem Lauf Anna, die – wie ein junges Fohlen – zielstrebig zur Mutter rannte und sich hinter deren Rock versteckte.
Lina war mit festen Schritten über ihren Hof gegangen, zwang dabei den Sünderkarren, der ihren Weg kreuzte, zum Anhalten, und stellte sich hocherhobenen Hauptes den Schergen in den Weg, Therese mit ihren Kindern im Rücken. „Was soll der Auflauf auf unserem Hof?“ Niemals hatte Therese ihre Lina so selbstsicher, fest und energisch reden hören. Und tatsächlich fühlte sich der Soldat genötigt, Lina noch einmal den Grund für seine Anwesenheit zu nennen. Und wieder kam die Antwort ganz ruhig und fest, jeden Widerspruch von vornherein zurückdrängend: „Auf diesem Hof wohnen seit seinem Bestehen achtbare und ehrliche Leute! Hier wird niemand arretiert!“
Doch da gab es jemanden, der den Soldaten mehr beeindruckte als Lina „Nehmt euch zurück Frau! Wir haben einen Befehl des hohen Gerichts, und den werden wir auch ausführen!“ Unmissverständlich hatte er sich, während er das sagte, aufrecht in seinen Sattel gesetzt und hatte den beiden Bütteln auf dem inzwischen hinzu gefahrenen Sünderkarren ein Zeichen zum Handeln gegeben.
„Dann müsst ihr uns wohl alle vier arretieren!“ Lina sagte es ganz ruhig und entschlossen und stellt sich neben Therese und die Kinder.
Der Soldat beugte sich etwas im Sattel vor, veranlasste die dumpf auf Therese zusteuernden Büttel durch eine kurze Handbewegung und einen schnellen Blick, noch zu warten, und wandte sich dann geradezu verständnisvoll an Lina „Seid vernünftig Frau! Wir werden euch nicht alle vier arretieren! Aber wir werden unseren Befehl ausführen, und ihr werdet uns nicht daran hindern können!“ Einen kurzen Moment verharrte er noch in seiner vorgebeugten Haltung, sein Blick ging zwischen Lina und den Kindern hin und her, sprach ohne Worte. Dann richtete er sich wieder auf. Ein kurzes Nicken in Richtung der Büttel, und die stapften los wie Hunde, die man von der Leine gelassen hatte. Ohne sich weiter um Lina zu kümmern, trennten sie Therese von ihren Kindern, die spürten, dass hier etwas Schreckliches vor sich ging. Weinend klammerten die sich an ihre Mutter, wurden von dieser fest an sich gepresst, sodass die Kerle alle Mühe hatten, die Kinder von ihre Mutter zu lösen. Rasch, als wollten sie die Angelegenheit nur schnell hinter sich bringen, schoben die beiden Kerle Therese zum Wagen. Hoben die verzweifelt Weinende auf die Ladefläche und banden sie dort mit dem Rücken in Fahrtrichtung fest, schlossen ihre Füße in das Fußschloss, und ohne weitere Verzögerung setzte sich der Karren in Bewegung.
Das letzte, was Therese durch einen dichten Tränenschleier sah und was sich ihr unauslöschlich eingeprägte, war, dass Lina ihre Kinder Franz und Anna rechts und links fest an sich gedrückt hielt und hoch aufgerichtet, das Haus im Rücken, hinter ihr hersah. ...
„So war es! So, und nicht anders!“ Sie sah hinaus in die lichte Dunkelheit auf die Wiese. Betretenes Schweigen. Stefan lag mit beiden Unterarmen auf dem Tisch und schaute sie – immer noch vom Nachhall ihrer Worte gefangen – mit offenem Mund an.
„Ja, so war es!“ Franz holte tief Luft, stieß sie unter hohem Druck wieder aus und stiert wie suchend in den sternenklaren Himmel, „Lina hat uns damals an sich gepresst, dass es schon weh tat. ...
Zum ersten Mal in seinem jungen Leben fühlte er die Angst. Spürte, wie Lina, die sonst nie ratlos war, die immer wusste, wie es weiterging, am ganzen Körper zitterte und bebte, hörte die kleine Anna neben sich herzerweichend schluchzen, ohne wie gewöhnlich laut loszuheulen, sah wie der Karren mit seiner weinenden Mutter sich rasch entfernte. Da kroch die Angst, aus Linas Kleidern kommend, wie ein unsichtbares Wesen an ihm hoch, schnürte ihm die Kehle zu, nötigte ihn, wieder und wieder zu schlucken und drückte ihm das Wasser in die Augen. Als Lina sich endlich umdrehte, um mit ihnen ins Haus zu gehen, riss er sich los und rannte den Berg hinunter, dem Karren hinterher. Hinter ihm blieb es still. Lina rief ihn nicht zurück. Unterhalb der Wiese, auf der ihre beiden Kühe teilnahmslos in der Sonne lagen und wiederkäuerten, verließ er den Weg und lief durch den Wald, um so den Weg abzukürzen. Zweige schlugen ihm gegen die Beine, ins Gesicht, er spürte es kaum. Der Wagen! Er musste ihn einholen! Was er dann machen wollte, wenn er ihn eingeholt hätte, das wusste er nicht, das war nichts, worüber er nachdachte. Er folgte nur dem Drang, seine Mutter auf dem Karren einzuholen.
An der kleinen Steigung, kurz bevor er wieder auf den Weg kam, blieb ihm die Luft weg. Er keuchte, lief weiter, stolperte über irgendetwas und fiel der Länge nach hin, kroch , mit zusammengebissenen Zähnen, verzweifelt in sich hinein weinend, einfach das letzte Stück des Abhanges hoch und stand dann auf dem Waldweg. Er wusste, dass er sich links halten musste, lief einfach in dieser Richtung weiter, bekam Seitenstiche – und blieb wie angewurzelt stehen: Vor ihm, nur einen Steinwurf entfernt, stand mitten auf dem Weg der Soldat. Er lehnte an seinem Pferd, so als habe er auf ihn gewartet. Auf dem Pferd sitzend hatte er eben größer ausgesehen, jetzt war er eher klein und rundlich. Dennoch: Wie er so dastand, mitten auf dem Weg, mit seinen dicken braunen Stiefeln, deren Schäfte über die Knie hochgeklappt waren, mit seiner Uniform und dem matt glänzenden Helm auf dem Kopf, da machte er Franz schon ein wenig Angst. Ein Übriges tat der Degen an der Seite, dessen Griff in der Sonne blinkte. Schwer atmend stand Franz auf dem Weg, dem Soldaten gegenüber, wischte sich mit einer unbewussten, raschen Bewegung die Tränen aus dem Gesicht und wagte sich nicht weiter. Einen kurzen Augenblick regte sich weder er noch der Soldat, dann stieg dieser ruhig auf sein Pferd und kam langsam auf ihn zu. Sein Atem flog, sein Herz schlug sich an den Rippen wund, die Furcht zerriss ihn fast, drängte ihn, den Abhang wieder hinunter zu laufen, aber er blieb stehen! Auch dann noch, als das Pferd dicht neben ihm stand.
„Geh nach Hause, Junge!“ Der Soldat hatte ganz ruhig zu ihm gesprochen. Die Stimme klang freundlich und er wagte es, zu ihm hochzusehen. Er schaute in ein unrasiertes, von schwarzen Stoppeln übersätes Gesicht. Überhaupt wirkte der Mensch da auf dem Pferd, aus der Nähe betrachtet, ziemlich ungepflegt, aber er schaute freundlich und irgendwie verstehend auf ihn herunter. „Komm, geh wieder nach Hause!“
Franz wagte ein vorsichtiges „Nein! – Ich will zu meiner Mutter!“
„Ich weiß! Du wärst wohl auch kein richtiger Junge, wenn du nicht wenigstens versucht hättest, sie noch einzuholen. Deswegen habe ich hier gewartet. Ich wusste ganz sicher, dass du kommen würdest.“
Die Tränen hörten einfach nicht auf zu laufen und Franz wischte sich wieder mit dem Handrücken durchs Gesicht, zog rasch und hörbar die Luft in der Nase hoch. Er hatte plötzlich keine Angst mehr vor dem Menschen, der da so verständnisvoll zu ihm redete.
„Aber glaube mir: Du wirst sie nicht mehr einholen und kannst nicht mehr mit ihr reden. Geh jetzt nach Hause und warte, es wird schon alles gut.“
„Aber warum habt ihr sie abgeholt und gefesselt?“ Die Frage kam eindringlich und Franz bemühte sich, das Schluchzen zu unterdrücken, während ihm die Tränen nun erneut über die Wangen liefen.
„Weil man uns den Befehl gegeben hat das zu tun!“
„Aber warum denn? Meine Mutter kann niemandem etwas tun?“
„Warum, warum? – Wenn man einen Befehl bekommt muss man den Ausführen! Da kann man nichts machen. Mir gefällt das auch nicht immer!“ sagte der Soldat.
„Aber warum denn meine Mutter?“ Die Tränen liefen nun wie Sturzbäche durch sein Gesicht, seine Hand fuhr zur Abwechslung mal unter der Nase durch.
Der Mensch auf dem Pferd schob seinen Metallhelm etwas nach hinten und wischte sich über die Stirn. „Das kann ich dir auch nicht so genau sagen, mein Junge! Darum sei vernünftig und geh jetzt zurück zum Hof!“ Er ritt ein paar Schritte weiter, wendete sein Pferd und kam dann wieder zurück.
„Wo habt ihr sie hingebracht?“
Der Soldat hielt noch einmal an und schaute auf ihn herunter. Irgendwie schauten seine Augen jetzt traurig: „Du kannst fragen Junge! – Wir bringen sie jetzt zuerst in den Turm und wenn alles vorbei ist, bringen wir sie wieder zurück. So, und jetzt geh! Und unterstehe dich, hinter mir herzukommen!“ Sein Finger wies in die Richtung, aus der Franz vor wenigen Augenblicken gekommen war. Dann gab er seinem Pferd die Sporen und im Nu war er fort.
Franz schaute ihm hinterher, bis er verschwunden war, dann fielen ihm die Schultern nach vorn und es brach ungehemmt aus ihm heraus. Laut schluchzend, zwischendurch aufheulend wie ein junger Hund schleppte er sich geradezu den Berg wieder hoch. Und erst als Lina ihn tröstend an sich gedrückt hatte, an das Kleid, aus dem immer noch die Angst hervor strömte, beruhigte er sich langsam. Als sie ihn am Brunnen abwusch, merkte er, dass er sich bei seinem Sturz Beine, Arme und das Kinn aufgeschlagen hatte. ...
„Das war einfach grausam!“ Franz schüttelte langsam den Kopf, „Anna hat damals wohl am meisten gelitten. Sie hat sofort sehr hohes Fieber bekommen und nichts mehr gegessen, tagelang nicht!“
Eine ganze Weile war es still! Nur das rauschende Atmen des Grases und der Bäume war zu hören.
Pater Gregor erhob sich mit einem Seufzer, lenkte für einen Augenblick die Aufmerksamkeit auf sich, besser: auf seinen Schatten. Übergroß von der Glut des Feuers an die Hauswand projiziert, bewegte er sich von ihnen fort.
Therese beugte sich etwas vor, schaute ihm nach bis zum Ende der Hauswand. Wortlos band er dort sein bereits zum Heimritt gesatteltes Pferd wieder los und brachte es in den Stall zurück.
„Was wohl aus Anna geworden ist?“ Immer noch schaute sie die Hauswand entlang, drehte sich erst um, als sie hörte, wie Franz nach einer ganzen Weile tief einatmete, um ihr zu antworten.
„Der Pater wusste, dass man sie zu den Zisterzienserinnen nach Landshut gebracht hatte. Sie war dort gut aufgehoben, und er hat dafür gesorgt, dass sie dort bleiben konnte.“ Er sah sie nicht an, sah zu Stefan, der, seinen Kopf auf beide Hände gestützt, Therese nicht aus den Augen ließ, und schweifte dann hinaus zur großen Wiese.
„Und?“ Als er sich ihr zuwandte, sie einen Augenblick nur ruhig ansah, wusste sie um die Antwort.
„Das Kloster ist 34 überfallen und geplündert worden und 35 hat die Pest dort gewütet. Der Pater ist später am Kloster gewesen. Er hat niemanden gefunden, der ihm sagen konnte, was aus Anna geworden ist. Vor drei Jahren bin ich selbst drüben gewesen; es gibt keine Spur von ihr.“ Er wandte sich wieder von ihr ab, „Tatsache ist, dass viele Nonnen des Klosters an der Pest gestorben sind – ebenso wie viele Menschen im Umland. Es tut mir leid, dass ich dir nichts anderes sagen kann.“ Ohne sich ihr zuzuwenden sagte er dies, blickte einfach weiter geradeaus, während sie ihn unbewegt ansah.
Stefan räusperte sich und stand unbeholfen auf von seinem wackeligen Holzklotz, um nach dem Feuer zu sehen.
„Wenn man sich vorstellt, dass das, was sie mit uns gemacht haben, fast normal ist in diesen Zeiten. Da draußen geschehen jeden Tag Dinge, die mag man gar nicht glauben, wenn man sie nicht erlebt hat!“
„Du hast sie erlebt?“
Gedankenverloren nickte sie vor sich hin, „Ja, so einige, Franz!“ Sie schaute den Funken nach, die wild aufwirbelten als Stefan einige Holzscheite auf die Glut schichtete. Unvermittelt dann: „Sei froh, dass du damals den Karren nicht mehr erreicht hast, es ist dir einiges erspart geblieben!“
„Auf der Fahrt? Warum?“ Er fragte ohne den Blick aus dem Feuer zu nehmen, wandte sich ihr nicht zu.
„Du hättest mit ansehen müssen, wie deine Mutter auf der ganzen Fahrt durch die Stadt beschimpft und sogar bespuckt wurde. Kannst du dich noch an den Schuhmacher Beuteler erinnern? – Der ist dem Wagen durch die ganze Stadt gefolgt, hat mich ausgelacht und beschimpft, ebenso wie die Wiesner! Alle ihre Kinder habe ich blitzsauber geholt, und dann rennt die keifend hinter dem Wagen her.“ Sie beugte sich rasch über den Tisch und nahm ein bereits abgebrochenes Stück Brot. Stefan hatte gerade die Hand danach ausgestreckt. Und während er sich mit dem anderen Arm durch das erhitzte Gesicht und über die tränenden Augen wischte, grabbelte er suchend auf dem Tisch herum, unterbrach jäh sein Wischen und Scheuern und blickte Therese im nächsten Augenblick schelmisch von unten herauf an. Die schob sich betont langsam eine kleine Ecke Brot in den Mund, lediglich in ihren Augenwinkeln blitzte es ein wenig. „Die Burschen des Ortes sind damals schreiend und pfeifend von der Altmühl her durch den ganzen Ort hinter und neben dem Karren hergelaufen. Es war, als hätte ich am Pranger gestanden – und ich hatte nichts getan.“
„Die Büttel, der Wallert und der andere, was haben die gemacht? Immerhin mussten die dich doch unversehrt zum Turm bringen. Die hätten doch nur schneller zu fahren brauchen.“
„Ich glaube, die haben das genossen! Gar nicht bewusst und ganz sicher auch, ohne sich abzusprechen. Sie haben es ganz einfach aus der Situation heraus genossen! Sind langsamer gefahren, damit die sonst so lieben Mitmenschen, die überall an der Straße und in den Hauseingängen standen und in den Fenstern und Luken lagen, sich an meiner Angst, an meinem Entsetzen weiden konnten. Ich wusste schon während dieser Fahrt genau, dass ich verloren war. Wer einmal so durch die Stadt gefahren worden ist, der gehört nicht mehr dazu, den kann man nicht mehr zurück unter die Menschen schicken. ...
Ein kleiner Junge, gerade so groß, dass er über die Wagenkante oberhalb des Rades schauen konnte, rannte an der Hand seiner Schwester neben dem Wagen her, die kleine Hand voller loser Steinchen. Als er in einem günstigen Moment nach ihr warf, trafen sie einige der Steinchen ins Gesicht, was mit lautem Johlen und Pfeifen bejubelt wurde.
Gleich darauf verließ der Karren durch das obere Tor die Stadt. Sie blickte auf die dicken Mauern, an denen sie vorbeifuhren, auf die zwei Frauen, die, mehrere Kinder eilig nachziehend, unbedingt gleichzeitig mit dem Karren das Tor passieren mussten. Und dann, als der Karren nach links schwenkte und sie sich vorsichtig umwandte, sah sie das Haus des Scharfrichters! Schräg gegenüber dem Stadttor lag es so, als wolle sein Bewohner stets sehen, wer da herangekarrt wurde. Schritt für Schritt zog das Pferd sie näher an das Haus heran, geriet dieses deutlicher in ihr Blickfeld. Sie kannte das Haus, war unzählige Male hier vorbei gegangen, heute wirkte es dunkel, bedrohlich ruhig, als würde es auf sie warten.
Ebenso der Platz, den sie überquerten. Er war ihr von unzähligen Gängen her nur zu bekannt. Von ihrem Sünderkarren herunter, angebunden und gedemütigt, fühlte sie sich jetzt fremd hier, erschauerte vor dem Turm, der allmählich grau und massig neben ihr auftauchte. Verstand auch nicht, warum all die Menschen dem Wagen ebenso gefolgt waren wie die Burschen, die sie den ganzen Weg durch die Stadt geärgert und gepeinigt hatten.
Als der Karren endlich direkt vor dem Turm anhielt, blickte sie wie ein gefangenes Tier unsicher und verängstigt herunter. Sah um sich herum hastende Bewegungen, sah die sich rasch bildende Runde. Sah endlich diese Menschen, die ihr alle so bekannt waren und die jetzt in einem schweigenden Kreis um den Karren neugierig hin und her schwankten. Schlagartig übertrug sich etwas auf sie, was sie nicht erklären konnte, aber sie spürte, dass eine gewisse Spannung in der Luft lag. Auf irgendetwas wartete diese Meute, irgendetwas sollte mit ihr geschehen.
Ihre Angst steigerte sich zur Panik, ließ sie herumfahren als sie spürte, dass sich jemand hinter ihr bewegte. Einer der Büttel war zu ihr nach hinten auf den Karren gestiegen und machte sich an ihren Füßen zu schaffen. Ein bulliger Kerl, auf dessen strohigen, roten Haare sie angewidert hinabsah. Ihr Blick hetzte zurück auf die Umgebenden, raste an den gespannten, geifernden Gesichtern entlang, die sie doch alle kannte und schrak zurück, als sich der Rothaarige vor ihr erhob: Sie schaute in ein verwüstetes und entstelltes Gesicht. Von der Nase bis zum Ohr, dort wo sich normalerweise der Jochbogen erhob, fehlte die linke Gesichtshälfte. Geblieben war unterhalb der Stirn eine einzige, flach zum Ohr hin fliehende Narbe.
„Runter!“ er wies mit dem Kinn auf die Wagenseite, die ihm gegenüber lag und auf der sie über das Rad hinunter steigen sollte. Der andere Büttel, etwas älter als der Narbige, saß noch immer wie teilnahmslos auf dem Bock, während sich der Soldat mit der Turmtür beschäftigte.
Verzweifelt versuchte sie diese winzige Chance, die nur sie als solche sah, zu nutzen. Spürte nicht, wie die Spannung der Umstehenden einem Höhepunkt zustrebte, kletterte ruhig über Rad und Radnarbe hinunter. Dann, mit beiden Füßen auf dem Boden, raffte sie hastig den Strick mit ihren auf dem Rücken gefesselten Händen – der Narbige stand immer noch auf dem Karren – und rannte einfach los, das Strickende hinter sich herziehend.
Blind rannte sie gegen die feixende, gaffende Meute an, hinter ihr sprang jemand plump auf den Boden, und vor ihr öffnete sich der Kreis für einen winzigen Durchschlupf, starrten ihr fiebrig glänzende Augen entgegen. Sie beugte sich vor, glaubte die Lücke schon erreicht zu haben, hindurch schlüpfen zu können, als sie hinter sich den älteren Büttel ächzen hörte: „Hier bleibst! Verdammte Hex!“ Ein fürchterlicher Ruck am Seil riss ihre Arme nach hinten, riss sie zu Boden und jagte ihr den ersten brennenden Schmerz in die Schultergelenke. Ihren eigenen Schrei nahm sie nicht wahr, weil sie im nächsten Augenblick roh und kraftvoll an den Haaren vom Boden hochgezogen wurde. Und während sie nun der eine Büttel wie eine Ziege unnachgiebig am Strick hinter sich herzog, zerrte der Narbige rüde an ihren Haaren, bog ihren Kopf weit in die Nacken.
Die Meute um sie herum hatte endlich ihr Schauspiel, johlte und klatschte. ...
Ich glaube, ich habe damals fortwährend geschrien „Helft mir doch!“ und „Warum hilft mir den keiner?“ Hatte im Kopf: Da war eine Lücke! Sie hätten dich durchgelassen!
Erst viele Jahre später habe ich verstanden, was da insgesamt – schon während der Fahrt durch den Ort – passiert ist: Es ging gar nicht um mich.“ Sie schob sich ein Stück Brot in den Mund, kaute ruhig und nachdenklich darauf herum. „Wer dort auf dem Wagen saß und nachher in den Turm gezerrt wurde, der stand für alle sichtbar außerhalb der Gemeinschaft, hatte keine Rechte mehr und war deshalb das Opfer aller. Ob derjenige überhaupt schuldig war oder nicht, niemanden interessierte das. Und deshalb hat mir auch niemand geholfen. Irgendwie ist es wie ein Spiel: Es reicht, dass dich jemand, der die Macht dazu hat, außerhalb des Kreises stellt. Sofort bist du aller Rechte beraubt und selbst deine Freunde demütigen dich mit Leidenschaft!“
Für einen langen Moment war es still, starrten sie sinnend in die Dunkelheit.
Pater Gregor löste sich von der Hauswand, an der er schon eine ganze Weile gelehnt hatte und goss sich bedächtig Obstwein aus dem Krug in seinen Becher „Wenn man bedenkt, dass sich dieses Schauspiel damals in wenigen Monaten fast dreißig Mal wiederholt hat, so könntet ihr wohl Recht haben.“ Einen kurzen Moment hielt er inne und sah einer Fledermaus hinterher, die in hektischem Zick-Zack-Flug dicht über ihm hinweg geflogen war. „Jedes Mal gab es solch einen miesen Umzug?“ Er hatte die Fledermaus aus den Augen verloren und drehte sich aus der Hüfte halb zu Franz herum: „Jedes Mal! Nur bei der Lisbeth war es wohl anders, die haben sie morgens ganz früh geholt. Die irre gewordene Lisbeth!“
Einen Schluck Wein aus seinem Becher trinkend, setzte er sich ihr gegenüber auf den dicken Holzklotz – etwas näher zum Feuer. „Allen Frauen, die in den Turm geworfen wurden, erging es so wie euch. Jedes Mal durchliefen sie den gleichen Spießrutenlauf. Nur leider hatte die Einkerkerung für alle diese Frauen einen anderen Ausgang, als das bei euch der Fall war.“
„Ja – ich hatte, Gott sei Dank, einen Schutzengel, mein lieber Pater.“ Sie nahm ihren Blick aus dem Feuer, wandte sich ihm fast ein wenig ruckartig zu und suchte gleichzeitig Rückhalt an der Hauswand, „Nur damals, am Turm, ahnte ich noch nichts von meinem Glück. Als die beiden Kerle mich wie ein Stück Vieh in den Turm zerrten, hatte ich mich bereits aufgegeben. ...
Der Narbige zog ihren Kopf so gefühllos und rücksichtslos nach hinten in den Nacken, dass ihr das Atmen schwer fiel. Sie verlor die Orientierung, wurde immer weiter gezogen und ehe sie sich versah, erschien dicht über ihrem Kopf das Mauerwerk und dann – hoch oben – Balken : Sie war im Turm. So, als hätte jemand den Docht einer Öllampe herunter gedreht ,wurde es unvermittelt dunkel um sie herum, vor ihr krachte es, und gleich darauf vernahm sie das rau schabende Geräusch, welches entsteht, wenn ein schwerer Riegel vorgeschoben wird. Man hatte sie gefangen und eingesperrt wie ein gefährliches Raubtier.
Als ihr das bewusst wurde, hatte sie der Narbige bereits losgelassen, entfernte sich von ihr. Willenlos ließ sie es geschehen, dass der andere Büttel sie am Strick zu sich heranzog. Sie konnte ihn nur schattenhaft erkennen, roch seinen sauer-faulen Atem, während er ihre Armfesseln löste und sie versuchte, das sie umgebende Dunkel zu durchdringen, irgendetwas zu erkennen. Die Hände waren frei! Sie zog sie nach vorn und hielt augenblicklich die Luft an: Ein stechender Schmerz in ihren Armgelenken ließ sie Augen und Zähne zusammenpressen, die Arme nur vorsichtig weiter nach vorn bewegen.
Zunächst blinzelnd dann allmählich deutlicher erkannte sie das unregelmäßige Gestein der Turmwand. Links, wenige Schritte von ihr entfernt nahm sie die Umrisse einer Tür wahr. Tief eingelassen in das Gestein der Turmmauer war die eigentliche Tür für sie unsichtbar.
Licht! Sie drehte sich, suchte das Turmrund ab, suchte zu erfassen, zu erkennen und traf doch nur wieder auf den Narbigen. Schon halb umgewandt, damit beschäftigt, den Docht einer Öllampe einzustellen, hielt er diese dicht vor sein eines verbliebenes Auge, eine vom zuckenden und flackernden Lampenlicht narbig verzerrte Fratze. Sie zog unwillkürlich die Schultern ein wenig hoch, zog sich zusammen, blickte wider Willen unverwandt in das entstellte Gesicht, bis ein raues „Komm her!“ ihre Erstarrung löste.
Der Narbige wandte sich ihr zu, hielt die Lampe in der Rechten, so dass nur seine unversehrte Gesichtshälfte beleuchtet wurde. Zaudernd setzte sie Schritt vor Schritt, angstvoll zitternd, bebend und konnte ihren Blick doch nicht von dem Gesicht abwenden. Sein Kopf ruckte zur Seite, das heißt mehr auf den Boden in dem Bereich hinter ihm. Wieder kam sein hartes, keine Verzögerung duldendes „Runter!“ Verwirrt schaute sie abwechselnd in sein Gesicht und an ihm vorbei, verstand nicht, musste den Hals lang machen und erkannte dann undeutlich eine große, aufgeklappte Bodenluke. Sie machte noch einen Schritt, schaute unverwandt in die dunkle Öffnung, in der sie die erste Stufe einer breiten Holztreppe erkannte. Panik stieg in ihr auf, schlagartig, ließ ihren Atem fliegen. Sie war stehen geblieben – unbewusst. Jäh fuhr sein Oberkörper vor, ließ ihr keine Zeit für eine eventuelle Fluchtbewegung. Wie eine eiserne Klammer umfasste seine Hand ihren Arm, löste sofort den stechenden Schmerz in den Schultergelenken aus, schob sie kurzerhand zur Luke und die Treppenstufen hinunter in eine undurchdringliche Dunkelheit hinein.
Suchend, überaus vorsichtig stieg sie erst eine, dann noch zwei-drei Stufen abwärts, die Angst sprichwörtlich im Nacken. Blieb dann – das kalte, raue Gestein der Turmwand ertastend – stehen: Vor ihr verschwand die Treppe wie in einem dunklen Gewässer. Zunächst noch gehalten am grauen Gestein, schien sie bald im Nichts zu versinken. Das Turminnere ein schwarzes Loch, aus dem es kalt herauf wehte. Wildes Entsetzen sprang sie an! Alles in ihr wehrte sich dagegen, weiter in diese undurchsichtige, kalte Finsternis hinabzusteigen. Mit beiden Händen suchte sie Halt, griff ins Leere, setzte sich rasch, um nicht zu stürzen, wurde unnachgiebig wieder hochgezerrt und weitergeschoben.
Unverhofft drangen Geräusche aus der Tiefe herauf, verwirrten sie, ließen sie einen Moment verharren; der Narbige schob sie weiter! Nicht weit unter ihr, so schien es, war jemand in der Dunkelheit, hantierte dort herum, so dass sich seine Geräusche dumpf hallend mit ihren Geräuschen im Turminneren vereinten.
Etwas zaghaft bewegte sich dann ein Lichtschimmer über das graue Gestein, wurde fast von diesem verschluckt, sprang unruhig hierhin, dorthin, verdünnte zunehmend die Dunkelheit unter ihr und leuchtete dann schließlich klar von unten herauf. Dort, wo die Treppe endlich den sicheren Boden berührte, erkannte sie jetzt den anderen Büttel, den Älteren. Eine Laterne hochhaltend blickte er ihnen vom Grund des Turmes entgegen, regungslos, teilnahmslos, bis sie ihn, nun rascher abwärts steigend, fast erreicht hatten. Als er sich wortlos umdrehte, sich mit seiner Laterne wieder entfernte, spürte sie, wie angeflogen, die Kälte, die sie dort unten umgab. Kälte, Feuchtigkeit und ein penetranter Gestank nach Abfall, Dreck, Ungeziefer – und Mensch.
Wieder zaghafter nahm sie die letzten Stufen, spürte dann endlich den Lehmboden unter den Füßen und folgte, vorwärtsgeschoben, dem sich entfernenden Licht.
Richtungsweisend wie ein trügerisches Strandfeuer leuchtete es ihr aus einem Gang entgegen, der ziemlich breit und abgerundet wie eine Höhle aus dem Turm hinauszuführen schien. Der Narbige schob sie weiter und im schwachen Licht erkannte sie rechts und links an den Seiten des Ganges Holzverschläge, den ihr bekannten Ziegenställen nicht unähnlich.
Sie stockte, stemmte sich gegen die drängende Hand und wurde einfach weiter in den Gang hineingeschoben, musste dort, zwischen den Verschlägen, den Kopf einziehen, um nicht an die niedrige Gewölbedecke anzustoßen. Sie streckte vorsichtig die Hände zur Seite, tastete sich im Dämmerlicht rechts und links an den Verschlägen entlang. Der Narbige schob sie weiter, gab ihr keine Möglichkeit, sich auf die Enge im Gang einzustellen, schob sie vier-fünf Schritte in den Gang hinein. Vor ihr stand der andere Büttel, ebenfalls vornüber gebeugt, die Laterne in der Linken. Sie konnte nicht weiter, berührte mit dem Kopf die Decke, zuckte vor – im selben Moment stieß sie der Narbige durch eine schmale Öffnung in den Verschlag auf der Linken. Sie stolperte hinein, schlug mit dem Kopf an die Decke, die sich, der Gewölberundung folgend, allmählich wieder zum Boden neigte, vor ihr eine flache Kiste mit Stroh.
Sie verstand, fuhr herum und konnte gerade noch eine zusammen geknüllte Decke auffangen, die ihr der Narbige zuwarf. In der Öffnung erschien der Ältere, wies mit der Laterne in der Hand auf einen Krug am Boden: „Wasser!“, wies dann seitwärts, die grobe Holzwand entlang auf einen Eimer am Ende des Verschlages: „Wenn´s musst!“ Teilnahmslos trat er dann zurück, verschloss das stabile Gatter und schob ruckend einen schwergängigen Riegel vor.
Unfähig zu jeglicher Reaktion, die Decke fest gegen ihren Leib gepresst, folgte Therese den beiden bei ihren wortlosen Verrichtungen. Sah, bebend und kurzatmig, wie sie sich entfernten, wie sich das Licht immer weiter von ihr entfernte, wie die Finsternis – rasch wie ein Luftzug – aus dem Turm zurück in den Gang gezogen kam. Hörte noch ihre schweren Schritte, die sich auf der Treppe polternd nach oben entfernten und spürte dann, wie alles in ihr einem Erdrutsch gleich zusammenbrach. Ihr Kopf fiel nach hinten. Müde prallten ihre Augen an der Decke dicht über ihr ab, durchmaßen eher kraftlos den finsteren Verschlag, glitten verzweifelt über die rohe Holzwand. Alle Drangsal, alle Verzweiflung, die sich als großer, ihr Inneres ganz ausfüllender Schmerz angesammelt hatten, brachen nun mit Schluchzen, Heulen, Winseln als gewaltiger Ausbruch aus ihr hervor. Zwischendurch fuhr sie herum, riss und rüttelte wild an den rauen Holzstäben des Gatters. Lehnte dann wieder mit Rücken und Kopf am Gatter, willenlos treibend im Strom ihrer Verzweiflung.
Irgendwann ließ sie sich mit nicht enden wollendem Tränenfluss auf den klobigen Hocker vor der Strohkiste fallen, umschlang ihren Körper mit beiden Armen wie im Schmerz, sehnte in ihrer totalen Verlassenheit Mann und Kinder und Lina herbei, bettelte darum wie ein kleines Kind.
Jäh fuhr sie in die Höhe, saß plötzlich stockgerade auf ihrem Hocker, vergaß für einen Moment das Atmen und krallte ihre Hände in Kleid und Oberschenkel. Von der anderen Seite des Ganges, nur drei Schritte von ihr entfernt, schaute sie jemand an. Schaute ebenfalls durch die Stäbe eines Gatters, schweigend und unbeweglich. Einen Moment lang geschah gar nichts. Vom Schreck wie gelähmt drängte sie ihren Blick durch den Tränenvorhang, die Gatterstäbe, das schwache Licht auf dem Gang in das Gesicht auf der anderen Seite. Es war ein müdes Gesicht, das Gesicht einer alten Frau, die sehr weit unten durch das Gatter guckte. Offensichtlich saß oder lag sie auf dem Boden.
Lange, graue Haare zu Strähnen verklebt, fielen dicht am Kopf herunter, rahmten ein ausgemergeltes, faltiges Gesicht ein. Wie ein gefangenes, eingebrochenes Tier saß sie da hinter den Stäben, schaute müde und kraftlos zu ihr herüber.
Langsam und vorsichtig, so als hätte sie Angst, das Wesen ihr gegenüber zu erschrecken, erhob sich Therese von ihrem Hocker, wischte sich mit der flachen Hand, ohne den Blick abzuwenden, die Tränen aus dem Gesicht und trat dicht an die Stäbe, um besser sehen zu können. „Wer bist du?“ in dem Gewölbe klang ihre Stimme dumpf, blieb ohne Antwort. Das Wesen auf der anderen Seite schaute sie regungslos an. „Bitte – sag etwas.“ Nichts! „Kannst du mich verstehen?“
Die müden Augen schlossen sich einen Moment, „Ich kann dich verstehen.“ Flüssig, aber langsam kamen die Worte herüber, getragen von einer Stimme, die vertrocknet krächzte.
„Was ist mit dir?“ Therese versuchte, durch die Stäbe etwas zu erkennen, musste eine Weile auf die Antwort warten. Deutlich sah sie, wie es in dem Gesicht arbeitete, wie der Mund aufging, sich wieder schloss, so als brächte die Ärmste nicht heraus, was sie schon auf der Zunge hatte. Dann, als müsse es einfach heraus: „Sie - sie haben mich gestern verhört!“
„Der Pocher?“ fast atemlos schoss sie diese Frage ab und erschrak selbst über ihre ungewollt laute Stimme.
„Der Pocher und...“ sie kniff die Augen zu, verzog das Gesicht, als plage sie brennender Schmerz. „So etwas dürfte der Herrgott nicht zulassen!“ Aufstöhnend verschwand das Gesicht langsam nach unten.
„Bist du aus Eichstätt?“ Sie hatte lauter gerufen, wollte das Gesicht aufhalten, hörte ihre Worte als dumpfes Echo. Die Angst war wieder da. Sie zitterte. Wollte noch reden. Nur nicht schweigen und grübeln!
„Ich bin – die Raußbacher!“ Die Antwort kam von ganz unten, kam gequält mit einer langen Pause.
„Du bist die Raußbacher? Mein Gott!“ Bestürzt starrte Therese in den anderen Verschlag hinüber, konnte jedoch nichts mehr erkennen.
Sie kannte die Raußbacher gut, die unten am Fluss eine alte Kate bewohnte. Jeder kannte die alte Raußbacher, die etwas derb im Ton, sonst aber sehr gutherzig war und gefärbte Garne sowie Wässerchen gegen Mundfäule verkaufte. Diese hier war kaum noch als Raußbacher zu erkennen.
Therese zitterte, spürte plötzlich, dass sie einer dringenden Notwendigkeit gehorchen musste. Dabei: „Was haben sie mit dir gemacht?“ Sie erhielt keine Antwort, kein Laut unterbrach die Stille. „Sag doch etwas!“ Vergebens! Das Schweigen drückte sie wie etwas Großes, Schweres aber Unbekanntes nieder auf den Hocker. Gedankenverloren starrte sie gegen die dunkle Holzwand, merkte nicht wie Stunde um Stunde verrann.
Ein Geräusch ließ sie hochfahren.
Irgendwann in der Nacht hatte sie sich in die stinkende Decke gehüllt, in die feuchte Strohkiste gelegt und war eingeschlafen. Jetzt hörte sie deutlich Schritte auf der Treppe, rasche Schritte, keine Stiefel, aber etwas klapperte. Ein Lichtschimmer fiel in den Gang, huschte über das raue Holzgatter auf der anderen Seite des Ganges, sprang dann über die ungleichmäßigen Steine der Gewölbedecke, sprang zurück, fiel mal auf den buckeligen Lehmboden, wurde kräftiger und stand dann endlich still, aber vor dem Gang. Therese zwängte sich ganz in die Ecke zwischen Holzwand und Gatter, versuchte verzweifelt die Quelle des Lichtes zu erkennen, aber die Türhölzer versperrten ihr die Sicht. Unvermittelt begann das Licht wieder zu wandern, flackerte in den Gang hinein, zog mit dem Schein hundsgemeine Hoffnung hinter sich her. Dann kam sie herangewatschelt. Therese erkannte sie sofort am Gang und an den Körperumrissen, die sich deutlich vor dem Licht abhoben: die Jaschke! Klein, aber überaus füllig, schlampig und zänkisch, so kannte sie wohl jeder in der Stadt. Sie blieb am Verschlag gegenüber stehen, schaute kurz suchend hinein und öffnete dann dicht über dem Boden eine Klappe, wobei sie sich, die Füße auseinandergestellt, vornüberbeugen musste. Ihr Kittel rutschte um einiges nach oben, gab den Blick frei auf ein paar kräftige, weiße Waden und deutlich schmuddelige Fesseln und Füße. Dick aufgequollen spannten sie die Riemen der ausgetretenen Latschen.
„Den Eima, Raußbacha!“ Ihre Stimme klang stumpf, gewöhnlich, als wäre sie ihr zu schwer! Einen Augenblick blieb sie so vornüber gebeugt stehen, wartete. Die Öffnung in der Verschlagwand blieb leer, kein Lebenszeichen auf der anderen Seite des Verschlages. „Dann eben nicht!“ Sie schob eine Holzschüssel durch die Luke, schloss diese und watschelte zurück zum Licht, ohne zur Seite zu sehen.
Gleich darauf erschien sie wieder im Gang, verdrängte für einen Moment das Licht, blieb vor Therese stehen, von ihr getrennt durch das Holzgitter. Die eine Hand auf die ausladende Hüfte gestützt, in der anderen eine Holzschüssel und ein Brotkanten, betrachtete sie Therese aus ihren kleinen, viel zu weit auseinander stehenden Mausaugen. Wie dunkle Löcher wirkten sie in dem breiten, flächigen Gesicht, blickten ruhig, abschätzend von oben nach unten.
Langsam, etwa so wie eine zähe Flüssigkeit verläuft, verzog sich ihr Gesicht zu einem schmierigen Grinsen, „Guck mal an! Das ist mal was anderes als auf´m Köblerhof – oder?“ und etwas leiser, „Aber brauchst ja nicht lange hier zu bleiben!“ Ihr Grinsen war unerträglich gemein.
„Jaschke, du kennst mich! Ich habe deiner Schwester bei ihren Kindern geholfen! Du weißt, dass ich nichts verbrochen habe. Jaschke lass mich raus hier! Hörst du?“ Therese stand dicht am Gatter, streckte eine Hand durch die Stäbe – bittend.
Die Jaschke verlagerte ihr Gewicht etwas rückenlastig. Das Grinsen wurde noch um eine Spur breiter, niederträchtiger „So ist´s recht: Bettle ruhig, solange du´s noch kannst! – Einen Teufel werd ich tun!“ Bückte sich, öffnete die Klappe, die Therese noch gar nicht wahrgenommen hatte, und schob die Holzschüssel mitsamt Brot in den Verschlag. Klappte die Luke mit einem Fußtritt wieder zu und verschwand zum Licht, hocherhobenen Hauptes, mit wackelnden Hüften.
Einen Moment später war es wieder finster. Auf der Treppe quälte sich die Jaschke nach oben.
Therese schaute in den Verschlag auf der anderen Seite des Ganges, horchte. Es war absolut still!
„Raußbacher!“ Sie presste ihr Gesicht nah an das Holzgitter der Tür, horchte angestrengt. Es blieb still, keine Reaktion. Und dann war es das Entsetzen, das sie packte, das sie am Gatter rütteln ließ, sie so laut rufen ließ, dass sie vom Widerhall aus dem Turminneren zurückfuhr: „Raußbacher sag was!“ Stille! Dann, endlich, ein mattes Stöhnen. Stroh raschelte und sie konnte auf der anderen Seite eine Bewegung erkennen. „Raußbacher komm hoch, du musst was essen!“ gespannt schaute sie hinüber, angelte sich die eigene Holzschüssel, die noch unberührt auf der Erde stand, roch daran: Erbsebrei, das Brot lag darin, weichte langsam auf. Unendlich schwerfällig kam auf der anderen Seite der Kopf hoch und wieder schauten sie die Augen nur kraftlos und unverwandt an.
Therese schauderte, hielt die Holzschüssel zitternd mit beiden Händen, „Raußbacher, lass mich nicht alleine hier unten! Iss was, sonst schaffen wir es nicht!“ Die Alte auf der anderen Seite schloss müde die Augen, schüttelte schwach den Kopf, um gleich darauf mit weit aufgerissenen Augen in Richtung Turm zu schielen. Ungeheure Angst verzerrte das bisher so leblos wirkende Gesicht, presste tiefe Falten in die Stirn, zerrte den Mund weit auf.
Mit Grausen verfolgte Therese die Veränderung im Gesicht der anderen, stand wie versteinert, hörte die schweren Schritte auf der Treppe, auf dem Gang, vermochte kaum noch die Schüssel zu halten.
Wieder war es der Ältere, der den Verschlag auf der anderen Seite öffnete, gleichgültig, fast schläfrig. Der Narbige zwängte sich durch die Tür hinein in den Verschlag, bückte sich nach rechts und zog dann etwas Schweres vom Boden hoch. Grässliche, nie zuvor gehörte menschliche Laute, die vermutlich als verzweifelte Schreie gesandt wurden, aber eher wie unendlich in die Länge gezogenes Ächzen klangen, drohten Therese zu zerreißen, ließen sie die Schüssel in ihren Händen vergessen, um sich die Ohren zuzuhalten, während der Erbsebrei unter der Tür her auf den Gang kroch.
Langsam, geradezu vorsichtig zog der Narbige die Raußbacher auf den Gang, versuchte sie dort aufzurichten. Therese presste sich kerzengerade gegen die Holzwand im Rücken, schloss die Augen, wandte den Kopf hin und her und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit: Beide Hände der Raußbacher waren wohl zu doppelter Größe angeschwollen, schauten unförmig als dunkle, verkrustete Klumpen aus den Ärmeln ihres dünnen Leinengewandes. Sie sackte zusammen, wimmernd, das Gesicht qualvoll verzerrt. Der Narbige hielt sie fest, griff ihr unter beiden Armen durch und hob sie etwas hoch, so dass der Ältere ihre Knie greifen konnte. Als der sie anhob rutschte der Leinenkittel hoch. Therese sah das Bein, schaute rasch zur Seite, wollte nicht hinsehen und konnte doch nicht anders: Ein fast schwarzes Bein ragte unter dem Kittel hervor. Angeschwollen, als wolle es gleich platzen, ließ es sich nicht mehr knicken. Ragte dem Alten unter dem Arm durch. Sie schleppten sie aus dem Gang, als wäre sie schon tot.
Therese suchte den Eimer, musste sich übergeben, schleppte sich auf allen Vieren zur Strohkiste, ließ sich einfach hineinfallen, starrte mit weit geöffneten Augen an die Gewölbedecke, unfähig, zu weinen, zu denken, eigentlich zu allem.
Nie zuvor hatte sie so etwas gesehen. Sie wagte nicht weiter zu denken, schaute nur nach oben, immer nach oben, während sie am ganzen Körper zitterte. ...
Mit lautem, trockenen Knacken flog ein großer Funken aus dem Feuer in die Stille, ließ sie zusammenzucken. Franz drückte sich langsam von der Bank hoch, ging um den Tisch herum und blieb dann ein wenig abseits stehen, die Arme vor der Brust verschränkt, mit dem Rücken zur Hauswand.
„Die Raußbacher wurde damals am Tag nach eurer Flucht oben auf dem Berg verbrannt!“ Sinnend erinnerte sich der Pater, schaute dabei abwesend auf den Tisch.
„Davon wird sie nichts mehr gemerkt haben!“ Es war nur eine leise Bewegung, mit der sie den Kopf schüttelte.
„Wusstet ihr, dass es im Turm so zugeht? Wusstet ihr von diesen Dingen?“ Entsetzen und Fassungslosigkeit schwangen mit in dieser Frage, die Franz in die Dunkelheit hinaussprach.
Der Pater vergewisserte sich nicht; er wusste, dass er gemeint war, „Franz, heute weiß ich es, damals wusste ich es nicht! Aber ich hätte es wissen können, es war gängige Praxis, so zu verfahren. Die Richter und Scharfrichter handelten tatsächlich nach den entsprechenden Reichsgesetzen und nach dem ´Malleus maleficarum´. Als angehender Jesuit hätte ich mich damals schon damit beschäftigen können. Ich habe es erst getan, nachdem ich selbst betroffen war – leider!“
Franz wandte sich ihm zu, indem er über die Schulter auf den Sitzenden hinunterschaute, „Was ist dieser „Malleus ...?“ Aufschauend der Pater „malleficarum“!
Therese führte kurzerhand weiter, was der Pater so vielleicht doch nicht formuliert hätte: „Es ist der „Hexenhammer“, das verfluchte Erklärungs- und Regelwerk, in dem die Kirche festgelegt hat, woran Zauber und Hexerei zu erkennen sind. Es beschreibt genau, wie man ihnen beikommen kann und mit welchen Mittel vor allem die Inquisition diese bekämpfen soll. Ein schauderhaftes Werk. Das sollte unbedingt verbrannt werden!“
Es dauerte eine ganze Weile, ehe der Pater sich vorsichtig zu einer Entgegnung durchrang „Ihr solltet nicht so hart mit der Kirche ins Gericht gehen! Bei all den Umwälzungen und Verwirrungen des letzten Jahrhunderts musste sie etwas tun. Und wer will sagen… Bitte lasst mich ausreden!“ Er hob beschwichtigend seine Hand, stoppte so Thereses sehr wahrscheinliche Entrüstung, „Wer will sagen, ob nicht doch der Böse hier und da seine Hand im Spiel hat, um Gottes Kirche zu vernichten. Ob er sich dabei nicht doch braver, gottesfürchtiger Menschen bedient. Und wenn das so ist – wie soll die Kirche ihm dann beikommen, wenn nicht über diese Menschen. Es gibt den Satan! Das steht außer Frage!“
„Mein lieber Pater!“ Selbst das schwache Licht verbarg Thereses Erregung nicht. Bis auf die äußerste Kante der Bank war sie vorgerutscht, stützte sich vornüber gebeugt mit beiden Händen auf dem Tisch ab, und wie schon einmal am Nachmittag sprühten ihre Augen Funken, als wollte sie die Wald anzünden. Ihr vollkommen zugewandt, entgeistert, mit geöffnetem Mund schaute Franz sie an, erkannte sie für einen Augenblick nicht!
„Was redet ihr da? Wenn ihr die Umwälzungen in der Kirche meint, so lagen und liegen die Ursachen doch in erster Linie in der Kirche selbst begründet. Hätte sie all diejenigen auf die Scheiterhaufen gebunden, die mit großem Ernst und unnachsichtig vom Volk den letzten Groschen, Kasteiung und größte Gottesfurcht verlangten, selbst aber in einem Übermaße Schlemmerei und Hurerei betrieben, die Scheiterhaufen hätten ein Jahrhundert gebrannt. Danach hätte die Kirche ihren Frieden gehabt. Der „Böse“, von dem ihr redet, der sucht sich für sein Werk sicher nicht die alten, wirklich gottesfürchtigen Weiber wie etwa die Raußbacher oder die Lisbeth, das glaubt ihr doch selbst nicht! Dessen Helfer findet die Inquisition am ehesten hinter den verschlossenen Klostertoren und den Toren der Bischofpaläste, hinter denen auf Kosten der Armen geprasst und geschwelgt wird und wo am wenigsten Gottesfurcht herrscht. Dort müsste sie suchen, nicht bei den gichtgeplagten alten Weibern. So! Und dann… Ich bin noch nicht fertig, lasst jetzt mich ausreden!“
Pater Gregor, der sich mit gequältem Gesicht vorgebeugt und zu einer Entgegnung angesetzt hatte, fuhr geradezu verunsichert ein Stück zurück.
„Noch etwas: Wo gibt es das, dass jemand, der einer Schuld bezichtigt wird, nur auf Grund der Beschuldigung selbst und ohne jede Möglichkeit der Verteidigung zu Tode gequält werden kann? Ihr habt es selbst in meinem Prozess erlebt: Ich war schon verurteilt bevor der Prozess überhaupt begann.“ Sie setzte sich wieder zurück an die Wand, verschränkte die Arme vor der Brust und schaute den Pater mit leicht schräg gelegtem Kopf an. Immer noch glitzerte es in ihren Augen.
Einen Moment sagte niemand etwas.