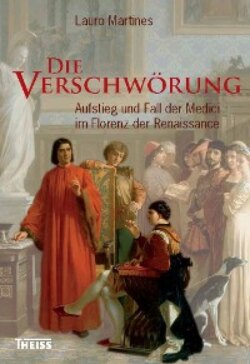Читать книгу Die Verschwörung - Lauro Martines - Страница 12
Ein Zeitalter der Verschwörungen
ОглавлениеWar die Romagna ein fruchtbarer Boden für Söldner und Verschwörer, so stand ihr der Rest Italiens in puncto Gefährlichkeit kaum nach. Politische Gewalt pflanzte sich häufig fort, insbesondere in Regionen und Städten, deren Herrscher nicht fest im Sattel saßen. Kein Geringerer als Machiavelli hat dies aufgezeigt. Das Komplott gegen die Medici ereignete sich nur sechzehn Monate nach der Ermordung des Herzogs von Mailand (Dezember 1476) in einer Ära, die, angefangen mit der römischen Verschwörung des Stefano Porcari (1452/53), auch „das Zeitalter der Verschwörungen“ genannt wird.12
Abb. 2 Piero del Pollaiuolo, Galeazzo Maria Sforza
Verglichen mit dem Mailänder Mord war der blutige Anschlag auf Lorenzo und Giuliano de’ Medici in Florenz, das – zumindest nominell – nach wie vor Republik war, ein fraglos schwierigeres Unterfangen. Beide Umsturzversuche waren republikanisch motiviert und spielten sich an religiösen Schauplätzen ab, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass sich die florentinischen Verschwörer der Folgen des Mailänder „Tyrannenmordes“ bewusst waren. Der Zusammenhang zwischen den beiden Verschwörungen war fast zu offensichtlich, um von Zeitgenossen besonders hervorgehoben zu werden, zumal der ermordete Herr von Mailand, Galeazzo Maria (Abb. 2), der Sohn des großen Generals Francesco Sforza war, der Cosimo de’ Medici, also Lorenzos Großvater, geholfen hatte, seine Machtposition in Florenz zu festigen.
Die Ereignisse in Mailand mögen als Indiz für die aufgestaute Wut gelten, deren Ursachen in den autoritären Regierungen im Italien der Renaissancezeit zu suchen sind, machen aber interessanterweise gleichzeitig auf die Tatsache aufmerksam, dass die meisten örtlichen Edelleute bis ins 16. Jahrhundert hinein praktisch ungehindert Zugang zum jeweiligen Herrn der Stadt hatten. Hier die Fakten des Mailänder Falles: Kurz vor Beginn des Hochamts am 26. Dezember 1476 wurde der Herzog von Mailand von drei Männern ermordet: Giovanni Andrea Lampugnani, Gerolamo Olgiati und Carlo Visconti. Jeder der drei hatte seine eigenen Gründe, Galeazzo Maria Sforza, dessen Niedertracht und barbarische Grausamkeit selbst der eigene Vater beklagte, den Dolch ins Herz zu stoßen. Würde zu seinen Gunsten sprechen, dass ein Mann – Galeazzo Maria –, der keine Ausgaben scheute, der die Musik liebte und die besten Musiker seiner Zeit an seinen Hof holte, doch wohl unmöglich ein Monster gewesen sein kann? Nein. Auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt, so hielt sich doch hartnäckig das Gerücht, er habe seine Mutter vergiftet – dergestalt also war sein Ruf. Berichte enthüllen, dass er Mädchen und Frauen kaufte, um seine Lust zu befriedigen (violavit virgines; aliorum uxores accepit), und sie danach an seine Höflinge weiterreichte. Ein Geistlicher, der ganz unschuldig vorhersagte, dem Herzog wäre nur eine kurze Regierungszeit vergönnt, wurde zum Hungertod verurteilt. Bei anderer Gelegenheit ließ der Herzog, von krankhafter Eifersucht geplagt, einem gewissen Pietro da Castello beide Hände abhacken. Ein anderer Mann, Pietro Drago, wurde auf sein Geheiß lebendigen Leibes an einen Sarg genagelt, und auf seinen Befehl hin brachten seine Scharfrichter einen Wilderer um, indem sie ihn zwangen, einen ganzen Hasen samt Fell zu schlucken.13
Dem Usus der Zeit entsprechend hatte Galeazzo Maria als Angehöriger der Oberschicht Unterricht in Latein erhalten und war auch mit den lateinischen Klassikern vertraut. Doch führte diese Begegnung mit dem „Humanismus“ – wie ein solches Studium gemeinhin genannt wurde – bei ihm nicht zu einer „humaneren“ Denkweise. Aus nahe liegenden Gründen also entsandte seine Witwe, Bona von Savoyen, etwa eine Woche nach seiner Ermordung ein dringendes Schreiben an einen Kontaktmann in Rom, den Kanonikus Celso de Maffeis, in dem sie die Sünden des Herzogs auflistete (Raub, Gewalttätigkeit, Ungerechtigkeit, Fleischeslust, Simonie) und Sorge über den Zustand seiner unsterblichen Seele zum Ausdruck brachte. Da sie bereits andere Theologen konsultiert hatte, drängte sie nun Maffeis, bei Papst Sixtus IV. einen vollständigen Erlass der Sünden für ihren Gatten zu erwirken – im Gegenzug für fürstliche Spenden an kirchliche Institutionen, Wohltätigkeiten für Mädchen ohne Mitgift und andere Arten materieller Zuwendungen. Darüber hinaus gab sie vor, ihr Gatte hätte bereits angefangen, Bußfertigkeit zu zeigen, doch habe seine brutale Ermordung alle weiteren Bemühungen in dieser Richtung vereitelt.
Werfen wir nun einen Blick auf die Verschwörer.
Carlo Visconti beteiligte sich an dem Komplott zur Ermordung Galeazzo Marias aus Gründen der Familienehre. Es scheint, dass der lasterhafte Herzog die Schwester des Regierungssekretärs am mailändischen Gerichtshof entjungfert hatte. Ebenso soll der Herzog (so wenigstens ging das Gerücht) ein unsittliches Interesse an der Ehefrau des Giovanni Andrea Lampugnani bekundet haben, wenngleich es dafür keine weiteren Beweise gibt. Giovanni Andrea, der hinkende und leicht aufbrausende Anführer der Verschwörung, entstammte einer alten mailändischen Adelsfamilie von Juristen und hohen Regierungsbeamten. Gelegentlich hatte er für den Herzog den einen oder anderen Auftrag erledigt und daher freien Zutritt zum Hofe. Seine Mordgelüste gingen wohl in erster Linie auf eine heftige Auseinandersetzung mit dem Bischof von Como zurück. Zankapfel war ein ertragreiches Stück Land, das der vormalige Abt der alten Abtei Morimondo den Brüdern Lampugnani verpachtet hatte. Als Morimondo plötzlich in den Besitz von Branda da Castiglione, dem neuen Bischof von Como, überging, erkannte dieser hohe Geistliche – ein für seine Verschwendungssucht berüchtigter, aber mächtiger Mann an Galeazzo Marias Hof – angeblich den Pachtvertrag nicht an, und die Brüder wurden aus den betreffenden Ländereien regelrecht hinausgejagt. Trotz flehentlicher Bitten Lampugnanis weigerte sich der Herzog einzuschreiten oder den Fall auch nur vor einen ordentlichen Untersuchungsausschuss zu bringen. Daraufhin schlug Giovanni Andreas Ärger in kriminelle Wut um.
Der jüngste der Mörder, der gerade dreiundzwanzigjährige Gerolamo Olgiati, scheint aus rein idealistischen Motiven gehandelt zu haben. Auch er entstammte einer angesehenen Familie und hatte unter dem großen bolognesischen Humanisten Cola Montano die Geschichte des republikanischen Rom studiert. Die Lektüre von Sallusts Die Verschwörung des Catilina hatte in dem jungen Olgiati den Wunsch nach Ruhm sowie das Verlangen geweckt, seine patria zu befreien, ein Traum, der nach einem Tyrannenmord verlangte. Darüber hinaus wurden die Verschwörer wohl auch von der noch frischen Erinnerung an die Ambrosianische Republik getrieben, die drei Jahre lang (1447–50) dafür gekämpft hatte, die kommunalen Freiheiten des 13. Jahrhunderts wiederaufleben zu lassen.
Mit Galeazzo Marias Gewohnheiten vertraut, beschlossen die Verschwörer, am Tag des Märtyrers Stefano zuzuschlagen, in der nach diesem benannten Kirche, und zwar am 26. Dezember 1478, einem Donnerstag. Dort trafen sie sich vor der Messe und erflehten den Schutz des Heiligen für ihr Vorhaben. Giovanni Andrea fungierte als Vorbeter, und die beiden anderen sprachen seine Worte nach. Einem Bericht zufolge baten sie auch darum, dass der Heilige Verständnis dafür aufbringen möge, dass in seiner Kirche Blut vergossen werden würde – schließlich geschehe dies ja zum Wohle der Stadt Mailand und ihrer Bevölkerung.
Der 26. Dezember dämmerte mit bitterer Kälte herauf, und der Herzog war ausgesprochen unruhig, weil er – wie es in den Chroniken solcher Begebenheiten häufig heißt – von einer unguten Vorahnung geplagt wurde. Bis zur buchstäblich letzten Minute soll er Bedenken geäußert haben, dem Gottesdienst in Santo Stefano beizuwohnen, und hätte die Messe wohl lieber in seinem Stadtschloss (castello) gehört. Doch sein Kaplan und sein Chor befanden sich bereits auf dem Weg zur Kirche, und der Bischof von Como war aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, die Messe zu lesen. Wie zu Weihnachten und anderen hohen Feiertagen üblich, hatten sich eine Reihe hoher Adliger und Gesandter bei Hofe eingefunden, und die meisten hätten es, schon allein der eisigen Kälte wegen, wohl vorgezogen, im Castello zu bleiben. Da setzte der Herzog der Zauderei ein Ende. Er verließ seine Gemächer, nahm die Gesandten von Ferrara und Mantua beim Arm und verließ mit ihnen gemeinsam das Castello, während der Rest des Hofes folgte. Draußen bestieg man hastig die bereitstehenden Pferde und ritt die kurze Strecke zur Kirche Santo Stefano, in der sich bereits Edelleute und niederes Volk drängten. Auch mehrere der verheirateten Mätressen des Herzogs waren, wohl auf sein Geheiß hin, anwesend. Aus einem Gefühl des Anstands heraus sowie um einen Skandal zu vermeiden, nannte der Historiker Corio, selbst Augenzeuge, diese Damen jedoch nicht einzeln mit Namen.
Olgiati, Visconti und Giovanni Andrea, jeder mit einem Kettenhemd unter der Kleidung, standen um einen legendenumwobenen Stein inmitten der Kirche. Als der Herzog, den Bischof von Como unmittelbar hinter sich, diese Stelle erreichte, traten die drei Männer vor, und Giovanni Andrea sank vor dem überraschten Sforza auf die Knie. Es folgte ein kurzer Wortwechsel und dann stach Andrea den Herzog zuerst in den Unterleib und dann in die Brust. Sekunden später stießen ihm auch Olgiati und Visconti, gefolgt von Giovanni Andreas Diener Franzone, ihre Dolche und ein Schwert in Brust, Rücken, Hals, Schultern und Stirn. Ein Augenzeuge sagte später, Franzone hätte ganz unverfroren seine Hände in das strömende Blut getaucht. Bevor er starb, hatte der Herzog gerade noch Zeit, so etwas wie „Io sono morto“ („Ich bin tot“) und „Gnädige Muttergottes!“ hervorzustoßen.
Genau wie sechzehn Monate später im Dom von Florenz brach daraufhin das Chaos aus. Der mantuanische Botschafter meinte sogar, sechs Mörder zu sehen anstelle von vier. Die Menschen verließen in Panik die Kirche, voller Angst, dass noch weitere Leute ermordet werden könnten, zumal auch einer der Soldaten des Herzogs getötet, ein anderer verwundet worden war. Trotz seiner Behinderung eilte Giovanni Andrea auf die Seite des Gotteshauses, wo sich die Frauen aufhielten. Dort verhedderte er sich in den langen Gewändern, stürzte und wurde sogleich gefasst und an Ort und Stelle von einem Wachmann umgebracht. Seine Mitverschwörer jedoch entkamen. Binnen weniger Minuten war die Kirche Santo Stefano menschenleer, und es herrschte unheimliche Stille. Nur der Leichnam Galeazzo Mario Sforzas lag nach wie vor da, mit vierzehn Stichwunden, in einer riesigen Blutlache. Höflinge und Gesandte, die aus Erfahrung wussten, dass Geheimhaltung und Verrat sehr oft den Lauf der Politik bestimmen, fürchteten, dass sich an diesem Morgen noch weitere bewaffnete und verkleidete Verschwörer in Santo Stefano aufhielten, um jeden niederzumachen, der sich vor den ermordeten Fürsten stellte. Deshalb verließ der gesamte Hof – darunter auch, möglicherweise sogar auf Befehl, die Wachen des Herzogs – eilends die Kirche und zog sich in das Castello beziehungsweise einen der großen Sforza-Paläste zurück.14
Da die Verschwörer ganz offenbar keinen Gedanken auf ihre eigene Sicherheit verschwendet hatten, nachdem der Mord einmal begangen war, erwies sich das Komplott im Nachhinein als eine ausgesprochen einfältige Tat. Zwar war die allgemeine Stimmung in Mailand gegen Galeazzo Maria gerichtet gewesen, doch hatten Giovanni Andrea und seine Konsorten wenig oder keinen Anlass zu glauben, dass sich die mailändische Bevölkerung zu ihrer Verteidigung erheben würde. Gewiss gab es einige Bürger, die wehmütig an die Zeit der Ambrosianischen Republik zurückdachten, an den verzweifelten Kampf der Stadt gegen die Machenschaften der Fürsten, gegen die Adligen, Venedig und den großen Condottiere Francesco Sforza. Mittlerweile jedoch war jede realistische Hoffnung, zu einer Republik zurückzukehren, geschwunden, nicht zuletzt weil die jüngste Erfahrung mit einer Republik (1447–50) den Adel zutiefst vergällt hatte. Soweit wir wissen, machten die drei Männer auch keinerlei Anstalten, das gemeine Volk oder die Bürgerschaft aufzuwiegeln. Sie handelten gänzlich isoliert – möglicherweise derart von ihrem Hass auf den Herzog und dem Glauben an eine republikanische Utopie geblendet, dass sie an ein Wunder zu ihrer Rettung glaubten. Allerdings sollten derartige Wunschträume in einer grausigen Demonstration von Gerechtigkeit enden.
Die sterbliche Hülle des Herzogs wurde schließlich fortgetragen. Den Leichnam Giovanni Andreas jedoch griffen sich in einem grotesken Schauspiel, das sich im Übrigen 1478 in Florenz wiederholen sollte, einige Buben und zerrten ihn durch die Straßen der Stadt, wobei sie ihn immer wieder mit Steinen bewarfen und mit Messern auf ihn einstachen. Zuletzt wurde er vor sein Haus geschafft und kopfunter neben einem großen Fenster aufgehängt. Am nächsten Tag wurde der inzwischen enthauptete Körper erneut durch die Straßen geschleift. Den Kopf hatten die Behörden für ein späteres Ritual abgetrennt. In einem traditionellen symbolischen Akt war auch die „sündige“ rechte Hand abgehackt, verbrannt und an eine Säule auf der Piazza der Stadt genagelt worden. Einem Reim aus der Zeit zufolge verzehrten einige Leute auch Stücke von Giovanni Andreas Herz, seiner Leber und Hände. Was von dem Leichnam zuletzt noch übrig war, wurde Schweinen zum Fraß vorgeworfen.15
Angesichts der christlichen Doktrin hinsichtlich Seele, Glaubensbekenntnis, Letzter Ölung und einer anständigen Bestattung auf geweihtem Boden war die Verstümmelung eines Leichnams ein skandalöser Verstoß gegen die höhere Ordnung. Dennoch wurde sie von Polizei und Magistrat geduldet, wenn nicht sogar gefördert, da man Giovanni Andreas Mord an dem Herzog als eine schmähliche Tat ansah, die eine Bestrafung über den Tod und das Grab hinaus verlangte.
Die Wut und Empörung der herzoglichen Regierung und ihr Verlangen nach Rache und „Gerechtigkeit“ verhieß auch den anderen Verschwörern blanken Horror. Am Abend des 27. Dezember, einen Tag nach der Bluttat in Santo Stefano, wurde Giovanni Andreas getreuer Diener Franzone ergriffen, gefoltert und gezwungen, die Namen sämtlicher Verschwörer preiszugeben. Er war an den Lampugnani-Farben seiner Strümpfe erkannt worden. Am Sonntag, dem 29. Dezember, fasste man Carlo Visconti. Ein verängstigter Verwandter, der in herzoglichen Diensten stand, hatte ihn verraten. Auch er gestand unter der Folter und wurde verurteilt. Gerolamo Olgiati schließlich ging den Häschern am 30. Dezember ins Netz. Bei seiner Auslieferung hatten mehrere Leute mitgewirkt, darunter sein eigener Vater. In einem leidenschaftlichen Brief an die Herzogin, mit dem er sich Luft machen und zugleich wohl seine eigene Haut retten wollte, erklärte der ältere Olgiati, dass er es in Anbetracht der Entsetzlichkeit des Verbrechens „als Ehre empfunden hätte, die Todesstrafe an diesem Erzverräter [seinem Sohn] … eigenhändig zu vollstrecken“.16
Olgiati, Visconti und Franzone wurden am Donnerstag, dem 2. Januar 1477, vor Tagesanbruch im Castello hingerichtet. Alle drei wurden auf dem so genannten Rad, einem der qualvollsten Folterinstrumente, langsam bei lebendigem Leibe in zwei Hälften gerissen – nicht die Art von Vorgang, über die Historiker viele Details verlieren, wenngleich es natürlich einiges über die Moral der Zeit aussagt, über die damalige Einstellung dem Körper, der Gerechtigkeit und dem Sündenverständnis gegenüber. Um ein Exempel zu statuieren und als Demonstration der Strenge der Regierung wurden die Leichenteile anschließend zu den sieben Toren der Stadt geschafft und an fünfen jeweils eine blutige Hälfte angebracht. Die letzte Hälfte wurde geteilt und an die verbleibenden Tore genagelt: Arm und Schulter an die Porta Cumana, Bein und Fuß an die Porta Nuova. Die vier Köpfe – hier taucht Lampugnanis Kopf wieder auf – heftete man mit Lanzen an den Glockenturm des Broletto. Sämtliche Leichenteile wurden erst entfernt, als der Gestank unerträglich wurde. Die vertrockneten Köpfe allerdings blieben an Ort und Stelle und waren noch in den 1490er-Jahren zu sehen.17
Aufgrund der bedeutsamen Rolle, die die großen Familien in der italienischen Renaissance spielten, erwartete auch die Verwandten der Mörder eine wahre Schreckensherrschaft. Schuld und Schande galten nach wie vor als etwas, das die ganze Sippe betraf. Wie also hätte eine Regierung die Angehörigen eines Täters als völlig frei von Schuld ansehen können? Am Tag des Mordes wurden folglich neben Giovanni Andreas eigenem Haus zwei andere Lampugnani-Anwesen geplündert und weitere Besitztümer noch über längere Zeit hinweg bedroht. Einige Mitglieder des Klans behaupteten sogar, der Mörder sei gar kein Lampugnani, sondern ein Hochstapler gewesen. Jedenfalls brachten sämtliche Träger dieses stolzen Namens den gesamten Winter und Frühling mit dem Versuch zu, ihre Unschuld zu beweisen. Über ein halbes Dutzend Männer der Familie Lampugnani wurde verhaftet. Einer, Bernardino, wurde zum Tod verurteilt. Zwei weitere, die am Tag des Attentats in Santo Stefano gewesen waren, schworen, dass sie, hätten sie von dem Komplott gewusst, „diesen Verräter“ (Giovanni Andrea) angezeigt und „ihn und seine Kumpane mit ihren eigenen Zähnen zerfleischt“ hätten. Princivalle, ein Bruder des Verräters, verlor seine Stellung beim Militär und wurde zuerst nach Florenz und dann nach Mantua verbannt.18
Gerolamo Olgiatis entsetzter Vater schaffte es mit Mühe, die Besitztümer für die Familie zu erhalten, begab sich aber auf dem schnellsten Weg ins Exil nach Turin. Gerade für Angehörige vornehmer Familien bedeutete die Verbannung oft eine vernichtende Strafe, da sie dadurch nicht nur von Freunden und ihren Wurzeln abgeschnitten waren, sondern auch ihre üblichen Einkünfte verloren.
Acht weitere Männer, Freunde der Verschwörer, die zudem am Tatort gesehen worden waren, wurden am 8. Januar gehängt. Obwohl man sie beschuldigte, den Mördern Deckung gewährt zu haben, entgingen drei Priester der Todesstrafe – vermutlich dank ihres Status als Geistliche sowie der Tatsache, dass sich die Witwe des Herzogs, Bona von Savoyen, für sie einsetzte, weil sie sich um die Seele ihres verstorbenen Gatten sorgte.
Die Hauptakteure von Santo Stefano hatten aus Idealismus ebenso wie aus tiefstem persönlichem Hass gehandelt, und Bonas Beratern hätte es nur zu gut gefallen, sich einen Mann zu greifen, der rund achtzehn Monate zuvor aus Mailand verbannt worden war: den Humanisten Cola Montano, einen erbitterten Feind Galeazzo Maria Sforzas und häufig als der eigentliche Schuldige angesehen, der den Verschwörern den Gedanken an Mord in den Kopf gesetzt hatte, indem er Glanz und Tugenden des römischen Republikanismus verherrlichte. Dies hätte ihr Urteilsvermögen getrübt, insbesondere das des Träumers Olgiati. Doch da das Komplott im Sommer oder Herbst des Jahres 1476 geschmiedet worden war und die Attentäter geschworen hatten, dass der Humanist Mailand lange vorher verlassen und mit keinem von ihnen mehr Kontakt gepflegt hatte, galt Montanos Unschuld schließlich als erwiesen. Trotzdem kehrte er wohlweislich nicht nach Mailand zurück.19
Die Ironie des Schicksals wollte es freilich, dass Cola Montano fünf Jahre später Lorenzo de’ Medicis Spionen und dem Regime der Medici anheim fiel. Während einer Reise von Genua nach Rom im Februar 1482 wurde er unbemerkt verfolgt, auf florentinischem Gebiet in der Nähe von Porto Ercole verhaftet und direkt nach Florenz gebracht (12. bis 15. Februar). Da man bei ihm belastende Papiere fand, wurde er angeklagt, hinter einem Mordversuch an Lorenzo zu stecken, dem dieser im Jahr zuvor knapp entgangen war. Schlimmer noch war freilich, dass er offenbar auf der Gehaltsliste des Erzfeindes des Herrn von Florenz stand: des Grafen Girolamo Riario. Unter Folter gestand Montano geheime Aktivitäten gegen Florenz und Lorenzo und wurde einen Monat später an einem Fenster des Hauptgerichtshofes der Stadt, des Bargello, aufgeknüpft.
Ein Aspekt der Montano-Geschichte beleuchtet einen bezeichnenden Zug fürstlicher Regentschaft: Etwa 1462 tauchte Montano, aus einem Dorf in den Bergen bei Bologna kommend, in Mailand auf und eröffnete eine Schule für klassische lateinische Redekunst, die sehr erfolgreich war und eine Reihe begabter junger Leute aus der Oberschicht anzog. Er gewann die Gunst des Herzogs von Mailand und erhielt 1468 einen bedeutenden Lehrstuhl. Vier Jahre später gründete er gemeinsam mit anderen eine der ersten Druckereien Mailands. Als starke Persönlichkeit machte sich Montano in der von Neid und Missgunst geprägten Welt der Literaten allerdings auch Feinde. Und diese Feinde wiederum hatten einflussreiche Freunde bei Hofe. Das Glück verließ ihn, und 1474 brachte ihn eine nicht näher bekannte Meinungsverschiedenheit mit dem Herzog sogar kurzzeitig ins Gefängnis. Im Mai 1475 wurde er unvermittelt nach Pavia beordert und dort vor versammeltem Hofe vom Herzog beschuldigt, die Ehefrau, Söhne und Töchter eines gewissen Grafen „korrumpiert“ zu haben. Der Familienname ist in unserer Quelle, Montanas florentinischem Geständnis, gestrichen. Obwohl der Humanist die Anklage entschieden zurückwies, wurde er erneut in den Kerker geworfen und dann aus dem gesamten Herrschaftsbereich Mailands verbannt. Zuvor jedoch – und das ist das pikante Detail – wurde er öffentlich ausgepeitscht. Was er in seinem Geständnis nicht erwähnt – vielleicht weil es selbstverständlich war –, ist, dass die Schläge auf das entblößte Gesäß erfolgten. Öffentliche Züchtigungen dieser Art galten als schlimmste Erniedrigung, und es entsprach genau Galeazzo Marias Charakter, diese beschämende Strafe zu verhängen, die gewöhnlich Prostituierten vorbehalten war. Wurde Cola Montano so lange ausgepeitscht, bis, wie in solchen Fällen üblich, Blut floss? Kein Wunder, dass er dem Herzog ewige Rache schwor.
Die römische Verschwörung des Stefano Porcari (1453) endete mit weniger Blutvergießen als die Abschlachtereien in Mailand und Forlì, doch auch hier ist ein deutlicher Bezug zu den Ereignissen von Florenz erkennbar.20
Als Abkömmling eines römischen Adelshauses, das jedoch schon bessere Zeiten gesehen hatte, verbrachte Stefano Porcari einen Teil seiner Jugend bei dem florentinischen Kaufmann Matteo de’ Bardi. Er absolvierte die Grundlagen einer klassischen Bildung und entwickelte sich zu einem herausragenden Redner mit einer Vorliebe für geschliffene Rhetorik. Später diente er in Florenz ein Jahr (1427/28) als Capitano del popolo, einer der führenden Richter und Magistraten der Stadt. Dabei kam er in enge Berührung mit einem rührigen Humanistenzirkel, dessen Mitglieder ganz im Banne der Antike standen, vom Elan und den Freiheiten der Römischen Republik schwärmten und versuchten, dieses Bild auf Florenz zu übertragen. Porcari, ohnehin bereits Anhänger des republikanischen Gedankens, fühlte sich durch seine florentinischen Erfahrungen noch weiter ermutigt und erklärte in feurigen Reden, die später oft transkribiert und herumgereicht wurden, Florenz erscheine ihm als „das Ideal eines vollkommenen bürgerlichen und politischen Lebens“, und die „Erhabenheit, Schönheit und Herrlichkeit der Republik Florenz blende und verwirre ihn“.21
Zu dieser Zeit war es in Italien gang und gäbe, wichtige Aufgaben im Magistrat verschiedener Städte auf Zeit zu übernehmen, und Porcari diente dank dieser Ämterrotation auch in anderen Staaten, darunter Bologna, Siena, Orvieto und Trani. Nach 1435 bereiste er England und Nordeuropa und versäumte es mit Sicherheit nicht, auch Venedig einen Besuch abzustatten.
Wie viele gebildete Italiener seiner Zeit lehnte Porcari die Einmischung der Geistlichkeit in Angelegenheiten des Staates ab. 1447, nach dem Tod von Papst Eugen IV., tat er diese Meinung in Rom auch öffentlich kund und erklärte auf einer Versammlung, es sei eine Schande für die Bevölkerung Roms, die Erben der alten Römer, „unter dem Pantoffel von Geistlichen“ zu stehen, von denen viele noch dazu Auswärtige seien. Zwar schien er damit indirekt zu einem Aufstand gegen das Papsttum aufzurufen, er kam allerdings aufgrund der politischen Verhältnisse, die damals in Rom herrschten, damit durch. Der nächste Papst, der Humanist Nikolaus V., verlieh ihm sogar ein Amt, wodurch er jedoch in das Blickfeld der wachsamen Kurie geriet. Und als man ihn mit einem Tumult in Verbindung brachte, der während des Karnevals 1451 auf der Piazza Navona stattfand, wurde er aus der Stadt verbannt. Nikolaus, der die Fähigkeiten des Mannes würdigte, gleichzeitig aber auch fürchtete, setzte ihm eine großzügige Pension aus, schickte ihn jedoch ins Exil nach Bologna, wo er ihn der Aufsicht des humanistischen Kardinals Bessarion unterstellte. Aber Porcari ließ sich nicht beschwichtigen. Er war entschlossen, Rom zu einer Republik zu machen, ebenso wie Olgiati in Mailand und andere in Florenz später eine Wiederbelebung der Republik anstreben sollten.22
Nachdem er Kontakt zu Gleichgesinnten in Rom aufgenommen hatte, stahl Porcari sich Ende Dezember 1452 heimlich aus Bologna fort und ritt in halsbrecherischem Tempo nach Rom, wo er am Dienstag, dem 2. Januar, eintraf. Er hatte in vier Tagen eine Strecke zurückgelegt, für die man gewöhnlich acht, wenn nicht zehn Tage benötigte. Zurück in seiner Heimat, schmiedete er gemeinsam mit einigen Mitgliedern des engsten Familienkreises den Plan zu einer Verschwörung und sammelte dafür Männer, Waffen und Geld. Mithilfe von drei- oder vierhundert Männern wollte die Gruppe am Samstag, dem 6. Januar (Dreikönig), zuschlagen, durch Feuerlegen an die vatikanischen Stallungen Angst und Verwirrung stiften, Papst und Kardinäle während der heiligen Messe überraschen, die berühmte Stadtfestung, die Engelsburg, einnehmen und eine freie Republik ausrufen. Obwohl dieser Punkt in Porcaris Geständnis nicht auftaucht, behaupteten Zeitgenossen, die Verschwörer hätten den Papst sowie sämtliche Kardinäle notfalls auch umgebracht. Obendrein wären einige der Verschwörer nicht davor zurückgeschreckt, „das Volk“, das man um jeden Preis auf seiner Seite wissen wollte, anzustiften, die päpstlichen Schatzkammern, die prächtigen Stadtpaläste der Kardinäle und Kurialbeamten sowie Besitztümer der wohlhabenden auswärtigen Kaufleute und Bankiers zu plündern – damit das Ganze den Anstrich eines örtlichen Aufstands erhielte.23
Doch die Verschwörer agierten nicht schnell genug und waren wohl auch zu viele an der Zahl, wenngleich der genaue Plan vor den meisten Bewaffneten geheim gehalten wurde. Höchstwahrscheinlich hatte die Kurie bereits Wind von dem Komplott bekommen, bevor Porcari Bologna überhaupt verließ. Jedenfalls umstellte am späten Freitagvormittag, einen Tag vor dem geplanten Angriff, eine Hundertschaft päpstlicher Soldaten das in unmittelbarer Nähe der Piazza della Minerva gelegene Hauptquartier der Verschwörer. Rund siebzig bewaffnete Männer verschafften sich Zutritt zum Haus. Dort standen sich die Parteien zunächst abwartend gegenüber. Der päpstliche Kommandant wollte um jeden Preis einen offenen Kampf sowie jede Art von Skandal vermeiden. Er hoffte, alle Verschwörer verhaften und ohne großes Aufsehen vor Gericht bringen zu können. Im Laufe des Nachmittags kam es jedoch zu einigen Scharmützeln, in deren Verlauf den meisten Belagerten sowie allen Anführern der Verschwörung die Flucht gelang. Mindestens ein halbes Dutzend Männer fand dabei freilich auch den Tod. Doch noch am selben Abend wurde Porcari gefasst; ein Verräter hatte sein Versteck preisgegeben. In den nächsten Tagen folgte eine Reihe weiterer Verhaftungen. Vier der Anführer konnten aber aus Rom entkommen und gelangten bis an die Grenzen der Toskana, an den Stadtrand von Città di Castello und sogar nach Venedig, wo sie dann doch ergriffen und getötet wurden. Beim Verhör zeigte sich Porcari voll geständig, und am 9. Januar wurde der selbst ernannte Volkstribun, ganz in feierliches Schwarz gekleidet, an den Zinnen der Engelsburg gehängt. Am gleichen Tag erlitten zwölf Männer am Kapitol die Todesstrafe, und zwei Tage später fanden weitere Hinrichtungen statt. Sämtliche Besitztümer der Verschwörer wurden beschlagnahmt, in zwei Fällen mussten die Witwen ins Kloster gehen. Die meisten Bewaffneten, denen die Anführer das wahre Ziel der Verschwörung verschwiegen hatten, wurden verschont.
Angst und Schrecken erfüllten die Kurie. Papst Nikolaus sah sich schon deshalb zum erbarmungslosen Umgang mit den Hauptverschwörern gezwungen, weil ihr Komplott die unterschwellige Antipathie zwischen der römischen Bevölkerung und der Herrschaft der Privilegierten auszunutzen drohte und deshalb möglicherweise breite Unterstützung zu erwarten gehabt hätte. Aufgrund der großen Zahl bewaffneter Reservisten in Diensten der Kardinäle und anderer Feudalherren wie der Orsini, Colonni und Savelli ohnehin oft von Gewalt erschüttert, schien Rom nicht das rechte Pflaster für die Reden gewaltbereiter Republikaner.
Derartige Reden eigneten sich besser für die Republik Florenz, wo Stefano Porcaris politische Ideale geprägt wurden, inzwischen jedoch die Medici dabei waren, eben jene republikanischen Institutionen ernsthaft zu unterminieren – und dies ist die wahre Geschichte hinter dem Mordanschlag auf Lorenzo den Prächtigen und seinen Bruder Giuliano.