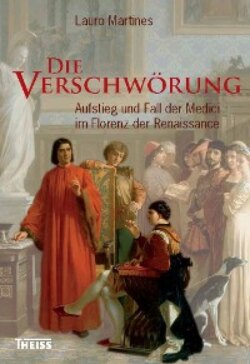Читать книгу Die Verschwörung - Lauro Martines - Страница 14
In Bankierskreisen
ОглавлениеDer Aufstieg der Medici verlief ähnlich dem vieler anderer florentinischer Familien. Aus dem dicht besiedelten Hinterland von Florenz kommend, zogen sie im 12. Jahrhundert in die wirtschaftlich blühende Stadt und ließen sich als Geldwechsler und -verleiher nieder. Außerdem waren sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem zwar hoch spekulativen, zu dieser Zeit aber ungemein lukrativen Immobilienmarkt tätig. An der Wende zum 14. Jahrhundert hatten sich die Medici – inzwischen auf mehrere Haushalte angewachsen – jedenfalls einen Namen als dynamische „Bürgerliche“ (popolani) gemacht und standen im Streit zwischen den beiden führenden Parteien der Stadt auf Seiten der konservativeren „Schwarzen“. Da sie sich in der Welt politischer Tumulte und Massenverbannungen ganz offensichtlich zu Hause fühlten, sagte man ihnen Gesetzeswidrigkeiten nach, und dieser Ruf blieb bis zum Ende des Jahrhunderts haften. Im Jahr 1400 wurden die Medici für zwanzig Jahre in die politische Verbannung geschickt; nur ein Zweig der Familie durfte bleiben. Dessen Oberhaupt war der aufstrebende Bankier Giovanni di Averardo, besser bekannt als Giovanni di Bicci.12
Schon vorher hatten die Medici freilich ihren Namen in die Annalen der Stadt eingebracht und eine beeindruckende Zahl von Amtszeiten im obersten Gremium der Stadt, dem neunköpfigen Rat der Prioren, vorzuweisen. Nur acht bis zehn andere Familien, unter ihnen die Strozzi und die Albizzi, konnten im 14. Jahrhundert diesbezüglich mit einer noch höheren Quote aufwarten. Trotzdem scheinen die florentinischen Regierungen die Medici kaum jemals zu wichtigen Beratungen hinzugezogen zu haben, und sie wurden auch nie auf diplomatische Missionen geschickt. Höchstwahrscheinlich schwächte ihr – teils auf tatsächlichen Verbrechen basierender – Ruf, notfalls auch auf Gewalt zurückzugreifen, ihre potenzielle politische Einflussnahme. Andererseits war Florenz damals ein ungleich gesetzloserer und unruhigerer Ort als zu Zeiten Lorenzos, und seine Vorfahren konnten Heiratsbande mit den Häusern Cavalcanti, Donati und Falconieri knüpfen, allesamt wesentlich älter und achtbarer als sie selbst. Die Patina der gentilezza brauchte eben nur etwas Zeit.
Energie, politischer Ehrgeiz und finanzieller Erfolg bildeten das Fundament der Medici-Dynastie und sollten ihre Zukunft prägen. Dem Historiker Gene Brucker, der sich mit der Frühzeit des Hauses befasste, fiel bei der Durchsicht verschiedener Testamente auf, dass die Mitglieder der Familie häufig versuchten, Schuldgefühle und Angst um ihre unsterbliche Seele durch großzügige Spenden an die Kirche und wohltätige Organisationen abzubauen. Sie bezweckten damit eine Art Absolution für ihre „unrechtmäßig erworbenen“ Gewinne. De facto bekannten sie sich damit Kredithaipraktiken von solcher Größenordnung schuldig, dass sie dem damaligen Glauben zufolge die Unsterblichkeit der Seele bedrohten.
Der Bankier Giovanni di Bicci (1360–1429), der den Reichtum der Familie begründete, war der Urgroßvater Lorenzos des Prächtigen. Vom Lehrburschen in der Firma eines Vetters vierten Grades, Vieri di Cambiozzo („Großer Wechsler“) de’ Medici, der eines der größten Bankhäuser seiner Zeit besaß, arbeitete sich Giovanni zum Teilhaber hoch und konnte an der Seite Vieris beträchtliche Erfolge verbuchen. 1393 machte er sich selbstständig, nahm selber einen Juniorpartner auf und verlegte 1397 den Firmenhauptsitz nach Rom. Jahrelang hielt er sich politisch im Hintergrund und lebte ganz unauffällig, eröffnete aber nach und nach Filialen in Florenz, Venedig und Neapel, bis er – hauptsächlich durch Einziehen päpstlicher Steuern im Ausland, clevere Devisengeschäfte und das Vorstrecken von Geldern an den Papst – ein riesiges Vermögen angehäuft hatte. In den letzten Jahren des Schismas und des Ringens dreier Päpste wurde er der Bankier eines alten Freundes, Papst Johannes XXIII. (1410–15), scheint jedoch auch nach Johannes’ Degradierung zum Gegenpapst keine Einbußen erlitten zu haben. Die Geschäfte florierten vielmehr, und schließlich eröffnete Giovanni auch noch eine Niederlassung in Genf, dem damals wichtigsten Finanzplatz nördlich der Alpen.13
Die Gabe, auswärts rasch Freundschaften zu schließen und zu Hause ein weit reichendes Netz eifriger Anhänger zu gewinnen, sowie immenser Reichtum begründeten den Einfluss der Medici auf die florentinische Regierung. 1427 hatte es Giovanni di Bicci, der bereits 1402 zu den fünfzig größten Steuerzahlern der Stadt zählte, zum reichsten Mann von Florenz gebracht, das in jenen Jahren mit seinen mehr als siebzig internationalen Bankhäusern als das Finanzzentrum ganz Westeuropas galt. Offiziell gehörte der Spitzenplatz dem namhaften Grundbesitzer Palla di Nofri Strozzi – Amateurgelehrter, Ritter und, auch er, Bankier, mit einem Nettovermögen von 101.422 Fiorini. Doch rechnet man das Vermögen der beiden Söhne, Kaufleute und Bankiers, des berüchtigten „Wucherers“ von Pistoia, Bartolomeo Panciatichi zusammen, stand der oberste Rang diesen zu, da sie über ein Nettovermögen von 127.000 Fiorini verfügten. Jahre später gab Lorenzo freilich an, der wahre Wert von Giovanni di Biccis Besitz in den 1420er Jahren habe bei 180.000 Fiorini gelegen, und Raymond De Roover, moderner Forscher in Sachen Medici-Bank, hält diese Zahl für durchaus plausibel. Tatsächlich schuldete die florentinische Regierung im August 1432 der Medici-Bank 155.887 Fiorini, die sie in den zurückliegenden zwanzig Monaten aufgenommen hatte – wenngleich anzunehmen ist, dass ein Teil dieses Kapitals den Anlegern der Bank gehörte.14
Parteienhader war in Florenz an der Tagesordnung. Ende der 1420er Jahre, als die Stadt wieder einmal in zwei Lager gespalten war, unterstützte Palla Strozzi die Seite der Medicigegner. Nach dem Triumph des Medici-Clans wurde er 1434 auf Lebenszeit aus der Stadt verbannt. Damit nicht genug, versuchte die neue Regierung, ihn mittels gezielter Besteuerung, Geldstrafen und Konfiszierung von Grundbesitz auch noch seines Vermögens zu berauben. Die Vernichtung der Gebrüder Panciatichi wurde noch gründlicher betrieben. Sie, die als „Außenseiter“ ohnehin keine feste politische Stellung in Florenz innehatten, über Heiraten mit vielen „Verlierer“-Familien verbunden waren und bereits ruinös hohe Steuern zahlten, wurden samt ihren Erben mit einer derart hohen Grund- und Vermögensteuer belegt, dass sie schließlich bankrott gingen. Entweder flohen sie aus Florenz und vor dessen Steuereintreibern, oder sie nahmen bei anderen Familien Gastfreundschaft in Anspruch, wenn sie sich nicht in ihrem eigenen Haus (wo man damals wegen Steuerschulden nicht verhaftet werden konnte) verschanzten und teils in erbärmlichen Verhältnissen lebten.15
Wie Lorenzo später bemerken sollte, barg in Florenz Reichtum allein – ohne Ämter und politische Befugnisse – immer die Gefahr, finanziell und gesellschaftlich ausgelöscht zu werden: eine Lektion, die die Medici stets im Gedächtnis behielten.16
Nach dem Tod Giovanni di Biccis 1429 erwarteten seinen Sohn Cosimo de’ Medici (1389–1464) schwere Zeiten. Die florentinische Oberschicht war bis aufs Blut verfeindet. Krieg, exorbitante Steuern und der Aufstieg von „Newcomern“ in die höchsten politischen Ämter hatten die Politikerriege gespalten. In seinen späteren Jahren hatte selbst Giovanni di Bicci seinen zurückgezogenen Lebensstil aufgeben und eine führende Rolle in der Politik einnehmen müssen. Doch für Cosimo standen 1429 die Sorge um die immensen Reichtümer der Familie und die Bankgeschäfte an erster Stelle.17
Zunächst wurde er in die besonderen Geheimnisse des Bankwesens eingeweiht, bei dem Gewinne geschickterweise weniger über Zinseinnahmen (die als „Wucher“ galten) als vielmehr mit Wechselgeschäften erzielt wurden, insbesondere dem Transfer von Geld von einem Ort zum anderen oder aber zwischen Personen. Mit anderen Worten: Zinsen wurden häufig als Entgelt für das „Risiko“ realer oder angeblicher Geldbewegungen deklariert. Und hierin erwies sich Cosimo, ebenso wie sein Vater, als wahres Genie. Unter seiner Führung entstand ein wahres Imperium: Neben den größeren Niederlassungen eröffnete er Filialen in Ancona (1436), Brügge (1439), Pisa (1442), London (1446), Avignon (1446) und schließlich Mailand (1452/53). Eine solche Ausweitung des Umfangs der Bankgeschäfte vervielfachte die Möglichkeiten für echte Transaktionen und Gewinnmaximierung. Die Einnahmen aus der römischen Niederlassung sanken um die Hälfte, doch wurde dieser Rückgang durch Gewinne in Venedig und Genf sowie Einkünfte aus den neuen Filialen mehr als wettgemacht. Wegen Lücken in den Unterlagen nach 1435 lässt sich der Gesamtgewinn der Bank unter Cosimo nicht mehr nachvollziehen, doch man weiß, dass er bis etwa 1450 sein bereits gewaltiges Erbe deutlich vergrößert hatte. Seine Steuererklärungen geben, ebenso wie die seines Vaters, nur sehr unzuverlässig Auskunft über seine tatsächlichen Einkünfte. 1458 beispielsweise hatte er in der Mailänder Filiale Kapital in Höhe von 13.500 Fiorini, doch erscheint dieser Betrag in seiner Steuererklärung dieses Jahres nur mit 3000 Fiorini.18
Gewiss glaubte Cosimo sich im Recht, wenn er den Behörden gegenüber falsche Angaben machte. Das war in Florenz damals gängige Praxis. Hinzu kam, dass das internationale Bankwesen in ständigem Wandel begriffen war und die großen florentinischen Häuser an Boden verloren. Waren es in den 1420er Jahren noch 72 gewesen, gab es 1470 gerade noch 33, sieben oder acht mussten allein Mitte der 1460er Jahre schließen. Selbst Cosimo hatte einige zweifelhafte Geschäfte getätigt, was ihn angesichts seines ansonsten so sicheren Instinkts gewiss geärgert haben dürfte. Die Probleme traten schon kurz nach seinem Tod offen zutage. Die Zweigstellen in London und Venedig standen kurz vor dem Zusammenbruch, Mailand hatte gefährlich überzogen, und Lorenzos Vater, der kränkliche Piero, der 1464 die Leitung der Bank übernahm, sah sich gezwungen, Kredite zu streichen oder auswärtige Klienten und Anhänger zu vergällen. Als der Herzog von Mailand, Cosimos alter Freund Francesco Sforza, 1466, zwei Jahre nach dem Bankier, starb, hinterließ er bei den Medici Schulden in Höhe von 115.0 Dukaten, die völlig unzureichend gedeckt waren (einige verpfändete Schmuckstücke und eine begrenzte Beteiligung an den Steuereinkünften durch den mailändischen Salzhandel). Noch vor Ende des Jahres 1467 waren diese Schulden auf 179.000 Dukaten angewachsen. Der gewiefte Bankier hatte sich auf das gefährliche Spiel eingelassen, Darlehensvergabe und Machtpolitik miteinander zu mischen, und war gescheitert. So hatte er die Filialen in Ancona und Mailand zumindest teilweise deshalb eingerichtet, um Sforza zu helfen – offenbar in der Voraussicht, irgendwann auf die Truppen des erfahrenen Militärs zurückgreifen zu müssen.19
So genial Cosimo auch gewesen sein mag – sein Sohn Piero erbte ein kränkelndes Imperium. Und obwohl er bereits als Bub mit Buchführung vertraut gemacht worden war, besaß er kaum praktische Erfahrung im internationalen Bankwesen. Die Folge? Genauso wie später Lorenzo blieb auch ihm keine andere Wahl, als sich auf die Wechselfälle der Politik und den Rat der Niederlassungsleiter zu verlassen, die ihrerseits Mühe hatten, den im Wandel befindlichen Finanzmarkt zu begreifen. Hinzu kam, dass man viel zu häufig an die Geldnöte perfider oder verantwortungsloser Fürsten gebunden war. Und um das Maß voll zu machen, sah sich Piero 1465/66 mit einer der schlimmsten politischen Bedrohungen konfrontiert, mit denen die Medici jemals zu kämpfen hatten. Er war schwer krank, litt ständig Schmerzen, hatte keine vier Jahre mehr zu leben, und sein Sohn Lorenzo war gerade einmal siebzehn Jahre alt. Obwohl die weiter entfernten Niederlassungen der Bank in erheblichen Schwierigkeiten steckten, wurden an der Spitze der Oligarchie in Florenz zunehmend Stimmen laut, die das Ende der strikten politischen Kontrollen forderten, die die herrschende Schicht in den letzten dreißig Jahren eingeschränkt hatten. War es da nicht unumgänglich, dass die Bankgeschäfte hinter der Politik zurückstehen mussten?20