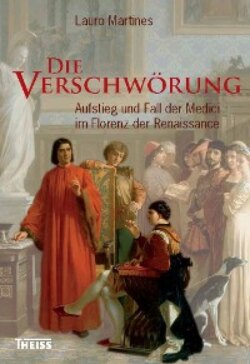Читать книгу Die Verschwörung - Lauro Martines - Страница 17
Giannozzo Manetti (1396–1459)
ОглавлениеDer Kaufmann und Bankier, Gelehrte, Staatsmann, Schriftsteller und Übersetzer Giannozzo Manetti darf zu den bedeutenden Persönlichkeiten der Ära gezählt werden. Trotz intensiver Beschäftigung mit Finanzgeschäften und dem Handel mit kostbaren Stoffen beherrschte er Altgriechisch, Latein und Hebräisch, verfasste Ansprachen, Kommentare, Abhandlungen, Polemiken und Kurzbiographien, übersetzte gelehrte Schriften und wurde zu einem der größten florentinischen Diplomaten seiner Zeit. Da er zudem brillante lateinische Stegreif-Reden hielt und andere Humanisten in den Schatten stellte, trug er wesentlich zum Ruhm von Florenz als Stadt der Gelehrsamkeit und des Scharfsinns bei. Den politischen Führern freilich war er ein zu unabhängiger Geist und schlechtes Beispiel für andere, was zur Folge hatte, dass sich Cosimo de’ Medicis engste Anhänger daran machten, ihn in den Ruin zu treiben, und zwar auf die für die Medici-Oligarchie typische Art und Weise: durch erdrückende Steuern.2
Der gesellschaftliche Aufstieg der Familie Manetti, die am Südufer des Arno im Bezirk Santo Spirito zu Hause war, begann im frühen 14. Jahrhundert. Eine Reihe bedeutender Eheschließungen zeugen davon. Giannozzos Großvater väterlicherseits, ein Bankier und Geldverleiher, war das erste Mitglied des Hauses, das eine Amtszeit als Prior in der Signoria antrat (1358). Giannozzos Vater Bernardo hingegen, ein außergewöhnlich erfolgreicher Bankherr, war durch und durch Geschäftsmann. Einen Großteil seines beachtlichen Reichtums erwarb er in Neapel, Spanien und Portugal, was ihm wenig Zeit für die Politik ließ und er sich bis zu seinem Tod 1429 mit unbedeutenderen Ämtern zufrieden gab. Bis dato allerdings hatte er ein solch gewaltiges Vermögen erworben, dass er als einer der reichsten Männer der Stadt galt – und das in eben den Jahren, in denen Florenz die Finanzkapitale Europas war. Sein Sohn Giannozzo erbte folglich ein Vermögen, das ihn, zumindest was Geld anbelangte, mit den reichsten Familien der Stadt, den Medici, Pazzi und Strozzi, auf eine Stufe stellte.3
Etwa 1421 wandte sich Giannozzo, damals fünfundzwanzigjährig, gegen den Willen seines Vaters ganz den Geisteswissenschaften zu und erlernte in den folgenden neun Jahren unter Anleitung von Geistlichen und Privatlehrern Latein und Altgriechisch sowie später Hebräisch. Im Rahmen seiner Studien lernte er die lateinischen Dichter, allen voran Cicero, und griechischen Philosophen kennen, insbesondere Aristoteles. Es hieß, er kannte Augustinus’ De civitate Dei nahezu auswendig, und dank eines fest angestellten Magisters perfektionierte er sein Hebräisch so weit, dass er das Alte Testament problemlos durcharbeiten konnte. Als überzeugter Christenmensch und „glänzender Polemiker“ nutzte er seine Hebräischkenntnisse dazu, Schriften zu verfassen, die die Juden bekehren sollten, indem er ihnen Irrtümer nachzuweisen suchte.
Um 1429 herum trat er aus der Studierstube an die Öffentlichkeit. Er war regelmäßiger Besucher zweier berühmter Treffpunkte der florentinischen Literaten und Intellektuellen: eines „Dach der Pisaner“ genannten Ortes an der Westseite der Piazza, und der Straße der Buchverkäufer, dem wichtigsten Markt der Schreibwarenhändler, unmittelbar nördlich des Regierungspalastes gelegen. Hier machte er sich rasch einen Namen als brillanter Redner.
Giannozzo betrat die politische Bühne im Todesjahr seines Vaters, als Florenz mitten in einer schweren Finanzkrise steckte und sämtliche wohlhabende Familien unter exorbitanten Steuerlasten litten. Sein Auftauchen war sehr wahrscheinlich eine Folge dieser schweren Zeit, zumal er 1429 als Mitglied der Dodici Buonomini, des regelmäßig mit der Regierung zusammentretenden Zwölferrats, auch erstmals ein höheres Amt übernahm. Sein Reichtum, seine Eloquenz sowie die Tatsache, dass sein Großvater Prior gewesen war, prädestinierten ihn geradezu für eine Laufbahn als Politiker. Doch als der Konflikt zwischen den beiden florentinischen Parteien im Rahmen der Steuerkrise seinen Höhepunkt erreichte, verschwand Giannozzo von der politischen Bühne und kehrte erst 1435 wieder in ein Amt zurück. Die folgenden achtzehn Jahre aber blieb er fast ständig im Licht der Öffentlichkeit und bekleidete nahezu jedes mögliche Amt: Verwaltungstätigkeiten im florentinischen Hinterland, sechs Amtszeiten in den beiden Beratergremien der Signoria, eine Anzahl weiterer hoher Ämter, Mitglied des gefürchteten Wachausschusses der „Acht“ (zweimal), Kurator an der Universität der Stadt sowie eine Reihe wichtiger Botschafterposten. So betrachtet wirkt er ganz wie ein echtes Mitglied der Medici-Oligarchie und schien auch deren Gunst zu genießen. Bei genauerem Hinsehen sticht jedoch eine interessante Tatsache ins Auge: Er war niemals Mitglied der Signoria. So häufig er in Ämter ersten und zweiten Ranges gewählt wurde – er kam nie in den Genuss der höchsten Würden. Dennoch nutzte die Oligarchie sein diplomatisches und rhetorisches Geschick und setzte so viel Vertrauen in seinen Patriotismus, dass sie ihm in den Jahren 1445 bis 1453 bedeutende Botschafterposten in Siena, Genua, Neapel, Rom, Mailand und Venedig zu überließen.4
Obwohl die Politik Familien, die zum Kern der Oligarchie gehörten, häufig aus der finanziellen Patsche half, ließen die parteiischen Steuerbeamten keine Gelegenheit aus, Giannozzos Vermögen zu beschneiden. Dennoch blieb er weiter im Amt und erfüllte seine Bürgerpflichten – vielleicht auch deshalb, weil er hoffte, die Männer an der Spitze seien fair genug, um ihm letztlich doch noch Steuergerechtigkeit widerfahren zu lassen. Doch dem war nicht so, und Anfang der 1450er Jahre verweigerte ihm die Regierung sogar die Erstattung seiner Auslagen für eine langwierige und kostspielige diplomatische Mission nach Rom, die sechzehn Pferde und eine beachtliche Anzahl von Burschen und Dienern erfordert hatte. Daraufhin machte er, als sich eines Abends Gelegenheit zu einem Gespräch mit Cosimo de’ Medici ergab, seinem Ärger Luft. Was Steuergelder und persönlichen Einsatz für die Stadt anginge, warf er ihm an den Kopf:5
Ich habe mehr beigetragen als irgendein anderer Mann in Florenz, Euch, Cosimo, eingeschlossen, denn bis zum heutigen Tag habe ich persönlich mehr als 135.000 Fiorini bezahlt, und dass ich dies getan habe, ist Euch und ganz Florenz wohl bekannt. … Nie, weder in einem [Regierungs-]Gremium noch im Geheimen, habe ich, wie jedermann weiß, jemals gegen die Interessen des Staates gehandelt. … Die Art und Weise, wie ich meine Aufgaben erfüllt habe, sowohl innerhalb der Stadt als auch auswärts, ist jedem von Euch bekannt. … Und auch was ich als Entlohnung dafür zurückerhielt, ist Euch und allen Mitgliedern der Regierung sehr genau bekannt.
Cosimo, um besänftigende Worte bemüht, musste zugeben, dass all das den Tatsachen entsprach. Damit war er auch gut beraten, denn in der wichtigsten Steuerschätzung der 1450er Jahre hatte der alte Bankier mit Erfolg „eine Summe angegeben, die dem Umfang der Investitionen der Medici in keinster Weise entsprach“, sondern bei schätzungsweise 65, höchstens 75 Prozent ihres wahren Wertes lag.
Selbst wenn wir die von Giannozzo genannte Summe von 135.000 Fiorini halbieren – wozu keinerlei Anlass besteht –, wäre dies ein gigantischer Betrag. Er entspricht durchschnittlich 5400 Fiorini pro Jahr, verteilt auf fünfundzwanzig Jahre, und ein Großteil des Geldes muss durch Verkauf von, oder Erwerb mittels, Staatsanleihen (Aktiva im Monte) aufgebracht worden sein. Da ein gut bezahlter Juraprofessor damals etwa 350 Fiorini im Jahr verdiente, entsprachen Giannozzos jährliche Steuerzahlungen den Gehältern von nicht weniger als fünfzehn Juristen an der Universität von Bologna, dem Zentrum des europäischen Rechtswesens. Diese Summe stellte das Haus des Humanisten auf eine Stufe mit schikanierten Familien wie den Castellani, Guasconi, Panciatichi, Peruzzi, Serragli und einigen Strozzi, die allesamt in den Jahrzehnten nach 1434 einen Großteil ihres Vermögens in Form von Steuern und Strafgeldern einbüßten – und dies zumeist aus obskuren Gründen infolge privater und politischer Fehden.6
Giannozzos Freund und Biograph Vespasiano da Bisticci dürfte den Mann freilich idealisiert haben, und so tut man gewiss gut daran, das Bild geradezu übernatürlicher Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit und Vaterlandsliebe, das er von dem Humanisten zeichnet, ein wenig zu relativieren. Doch wo immer dort genannte Fakten überprüfbar sind, etwa hinsichtlich Anzahl und Aufgabenbereich seiner diplomatischen Missionen, erweist sich Vespasianos Darstellung als zuverlässig.
Was genau aber hatte Giannozzo getan, um die Medici-Oligarchie gegen sich aufzubringen? Vieles weist darauf hin, dass er den Umfang, in dem Cosimo Francesco Sforza bei dessen Übernahme Mailands 1450 unterstützte, nicht gerade guthieß und stattdessen engere Beziehungen zu Venedig befürwortete. Während einer diplomatischen Mission, die ihn sowie Neri Capponi und Cosimos Sohn Piero 1449 nach Venedig führte, war er bemüht, die überhebliche Einmischung des großen Bankiers zu hintertreiben, der auf einen sofortigen Abbruch der Beziehungen mit den Venezianern drängte. Er äußerte dies Capponi gegenüber, der jedoch sofort konterte: „Ich habe keine Lust, mich mit einem Löwen [Cosimo] anzulegen. Falls Ihr das wollt, dann tut es. Ich jedenfalls möchte nicht aus Florenz vertrieben werden.“ Giannozzo beugte sich.7
Bei genauem Hinsehen lassen sich seine Differenzen mit der an der Regierung befindlichen Clique bereits in die 1430er Jahre zurückverfolgen, lange vor den ersten Meinungsverschiedenheiten über die florentinische Außenpolitik. Die Hintergründe mussten also anderswo liegen. Vespasiano wurde nicht müde zu versichern, dass der wahre Beweggrund von Giannozzos Gegnern seine Tugend, seine Heimatliebe, seine großen Geistesgaben und (implizit) sein Reichtum gewesen seien. Diese Behauptung könnte durchaus einen wahren Kern haben. Etwas an dem Humanisten störte den inneren Kreis der Oligarchie: Er zeigte sich nicht respektvoll genug. Er neigte dazu, seine Meinung zu sagen. Sein diplomatisches Geschick war beeindruckend. Er war reich genug, um auf niemanden angewiesen zu sein. Und da er darüber hinaus nicht eng genug in eine politische Seilschaft verstrickt war, suchte er auch keine Powerbroker auf und war insofern nicht „politisch“ genug. Daher also die Unabhängigkeit, die ihn suspekt machte.
In den Jahren, in denen Manettis Eloquenz und Gelehrtheit sowie sein Ruf als herausragender Diplomat in ganz Italien bekannt waren, erreichten seine Dissonanzen mit der herrschenden Schicht ihren Höhepunkt, wie die oben erwähnte Auseinandersetzung mit Cosimo belegt. Vespasiano zufolge war Luca Pitti, einer der engsten Gefolgsleute Cosimos, „der Mann, der ihn mittels steuerlicher Abgaben ruinierte“. Somit haben wir den unmittelbaren Schuldigen. Doch die Oligarchie war ein Team, keine Ein-Mann-Show, und die Besteuerung war, ebenso wie die Weigerung, Gesandten eine angemessene Entschädigung zu zahlen, immer eine kollektive Entscheidung. Zudem hätte sich eine solche Übervorteilung ohne Wissen und Zustimmung des Teamleiters, also Cosimos, niemals derart lange und effektiv durchsetzen lassen.8
Jüngere Anstrengungen, die Medici von ihrer Beteiligung an der Hetze auf Giannozzo freizusprechen, gehören in Frage gestellt. Als der Humanist 1453 Florenz verzweifelt den Rücken kehrte und nach Rom zog, weil er glaubte, ein weiterer Aufenthalt in der Arnostadt würde ihn endgültig in den Ruin treiben, zeigt sich die herrschende Gruppierung überrascht. Die Signoria, die sich dadurch angegriffen fühlte, stellte ihm das Ultimatum, sich binnen zehn Tagen in Florenz einzufinden, und verkündete auf der großen Piazza della Signoria, auf dem Mercato Vecchio sowie an der Tür seines florentinischen Hauses seine Verbannung. Seine Nachbarn und viele Angehörige der politischen Klasse dürften darüber nicht schlecht gestaunt haben. Nicht einmal freies Geleit sicherte ihm die Regierung zu und ließ ihn dadurch wissen, dass er im selben Augenblick, in dem er den Fuß auf florentinischen Boden setzte, mit seiner Verhaftung zu rechnen hätte. Dabei bestand die einzige Anschuldigung, die man gegen ihn erhob – die aber nicht haltbar war –, darin, dass er mit einem der Hauptfeinde von Florenz, König Alfonso von Neapel, gemeinsame Sache gemacht hätte, indem er ihm seine Abhandlung De dignitate et excellentia hominis widmete. (In Wahrheit waren die Beziehungen zwischen Florenz und Alfonso ohnehin stetem Wandel unterworfen.) Dass er sich den Prioren einen Tag vor Ablauf des zehntägigen Ultimatums stellte und dabei vor ihnen auf die Knie sank, trieb diesen, glaubt man Vespasiano, fast die Tränen in die Augen. Kurz darauf wurde er überraschenderweise in ein Amt an der Spitze der Regierung gewählt, in den zehnköpfigen Notstandsrat, der in Kriegszeiten sogar noch weitreichendere Machtbefugnisse besaß als die Signoria. Da er sein Florenz und dessen neidische Seilschaften jedoch kannte, diente Giannozzo nur kurze Zeit in dem Zehnerrat und verließ dann, nachdem er die erforderliche Erlaubnis eingeholt hatte, abermals die Stadt – in der Hoffnung, auf die Protektion sowohl König Alfonsos als auch Papst Nikolaus’ V. zählen zu können, eines gelehrten und vormals bescheidenen Geistlichen, den er Jahre zuvor in Florenz kennen gelernt hatte.
Hatte sich Giannozzo seiner Republik gegenüber illoyal verhalten, indem er König Alfonso Ehre angedeihen ließ? Er lebte nicht in einem „Zeitalter der Ideologie“, wie es das nächste Jahrhundert werden sollte. Italiens Staaten standen unter fürstlicher und republikanischer Herrschaft. Und wenn ein Mann einem Fürsten seinen Lebensunterhalt verdankte, war er verpflichtet, ihm und dem Ideal der Monarchie zu huldigen, auch wenn er selbst aus einer Republik kam. So war es bei Gelehrten und selbst Staatsmännern der Renaissance üblich, wie uns Castigliones Il Cortegiano attestiert. Einer solchen Handlung haftete nichts Unehrenhaftes oder gar „Landesverräterisches“ an. Als Giannozzo endlich akzeptierte, dass fortuna ihm in Florenz nicht länger hold war, besaß er längst (durch sein Auftreten als florentinischer Gesandter in Neapel) die Gunst König Alfonsos, und es darf nicht verwundern, dass er von dem König angetan war und sowohl den Monarchen selbst als auch die Monarchie pries. Doch dies tat seiner Treue zur Republik Florenz keinen Abbruch. Der Geist des Zeitalters erlaubte es durchaus, dem einen zu huldigen und dem anderen zugleich als Bürger zu dienen.
Giannozzos Latein war derart kunstvoll und ausgefeilt, dass manche dies als Zeichen eines geborenen Höflings ansahen. Er liebte komplizierte Satzkonstruktionen, und sein Stil liest sich hochtrabend genug, um als Lobpreisung der Mächtigen intendiert gewesen zu sein. Wie alle Humanisten war er vor allem in der Kunst der Rhetorik geschult und wusste dies zu seinem Vorteil einzusetzen. Doch abgesehen davon, dass er dadurch hohe Gesandtschaftsposten gewann, nutzte er seine goldene Zunge nie, um sich bei den Mächtigsten der Oligarchie lieb Kind zu machen. In Florenz selbst verhielt er sich immer als Republikaner und erwartete dasselbe auch von seinesgleichen.9
Mehrere Schreiben, die er in den 1450er Jahren an Cosimo de’ Medicis Sohn Giovanni richtete, bezeugen seine Bereitschaft, außerhalb von Florenz für die Medici tätig zu werden. Gemessen am Stil des 15. Jahrhunderts sind diese Briefe jedoch nicht sonderlich warm oder herzlich und nicht im Mindesten schmeichlerisch oder gar unterwürfig, obwohl die Medici angefangen hatten, Schmeicheleien als Selbstverständlichkeit anzusehen. Kurz: Giannozzo wahrte seine Würde, indem er keinen Zweifel daran ließ, dass er sich den Medici in moralisch-ethischer Hinsicht gleichgestellt fühlte, unabhängig davon, welches Gewicht sie auf die politische Waagschale zu werfen hatten.10
Angesichts Cosimos Machtposition in Florenz wäre es dumm gewesen, hätte Giannozzo während eines Aufenthalts in Rom oder Neapel den politischen Führern in der Heimat keine Unterstützung angeboten. Er besaß viele Freunde in Florenz, und auch seine Familie lebte dort. Später sollte einer seiner Söhne in der Signoria dienen. Und er verfügte weiterhin über beträchtliche Besitztümer in der Stadt. Dem Sittenkodex der Zeit entsprechend hieß dies folglich, wollte man keine offene Auseinandersetzung provozieren, in Briefen den Schein zu wahren – und dazu gehörte eben auch die eine oder andere Schmeichelei. Das galt für private Korrespondenz ebenso wie für den Austausch auf diplomatischem Parkett.
Das Problem des weißhaarigen Giannozzo (er war bereits mit dreißig Jahren völlig grau) bestand darin, dass er sich nicht an die Spielregeln hielt, nicht das Knie beugen und sich in die Gefolgschaft einreihen wollte. Dies mag ein Zeichen moralischer Integrität gewesen sein, aber es zeigte der Oligarchie auch, dass er stolz war und kompromisslos. Und das war, im mediceischen Florenz zumindest, Grund genug, um den Mann in den finanziellen Ruin zu treiben. Die Familie Pazzi hielt sich an die Spielregeln und beugte das Knie – teilweise zumindest – bis etwa 1470, dem Jahrzehnt der tragischen Generation. Doch bei Lorenzo dem Prächtigen machten auch sie nicht mehr mit.