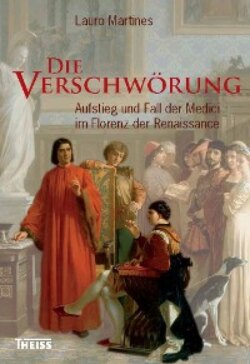Читать книгу Die Verschwörung - Lauro Martines - Страница 15
Eine Lektion in Sachen Politik
ОглавлениеUnsere Geschichte beginnt mit dem lukrativen Geschäft der Söldner: Krieg, dem kostspieligsten aller öffentlichen Unternehmen. Kostspielig, weil die Anwerbung von Soldaten die Regierung unmittelbar in Schulden stürzte und die Last zusätzlicher Steuern brachte; und ärgerlicherweise noch Zwietracht schürend dazu, weil höhere Steuern zu immer heftigeren Differenzen innerhalb der regierenden Parteien und Auseinandersetzungen darüber führten, welche Männer wohl am besten geeignet seien, unter solch widrigen Umständen ein öffentliches Amt zu bekleiden. Die ganze florentinische Gesellschaft war von sozialen Eifersüchteleien durchzogen und gierte nach der Kriegsbeziehungsweise Amtsausbeute.21
Wir befinden uns im Florenz der 1420er Jahre, jenem Jahrzehnt, in dem die Medici erstmals nach der Macht griffen. Krieg mit Mailand und ein gescheiterter Versuch, sich die kleine Nachbarrepublik Lucca mittels Waffengewalt einzuverleiben, machten die Stadt anfällig für politische Unruhen. Die Steuern stiegen, die Gemüter waren erhitzt, und im Zuge der allgemeinen Verunsicherung sammelte sich ein Kreis von „Newcomern“ um Giovanni de’ Medici und seinen Sohn Cosimo, deren Reichtum und Sachverstand hinter den Kulissen auch Männer aus den vornehmsten Familien anzogen. Eine Trennung nach Klassen war, oberflächlich jedenfalls, nicht erkennbar. Dennoch schlossen sich – wohl unter dem Gefühl drohenden Unheils – angeführt von Niccolò da Uzzano, Rinaldo degli Albizzi und Ridolfo Peruzzi einige der mächtigen alten Familien zusammen und versuchten, die Stadt einer strengeren Herrschaft der alten Häuser zu unterwerfen. Kurz: Medici-Geld, größtenteils durch Geschäfte außerhalb der Arnostadt erwirtschaftet, störte nun das politische Gleichgewicht zwischen den herrschenden Familien.22
Im Frühling des Jahres 1433, Florenz hatte gerade einen Frieden mit Lucca ausgehandelt, ahnte Cosimo, den Kriegsanleihen zum Helden gemacht hatten, bereits die bevorstehende Krise. In aller Stille transferierte er Ende Mai eine große Summe und gab an die 9000 Fiorini in die Obhut einiger Mönche, deren Gunst er sich zuvor versichert hatte. Weitere 15.000 Fiorini überwies er an seine Niederlassung in Venedig, und 10.000 Fiorini in Form florentinischer Staatsanleihen verkaufte er an die Medici-Filiale in Rom. Damit war er für einen Aufruhr gewappnet. Und als eine neue Gruppe von Prioren im September ihr Amt antrat, brach der Sturm tatsächlich los.23
Unter dem Vorwand, seinen Rat einholen zu wollen, ließ die neue Signoria ihn in den Regierungspalast rufen, wo er ohne Vorwarnung verhaftet wurde. Da er fürchtete, vergiftet zu werden, war er auch selbst gewaltbereit und hoffte, dass seine Freunde und Verbündeten einen Staatsstreich anzetteln würden. Doch entgegen den Wünschen seiner Hauptfeinde entschieden sich die Prioren für Milde und schickten ihn sowie verschiedene andere Mitglieder seiner Familie für zehn Jahre in die Verbannung – zuerst nach Padua und kurz darauf nach Venedig. Bezeichnenderweise wurden noch zwei weitere Männer, die nicht zur Familie gehörten, ebenfalls verbannt: ein Ritter aus der altehrwürdigen Familie Acciaiuoli und Puccio Pucci, ein tatkräftiger Newcomer.
Ein Jahr später sollten Cosimos Feinde unisono seufzen: „Hätten wir ihn doch nur umgebracht!“ Ihnen fehlte sowohl das Organisationstalent als auch der rücksichtslose Realitätssinn der Medici-Clique. Jede Regierung hatte das Amt schließlich zwei Monate inne und wurde dann von einem neuen Gremium abgelöst. Für Kontinuität in der Politik sorgten zwei beratende Ausschüsse mit zwölf beziehungsweise sechzehn Mitgliedern sowie die durchgängige Praktik, führende Bürger zu den Beratungen hinzuzuziehen. Merkwürdigerweise versäumten es die „Aristokraten“ nach der Verbannung Cosimos, die Wahlen der nachfolgenden Priorengremien zu manipulieren. Und ein Jahr später, am 1. September 1434, wurde prompt eine Medici-freundliche Signoria vereidigt, die „durch Losentscheid“ ins Amt gekommen war. Mehrere aristokratische Anführer stellten einen Antrag auf bewaffneten Widerstand und griffen einen Tag lang selbst zu den Waffen, verloren dann aber den Mut, zogen sich zurück und wurden überwältigt. Cosimo und sein Bruder kehrten am 6. Oktober triumphal zurück, und der für die innere Sicherheit verantwortliche achtköpfige Wachausschuss, die Otto, leiteten die erwarteten Vergeltungsmaßnahmen ein.
Bald darauf wurden 106 Männer aus der Stadt verbannt, und mehr als achtzig entzog man das Recht auf ein öffentliches Amt, jenen außerordentlich wichtigen Indikator gesellschaftlicher Stellung. In einer Welle von Ausweisungen, die bis 1439 andauerte, wurde die gesamte Medici-feindliche Führung sowie ihre tatkräftigste Anhängerschaft von der politischen Bühne entfernt. Unbedeutendere Mitglieder der entsprechenden Zirkel, die der Verbannung entgangen waren, verstummten. Gegen viele der über zweihundert Männer, die aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen worden waren, wurden zudem Geldbußen verhängt, und sie wurden sämtlich Opfer gezielter ruinöser Besteuerung. Der Zeitgenosse Benedetto Dei notierte, dass, die Familien der Exilanten mit eingerechnet, allein 1434 und 1435 rund fünfhundert Menschen die Stadt verließen. Zwar mussten die Urteile hinsichtlich Verbannung und Aberkennung der politischen Rechte alle zehn Jahre erneuert werden, doch wurde dies mitunter derart effektiv verfolgt, dass – wie wir am Beispiel der Familie Strozzi gesehen haben – noch dreißig Jahre später die Nachfahren der ursprünglich Verbannten bei ihren Bemühungen um die Heirat mit einer Florentinerin auf erheblichen Widerstand stießen.24
Im Laufe der folgenden fünfundzwanzig Jahre führte die siegreiche Partei der Medici eine Reihe von Wahlpraktiken ein, die dazu führten, dass sich die Macht in (zu) wenigen Händen konzentrierte. Doch gingen sie dabei zu weit. Die allgemeine Verärgerung wuchs und erreichte 1458 den Siedepunkt. In diesem Jahr taucht in den Chroniken plötzlich wiederholt der Name Luca Pitti auf.
Pitti, der Erbauer des ebenso imposanten wie umstrittenen späteren Palazzo gleichen Namens, kam aus einer traditionsreichen Politikerfamilie, ungefähr so alt wie die der Medici, und war mehrere Jahre lang einer von Cosimos treuesten Parteigängern. Anfang 1458 regte sich zäher Widerstand in den Regierungsgremien, was den Parteiführern deutlich machte, dass die Opposition außer Kontrolle geraten war. Die meisten gewöhnlichen Mitglieder der politischen Schicht forderten das Ende des Wahlkontrollsystems und wollten mehr Bürgern den Zutritt zu den höchsten Ämtern ermöglichen. Die Stimmung hatte sich bereits derart zugespitzt, dass die mediceische Junta tatsächlich einen Staatsstreich ins Auge fasste, sich dann aber doch entschloss, eine günstigere Signoria abzuwarten. Dies war Ende Juni der Fall, als Luca Pitti als der nächste Gonfaloniere di giustizia aus dem Wahlbeutel gezogen wurde.25
Die neue Regierung trat ihr Amt am 1. Juli an, und Pitti machte sich sofort ans Werk. Am 2. versuchte er während einer Beratungssitzung mit über zweihundert führenden Bürgern die traditionellen gesetzgebenden Körperschaften zu stürzen und einen neuen Rat einzusetzen, der über außergewöhnliche Macht verfügen sollte, den Rat der Hundert. Der Plan hierzu bestand bereits mehrere Monate und war innerhalb der Führungsriege des öfteren hinter verschlossenen Türen diskutiert worden. Da Pitti nun jedoch eine feindselige Strömung zu spüren glaubte, verwarfen er und die Prioren das Vorhaben und brachten stattdessen den Vorschlag ein, die Namen der für ein Amt in Frage kommenden Bürger neu zusammenzustellen. Da Mitte der 1450er Jahre ein traditionelleres Wahlverfahren teilweise wieder in Kraft gesetzt worden war, regten Pitti und Konsorten nun an, die Beschränkungen wieder einzuführen, die erneut stark in die Richtung einer sorgfältigen, buchstäblich handverlesenen Auswahl der folgenden Signorien gehen würde. Doch scheiterte diese Vorlage in der letzten Juliwoche wiederholt am Rat des Volkes, und zur größten Verärgerung der Medicipartei drohte in diesem Zusammenhang nun auch noch der Erzbischof von Florenz all jenen mit der Exkommunikation, die die Verfassung verletzten, indem sie nach „offenen“ anstelle von geheimen Wahlen verlangten.
Damit war die Zeit reif, mit Gewalt zu drohen. Am 1. August ließen einige Schlüsselfiguren des Regimes bei einer längeren Unterhaltung mit den Prioren die Forderung nach einem Parlamento laut werden, einer demagogischen Bürgerversammlung. Aus Gründen der Sicherheit nahm Cosimo nicht selbst an den entscheidenden Sitzungen im Regierungspalast teil, sondern ließ sich von seinem Sohn Giovanni vertreten, der eine versöhnliche und entwaffnende Erklärung abgab. Doch ließ Cosimo den mailändischen Gesandten wissen, dass er für ein Säbelrasseln bereit sei, und bat noch am selben Tag seinen alten, bei ihm hoch verschuldeten Freund Francesco Sforza, den Herzog von Mailand, um die Entsendung von Truppen nach Florenz. Am 2. August entschied sich die Regierung für genau denselben Weg: Waffen und eine große (aber überwachte) Bürgerversammlung. Am 3. wurde der Anführer der Opposition, der bekannte Jurist Girolamo Machiavelli, verhaftet. Am 4. folgten zwei weitere Verhaftungen, und nach mehrtägiger Folter wurden alle drei Männer ins Exil geschickt. Einige Tage später wurden mindestens fünfzehn weitere Bürger auf zehn oder mehr Jahre verbannt. Gleichzeitig hatte man rund 150 Bürger kategorisch auf ihre Landsitze entsandt, mit der Anordnung, keinesfalls ohne Erlaubnis der Prioren nach Florenz zurückzukehren. Am 9. August war auswärtige Infanterie und Kavallerie in der Stadt eingetroffen. Einen Tag später erging der Aufruf zu einer Bürgerversammlung, die am 11. auf dem Hauptplatz stattfinden sollte. Als die Menschen sich an diesem Tag zum Parlamento begaben, fanden sie die Piazza sowie alle angrenzenden Straßen von Soldaten und bewaffneten Bürgern besetzt. Binnen kürzester Zeit hatten Luca Pitti und die Prioren die Zustimmung der Menge zur Einsetzung einer mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Notstandsregierung (Balià) aus 351 Männern eingeholt und ihr zudem das Plazet abgetrotzt, die Wahlbeutelbestückung wieder der strikten Kontrolle des mediceischen Regierungszirkels zu unterstellen. Anschließend wurde die Bürgerversammlung für beendet erklärt. Der achtköpfige Wachausschuss hatte seine umfassenden Befugnisse wieder und konnte mit Regimekritikern nach Belieben umspringen. Noch bevor das Jahr um war, hatten die neuen „Wahlprüfbeamten“ – die Hüter der für das passive Wahlrecht in Frage kommenden Namen – rund 1500 Männern das Recht abgesprochen, ein öffentliches Amt zu bekleiden.26
Lorenzo de’ Medici, der künftige Dichter und Politiker, zählte in diesem Sommer erst zehn Lenze, aber direkt oder indirekt dürfte er sicher etwas von den Unruhen mitbekommen haben. Schließlich wurde er dazu erzogen, ein mächtiges (wenngleich risikobehaftetes) politisches Erbe anzutreten, und man weiß, dass er bereits im Alter von zwölf Jahren Bittgesuche erhielt und Empfehlungsschreiben verschickte. Schon mit zehn muss er reif genug gewesen sein, um politische Auseinandersetzungen zu begreifen, und zwei Jahre später sollte noch mehr Unerfreuliches auf ihn zukommen.27
1460 wurde Girolamo Machiavelli, der für fünfundzwanzig Jahre nach Avignon verbannt worden war, im Lunigianer Bergland nicht weit von Florenz verhaftet. Man verhörte ihn, abermals unter schlimmer Folter, und klagte ihn an, eine Verschwörung unter den im Exil lebenden Florentinern angezettelt zu haben. Eine Woche später starb Machiavelli, fünfundvierzig Jahre alt, höchstwahrscheinlich an den Folgen der Folterung mit Seilen, Eisen und möglicherweise Feuer. Sein Geständnis führte zur Verbannung weiterer fünfundzwanzig Bürger.28
Lorenzo sollte bald noch tiefer in die Abgründe der Politik verstrickt werden, umso mehr, als die Wahlleiter (Accoppiatori) und weitere hochrangige Beamte nun häufig im neuen Palazzo Medici zusammentraten. Sein Großvater Cosimo war über siebzig und ein kranker Mann, sein Vater Piero wurde gelegentlich von Gichtanfällen außer Gefecht gesetzt. Die mächtigsten Bürger in Cosimos Kreisen waren ehrgeizige Männer, die ihre eigene Bedeutung niemals unterschätzten – Agnolo Acciaiuoli, Dietisalvi Neroni, Luca Pitti und einige andere, allesamt Angehörige des Ritterstandes, der bekanntlich Anspruch auf gesellschaftliche Vorrangstellung mit sich brachte.29
Das Ganze entbehrte nicht einer gewissen Ironie. In der Literatur dient Ironie dazu, Wendungen und Kontraste aufzuzeigen. Sie zwingt uns, noch einmal ganz genau über die Sache nachzudenken. Im wahren Leben indes warnt sie uns vor dem Unvorhersehbaren, und daran herrschte in Florenz beileibe kein Mangel. Schließlich wäre der Aufstieg der Medici ohne die Hilfestellung von Mitgliedern altehrwürdiger Familien niemals möglich gewesen. Sie alle steckten unter einer Decke. Medici-Parteigänger wie Acciaiuoli, Pitti, Soderini und der Parvenü Neroni hätten ohne die Medici und deren System der Manipulation von Wahlbeuteln und Wahlfähigkeit weit weniger Macht besessen. Aber auch der Ehrgeiz wuchs auf beiden Seiten. 1434 und dann noch einmal 1458 wurden die Anführer der Medicigegner jeweils mit einem Schlag ausgeschaltet, was die siegreiche Partei noch unbezwingbarer erscheinen ließ. Doch solange die republikanischen Einrichtungen blieben – Regierungsgremien, Wahlfähigkeitsliste und Ämterkreislauf sowie die gelegentliche Notwendigkeit, auch einfache Bürger zu konsultieren –, war die Medicipartei, und damit auch Luca Pitti, auf die Bürger angewiesen, auf die allzu gerne mit unübersehbarer Verachtung herabschauten. An dieser Stelle aber nimmt unsere Geschichte eine neue Wendung.
1463, ein Jahr vor Cosimos Tod, erkannte der mailändische Gesandte in Florenz, dass sich mindestens zwei von Cosimos engsten Vertrauten, Agnolo Acciaiuoli und Dietisalvi Neroni, gegen ihn und seinen Sohn Piero gewandt hatten. Sie warteten offenbar nur darauf, dass der alte Bankier starb, und hatten nicht die geringste Absicht, sich von seinem kränklichen Sohn Anweisungen erteilen zu lassen. Schließlich waren sie älter und besaßen ungleich mehr Erfahrung auf dem politischen Parkett. Im Herbst 1465 war die Einheit der alten Medici-Führungsriege zerbrochen, und die Partei erlitt in den gesetzgebenden Komitees vernichtende Niederlagen. Mitglieder des Zirkels reagierten auf den Druck des „Fußvolks“ innerhalb der Oligarchie, und wieder einmal wurden Stimmen laut, die forderten, den Pool der Wahlfähigen zu vergrößern und die Signoria nicht durch Wahlmanipulation, sondern ein echtes Losverfahren zu bestimmen. Diese Bestrebungen waren selbst im Medici-freundlichsten Gremium erkennbar, dem neuen Cento (Hunderterrat), der erst sieben Jahre zuvor, nach dem Staatsstreich von 1458, ins Leben gerufen worden war. Die unter vorgehaltener Hand poggeschi genannten Reformer erstrebten nicht weniger als das passive Wahlrecht für alle Bürger, die in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren politischen „Säuberungen“ zum Opfer gefallen waren.30
Von diesem Zeitpunkt an bis zum Ausbruch der Krise auf der Piazza Signoria im September 1466 befand sich Lorenzos Vater Piero, das Oberhaupt der Antireformerpartei (der Piano), in einem Gewissenskonflikt. Die Auseinandersetzung wurde ebenso hinter den Kulissen ausgetragen, in Privatgesprächen und Geheimverhandlungen, wie in den öffentlichen Gremien, wo Piero und seine Anhänger immer häufiger Niederlagen einstecken mussten. Er selbst nahm freilich nur selten an Sitzungen der Regierungsgremien teil, und sein Name wurde niemals offen mit bestimmten Anträgen in Verbindung gebracht. Trotzdem wussten beide Fraktionen sehr genau, worum es der anderen ging. Nicht umsonst wurde die Opposition inzwischen nämlich hauptsächlich von Männern geführt, die früher auf der anderen Seite gestanden hatten, das heißt, enge Vertraute der Medici gewesen waren.31
Die bemerkenswerte Bandbreite der Gegner des Regierungssystems der Medici trat Ende Mai 1466 zutage, als rund vierhundert Bürger aus den höchsten Rängen, darunter zahlreiche prominente Amtsinhaber, die Kühnheit besaßen, ein öffentliches Bekenntnis zugunsten des älteren, demokratischeren Regierungssystems zu unterzeichnen. Selbst Pieros Cousin und Geschäftspartner Pierfrancesco de’ Medici findet sich unter den Signierenden. Natürlich dürfte es auch viele andere Bürger gegeben haben, die dieses Bekenntnis ebenfalls guthießen, es aber nicht wagten, ihren Namen darunter zu setzen – wenngleich zu den Unterzeichnern Leute wie Luca Pitti, Agnolo Acciaiuoli und Manno Temperani zählten. Im Juli war das Stimmungsbarometer jedenfalls so weit gestiegen, dass die Reformer glaubten, die Abschaffung des Hunderterrats durchsetzen zu können.
Piero hatte jedoch die Zeichen erkannt und, da nach wie vor alle Fäden in seiner Hand zusammenliefen, die Wahlbeutel für die Signoria so präparieren lassen, dass hauptsächlich Prioren gezogen werden würden, die seine Sache vertraten. Und mehr als sechs der neun Prioren brauchte er gar nicht. Obwohl er der einzige Mann in Florenz war, der genügend Macht besaß, um mit einem derart dreisten Trick durchzukommen, wurden niemals irgendwelche Beweise entdeckt. Dennoch scheint der Verdacht berechtigt, zumal eine solche Tat perfekt in das Bild des in politischen Dingen stets rücksichtslosen Mannes passte, der weder Mühe noch Kosten scheute, um an der Macht zu bleiben. Fähige Politiker verstehen es bekanntlich, Spuren zu verwischen, und so bleibt nur die Tatsache, dass am 28. August 1466 eine Medici-freundliche Signoria ausgelost wurde, um vier Tage später ihr Amt anzutreten. Am gleichen Tag noch, dem 28., beorderten die Prioren unter dem Druck ihrer eigenen Differenzen die Führer der beiden Fraktionen, Luca Pitti und Piero de’ Medici, in den Regierungspalast. Von Rinuccini wissen wir, dass Luca Pitti persönlich und „unbewaffnet“erschien, Piero aber, seine Krankheit vorschiebend, seine beiden Söhne Lorenzo und Giuliano schickte. Benedetto Dei, einem aufmerksamen zeitgenössischen Beobachter, zufolge stand die ganz Stadt „unter Waffen“ – und gleichsam unter Strom.32
Beide Seiten fürchteten blutige Auseinandersetzungen und Verluste an Menschenleben. Luca Pitti vertraute einer Gruppe von Männern am 12. August an, dass bei Imola frische Truppen aus Mailand gesichtet worden wären, gerüstet für den Marsch auf Florenz zur Unterstützung Pieros, der seinerseits der Opposition vorwarf, insgeheim beim Marchese von Ferrara, Borso d’Este, Hilfe und Soldaten angefordert zu haben. In der Tat berichten zeitgenössische Schriftwechsel von verschiedenen auffälligen Truppenbewegungen in der Umgebung der Arnostadt. In letzter Minute wich die republikanische Opposition einer bewaffneten Auseinandersetzung aus. Anders der kranke Piero, dem obendrein eine überraschende Wendung zu Hilfe kam. Am 29. nämlich unterbreitete Luca Pitti ihm in einer privaten Unterhaltung den Vorschlag, eine von Pieros Töchtern in seine Familie einheiraten zu lassen, und wechselte, zum Entsetzen der Reformer, das Lager. Am 30. plädierte Agnolo Acciaiuoli als Berater der scheidenden Regierung dringend für einen Friedensschluss zwischen den beiden Parteien. Luca und Piero sollten zu Hause bleiben, und die Otto sollten, notfalls mit Gewalt, alle bewaffneten Fremden aus der Stadt entfernen. Dabei enthielt er sich jedes Bezugs zu Pieros Soldaten. Am gleichen Tag verbrachte Piero anstrengende Stunden mit den Erzbischöfen von Florenz (Giovanni Neroni) und Pisa (Filippo de’ Medici). In seinem Arbeitszimmer im Palazzo Medici müssen zwischen den drei Männern scharfe Worte gefallen und sogar Drohungen ausgesprochen worden sein, denn der Medici-Prälat, ein entfernter Vetter von Piero, bot zu seiner Verteidigung 1500 bewaffnete Männer, während der Erzbischof der Stadt, der Bruder des Oppositionsführers Dietisalvi Neroni, die Reformer unterstützen wollte. Es sollte denn auch nicht lange dauern, bis es der florentinische Primas, geschmäht und verunglimpft, vorzog, die Stadt zu verlassen und ins Exil zu gehen.33
Am 1. September erklärte Luca Pitti bei einem weiteren Vier-Augen-Gespräch mit Piero, er sei nun so weit, sich „auf Gedeih und Verderb“ auf seine Seite zu stellen. Der Beweis folgte bereits am nächsten Vormittag während einer Sitzung der neuen Regierung, die – bezeichnenderweise – im Palazzo Medici stattfand. Pitti war der erste Redner, der aufstand und „noch hier und heute ein Parlamento“ forderte.
Rückblickend mögen wir Lucas volte face als feige Komödie ansehen, aber für Agnolo Acciaiuoli, Niccolò Soderini und Dietisalvi Neroni, seine vormaligen Verbündeten, bedeutete es den Beginn einer Tragödie. Acciaiuolis bissige Beschwerde über die bewaffneten Fremden am 30. August war nicht umsonst direkt gegen Piero gerichtet gewesen.
Tatsächlich wimmelte es in der Stadt nur so von Pieros angeworbenen Soldaten, und nachdem sie schon in sein Haus an der Via Larga gekommen waren, stimmten sämtliche bei der Sitzung am 2. September anwesenden Bürger zuerst mündlich und anschließend noch schriftlich zugunsten des Parlamento, „eine große Zahl [freilich] gegen ihren Willen und gegen das Wohl der Stadt“, wie der Augenzeuge Carlo Gondi notierte. Die fünfunddreißig Unterschriften zeigen, dass die Gruppe zum Kern der Medici-Oligarchie gehörte und auch viele Namen aus der vormaligen, urplötzlich inexistent gewordenen Opposition enthielt. Ihre Entscheidung wurde sofort in den nur sechshundert Meter entfernten Regierungspalast (Abb. 3) übermittelt, wo die neuen Prioren nervös auf ihre Bestätigung warteten. Zwar standen sie auf Seiten Pieros, fürchteten aber auch seine Waffenträger. Nun gaben sie Order, die Glocken für ein Parlamento zu läuten, das am frühen Abend stattfinden sollte.34
Piero hatte rund dreitausend Söldner in die Stadt geholt, so dass die Bürger, die zu der Versammlung zur Piazza gingen, wo immer sie hinschauten, bewaffnetes Fußvolk sahen. Weitere vier- oder fünftausend Soldaten – die etwas weiter entfernten Mailänder Truppen noch gar nicht mit eingerechnet – wurden als Reserve in der Nähe von Florenz zurückgehalten. An diesem Punkt unserer Geschichte nun hat der siebzehnjährige Lorenzo seinen ersten großen Auftritt auf der politischen Bühne: In voller Rüstung ritt er – er war ein exzellenter Reiter – zwischen den Soldaten auf die Piazza der Signori. Dann saß er ab und trat zu den Prioren, die sich an „das Volk von Florenz“ wandten. Sein Vater, der „kranke“ Piero, war zu Hause in der Via Larga geblieben.35
Nachdem sich die republikanische Opposition in Wohlgefallen aufgelöst hatte, war das Ergebnis der Bürgerversammlung klar vorhersehbar: Piero de’ Medicis Prioren bekamen ihre mit diktatorischen Vollmachten ausgestattete Sonderkommission (Balìa). Sie führten, und zwar auf zwanzig Jahre, die umstrittene Wahlpraxis wieder ein, die die Manipulation der Wahlbeutel erlaubte. Mit anderen Worten: Die neue Medici-freundliche Führung würde abermals alle folgenden Regierungen bestimmen. Und sie erneuerten die ebenso umfassenden wie umstrittenen Machtbefugnisse der gefürchteten „Acht“. Dieses Mal gab es keine Massenverbannung von Bürgern. Nur die obersten Anführer der Widerstandsbewegung sowie einige wenige Gefolgsleute wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen, ausnahmslos als verarmte Leute. Wachausschuss und Balìa konnten weder die vierhundert Bürger ins Exil schicken, die das republikanische Bekenntnis des vergangenen Mai unterzeichnet hatten, noch die Wahlfähigkeit all jener aufheben, die man verdächtigte, nur aus Angst oder Vorsicht nicht unterschrieben zu haben. Da eine Verbannung aus Florenz auch die Vertreibung aller über elf Jahre alten Söhne der zum Exil Verurteilten bedeutete, hätte eine solche Massenverbannung schlichtweg einen zu großen Teil der aktiven Mitglieder der herrschenden Schicht betroffen. Vergeltungsmaßnahmen dieser Größenordnung waren gefährlich und demotivierend. Außerdem besaß Piero die entscheidenden Gelder sowie die auswärtigen Truppen und hatte nun auch noch den Feind – geschlagen und willfährig – in seinem Lager, quasi seiner Befehle harrend. War dies der kränkliche, unerfahrene, „gichtige“ Piero? Erinnerten sich Florentiner damals der Verse des italienischen Dichters, der um 1300 herum geschrieben hatte: „Wohl dem, der siegt, denn ich bin auf seiner Seite!“? Offensichtlich, denn die Unterlegenen liefen mit erschreckendem Tempo zum siegreichen Gegner über und konnten es kaum abwarten, dem ehemaligen Feind vor aller Augen Unterstützung und Förderung angedeihen zu lassen. Luca Pitti hatte es vorgemacht, wofür er allerdings hinterher zutiefst verachtet wurde.36
Abb. 3 Palazzo Vecchio, Florenz
Und der erste Auftritt des jungen Lorenzo auf der politischen Bühne – in voller Rüstung hoch zu Ross, auf dem bedeutendsten öffentlichen Platze der Stadt und in einem Augenblick größter Sorge um die herrschende Klasse? Er hielt Florenz vor Augen, worauf der Einfluss der Familie basierte: Geld, mit dem man sogar militärische Macht kaufen konnte.
Entgegen der landläufigen Meinung floss längst nicht alle geniale Schöpferkraft des Quattrocento in Kunst und Literatur. Mindestens genausoviel ging in die Politik, und nirgendwo war der Anteil höher als unter den großen Politikern des mediceischen Florenz. Daher muss jeder Versuch, das florentinische Blutbad vom April 1478 zu begreifen, auch dieser Genialität Rechnung tragen.37
Um nach der Sicherung ihres Sieges von 1434 an der Macht zu bleiben, bediente sich die Medicipartei einer ganzen Reihe ausgeklügelter strategischer Kniffe. Was dabei herauskam, war ein Exempel wahrer Staatskunst, denn sie schaffte es, dem Schein nach alle verfassungsmäßigen Normen zu wahren, während sie in Wirklichkeit die ganze Zeit über eben diese Verfassung unterminierte, die an sich ja auf der repräsentativen Vertretung unterschiedlicher Parteien basieren sollte.
Hier eine kurze Zusammenfassung ihrer Taktiken und Hilfsmittel:38
1. Wahlfähigkeit. Das Recht, ein öffentliches Amt zu bekleiden, war Ausdruck der höchsten Autorität der florentinischen Bürgerschaft, wurde aber durch „Wahlausschüsse“ verliehen. Diese gingen die Namen der Bürger hinter verschlossenen Türen durch, nahmen manche auf und lehnten andere ab. Einen offiziellen Weg gab es nicht. Die endgültige Liste der wahlfähigen Bürger bildete den Pool möglicher Regierungsbeamter. Nun kamen einige oder viele der zugelassenen Namen, auf Zettel oder Schildchen geschrieben, in Wahlbeutel, aus denen die künftigen Magistrate gezogen wurden. Wer den Wahlausschuss stellte, bestimmte folglich darüber, wer überhaupt die Chance bekam, sich um ein Amt zu bewerben. Unerwünschte Personen ließen sich also relativ leicht ausschalten und gelangten nie in den elitären Ämterkreislauf. Mit einer Bevölkerung von unter 45.000 Einwohnern war die republikanische Oligarchie von Florenz eine kleinstädtische Gesellschaft, in der die „Wahlprüfbeamten“ die in Frage kommenden Männer entweder persönlich kannten oder zumindest jemanden kannten, der sie kannte.
2. Der Rat der Prioren (die Signoria). Acht Prioren und der Gonfaloniere di giustizia bildeten die Regierung von Florenz. Für rechtsgültige Beschlüsse war eine Zweitdrittelmehrheit, die so genannte „Macht der sechs Bohnen“, nötig. Also: Wer sechs der neun Stimmen besaß, kontrollierte die Regierung. Die Prioren führten in aller Regel die täglichen Regierungsgeschäfte, brachten alle Gesetzesvorlagen ein, leiteten und überwachten Sitzungen, mühten sich in den Gremien ab (oder auch nicht), konnten die „Wahlausschüsse“ einberufen und Parlamenti anberaumen.
3. Bürgerversammlungen (Parlamenti). In Notsituationen – weit häufiger frei erfunden als unmittelbar notwendig – hatten die Prioren (sechs von ihnen) das Recht, ein Parlamento einzuberufen, eine Generalversammlung der Bürgerschaft. Die Bürger, die sich auf der Piazza versammelten, sollten dann auf die Frage, ob sie einen Notstands- oder Kriegsrat (Balìa) wollten, laut Ja oder Nein rufen. Und da sich bei einer solchen Gelegenheit stets jede Menge Bewaffnete unter das Volk mischten, bekamen die Prioren zwangsläufig das von ihnen gewünschte Votum. Die Medicipartei benutzte diesen „Aufruf an das Volk“ in den Jahren 1434, 1458 und 1466.
4. Die mit diktatorischen Vollmachten ausgestattete Sonderkommission (Balìa). Die zwischen 235 und 350 Mitglieder zählende Balìa konnte die Verfassung außer Kraft setzen, den Anspruch auf die „Regierungsgewalt des florentinischen Volkes“ erheben und Gesetze aufheben – alles jedoch unter Führung der Prioren. Eine solche Kommission wurde dazu benutzt, gegen innenpolitische Widersacher vorzugehen, die Opposition zu zerschlagen, eine Revision aller für das passive Wahlrecht in Frage kommenden Namen einzuleiten und unpopuläre Gesetze oder neue Steuern durchzusetzen.
5. Wahlleiter oder Beutelfüller (Accoppiatori). Dieses zehnköpfige Gremium – nach 1466 bestand es aus nur noch fünf Mitgliedern – bestimmte die Namenszettel, die in die Wahlbeutel für die höchsten Ämter gelangten – für den Gonfaloniere di giustizia, die Prioren, den zehnköpfigen Notstands- oder Kriegsrat, den Wachausschuss der „Acht“ (die Otto) und die Monte-Beamten. Bei einer Priorenwahl wurden Namenszettel aus den entsprechenden Wahlbeuteln gezogen, und die ersten acht Kandidaten, gegen die nichts weiter vorlag, bildeten die nächste Signoria. So war es in Florenz üblich. Doch die Vorbereitung der Wahlbeutel an sich war ein leicht durchschaubares Spiel, das niemand besser zu manipulieren wusste als die Medici. Da sie es in der Hand hatten, die Zahl der Namen in den entscheidenden Wahlbeuteln von ursprünglich zweitausend(!) erst auf siebzig, später sogar auf fünfzig zu begrenzen, bestimmten die Accoppiatori die künftigen Prioren, das heißt eine Regierung nach der anderen, quasi handverlesen. Es muss kaum erwähnt werden, dass die Accoppiatori zum engsten Kreis der Medicianhänger zählten.
6. Unverdeckte Wahlbohnen (Fave scoperte). In republikanischen Gremien wurde mittels schwarzer (Ja) und weißer (Nein) Bohnen abgestimmt. Bei einer Abstimmung sollten die Ratsmitglieder laut Gesetz ihre Bohnen verdeckt abgeben, so dass niemand die Farbe sehen konnte und die Wahl geheim blieb. Gegen dieses Gesetz wurde unter Medici-freundlichen Prioren, die die Stimmberechtigten massiv unter Druck setzten, regelmäßig verstoßen. So mussten „Abweichler“ in Kauf nehmen, sich zu offenbaren, und niemand konnte rein nach Gewissen abstimmen. Über diese Praxis zutiefst empört, drohte der Erzbischof von Florenz, der furchtlose Antoninus, im Juli 1458 mit dem Kirchenbann. Seine Drohung wurde an den Portalen der Domkirche angeschlagen.
7. Der psychologische Rahmen. Hierbei handelte es sich nicht um eine Taktik. Es war vielmehr etwas, das der Besitz von Macht und ständig wachsende politische Kontrolle automatisch mit sich brachte. Die Florentiner standen jahrelang unter dem Druck, den mediceischen Oligarchen zu folgen, und zwar nicht nur der „unverdeckten Wahlbohnen“ im Ratsgremium oder der bei Volksversammlungen stets drohend anwesenden Soldaten wegen, sondern aus eigenem Antrieb, um Vergünstigungen zu erhalten – in eine niedrigere Steuerklasse versetzt zu werden, die vorteilhaftesten Heiraten für ihre Töchter und Söhne aushandeln zu können und vor Gericht auf eine wohlgesonnene Justiz zu treffen. Kurz: weil sie selbst zum Kreis der privilegierten Bürger zählen wollten. Die Furcht, diese Gunst zu verlieren, schürte ein Klima fragwürdiger Einschüchterung.
Dergestalt also war die Palette unverblümter und umfassender Kontrollmaßnahmen der mediceischen Republik. Doch war die regierende Partei damit nicht alle Sorgen los. Jede Regung bürgerlichen Selbstbewusstseins, die gelegentlich in den gesetzgebenden Gremien aufflackerte, wurde argwöhnisch beäugt. Aber wie dem ein Ende setzen? Die republikanische Verfassung ließ sich nicht so stark beugen, als dass sie den Medici totale Macht garantiert hätte. Immer wieder kam es vor, dass sich angebliche Freunde der Familie – deren Namen in die Liste der wahlfähigen Kandidaten aufgenommen worden waren – als unzuverlässig erwiesen, sobald sie Gelegenheit erhielten, ihre wahre Meinung zu äußern. Hätte man ihnen die Sicherheit einer geheimen Abstimmung gewährt, hätten zu viele gegen die mächtigen Gremien gestimmt, gegen restriktive Wahlkontrollen, neue Steuern, neue Kommissionen und gegen das Präparieren der Wahlbeutel für die höchsten Ämter.