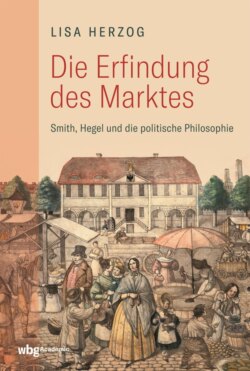Читать книгу Die Erfindung des Marktes - Lisa Herzog - Страница 11
Über Smith und Hegel hinaus
ОглавлениеIn mindestens zwei Hinsichten jedoch sind die Überlegungen, die sich aus Smiths und Hegels Denken gewinnen lassen, begrenzt, was die Anwendbarkeit auf die heutige Welt angeht. Da ist zum einen die Frage nach der globalen Ausdehnung des Marktes, die heute Realität ist, bei Smith und Hegel jedoch nur in begrenztem Maß, durch vereinzelte Verweise auf den Fernhandel, eine Rolle spielt. Und da ist zum anderen die Frage, wie angemessen es ist, unser Wirtschaftssystem allein als „Marktwirtschaft“ zu begreifen – unterschlägt man damit doch, dass ein Großteil der Aktivitäten, die in die Kategorie der „Wirtschaft“ gehören, innerhalb von großen Organisationen stattfinden, in denen gerade nicht Marktprinzipien, sondern eine Logik der Hierarchie, vorherrscht.
Sowohl Smith als auch Hegel gehen von einer Konstellation aus, die in der Tradition der Sozialdemokratie später als das „Primat der Politik“ bezeichnet wurde: Der Grundgedanke ist, dass eine am Gemeinwohl orientierte Regierung den Rahmen für Märkte setzt und dafür sorgt, dass diese mehr Nutzen stiften, als sie Schaden anrichten – und auch dafür, dass mögliche Opfer kompensiert werden, die z.B. durch Marktprozesse ihren Arbeitsplatz verlieren. Bei Hegel deutet sich das Problem staatlicher Ohnmacht in seiner Diskussion des „Pöbels“ bereits an: Was, wenn es nicht gelingt, alle Teile der Bevölkerung in die wohlgeordnete Marktgesellschaft zu integrieren? Besonders drängend wird diese Frage in einer Situation wie der heutigen, in der Märkte global geworden sind, ihre Regulierung jedoch in hohem Maße weiterhin eine Angelegenheit der Nationalstaaten ist.
Ein wichtiger Unterschied zwischen nationalen und internationalen Märkten ist, dass das Wissen darum, unter welchen Umständen Güter produziert werden, bei letzteren oft viel weniger ausgeprägt ist. In nationalen Märkten können Kundinnen mehr über die Produktionsbedingungen wissen, es gibt oft nationale Regulierungsbehörden, die z.B. Hygienestandards bei der Lebensmittelproduktion überprüfen, und vielleicht kennt man auch jemanden, der in der entsprechenden Branche arbeitet und Auskunft geben kann. Auch wenn die Verhältnisse komplexer geworden sind als zu Zeiten Smiths und Hegels: Nationale Märkte sind überschaubarer und können durch nationalstaatliche Institutionen eingegrenzt und eingebettet werden. Für internationale Märkte fehlt eine derartige Einbettung – das macht es auch schwieriger, als Konsument verantwortlich zu handeln, weil Informationen über die Produktionsbedingungen fehlen.12
Doch nicht nur das: Der internationale Wettbewerb führt auch dazu, dass derartige Einbettungsmechanismen auf der nationalen Ebene unter Druck geraten. Es ist die Drohung mit Abwanderung und damit mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, die nationalen Regierungen die Hände bindet – und auch, wenn vielleicht nicht jede dieser Drohungen so viel Gewicht verdient, wie sie ihr von Politikerinnen im Geiste der „Alternativlosigkeit“ zugeschrieben wurde, ist diese Grundkonstellation sicherlich höchst problematisch. Ein einseitiges Vorgehen einzelner Staaten, sei es im Bereich der Besteuerung, der Umweltgesetzgebung oder der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ist daher oft weniger wirksam, als es zu Zeiten einer weniger stark globalisierten Wirtschaft der Fall war. Und der Wille der Staatenlenker, international zusammenarbeiten, um derartige Probleme anzugehen, scheint derzeit wenig ausgeprägt – vielleicht mit Ausnahme der Europäischen Union, die zumindest gewisse Anstrengungen unternimmt, um z.B. die Datensammelwut von Internetfirmen einzugrenzen.
Für die Diagnose dieser Situation scheint ein anderer der „Klassiker“ besser geeignet zu sein als Smith und Hegel mit ihrer alles in allem doch recht optimistischen Sichtweise: Karl Marx, für den der bürgerliche Staat nicht mehr als ein Instrument der herrschenden Klasse war. Das marxistische Denken hat seit der Finanzkrise einen enormen Aufschwung erfahren, gerade unter Studierenden ist seine Popularität hoch. Doch es stellt sich das alte Problem: Wie umgehen mit der Tatsache, dass die Marxschen Rezepte – soweit man davon überhaupt sprechen kann – schwer umsetzbar scheinen und eine demokratische Mehrheit für sie kaum zu gewinnen ist? Für die Diagnose der derzeitigen Krisen kann man viel gewinnen, wenn man Marx liest, doch welche Handlungsoptionen und Reformvorschläge ergeben sich dann?
Die Richtung, die ich in meiner Forschung seit einiger Zeit verfolge – und von der ich glaube, dass sie zumindest dem Geist nach den liberalen, egalitären Seiten von Smith und Hegel nahesteht – ist nicht so sehr die einer „Verstaatlichung der Produktionsmittel“ im klassischen Sinne, sondern die einer stärkeren Demokratisierung des Wirtschaftssystems, weniger „top down“ und viel mehr „bottom up“. Das hat mit der zweiten Hinsicht zu tun, in der wir über Smith und Hegel hinausgehen müssen, und in der es irreführend ist, von reinen „Marktwirtschaften“ zu sprechen, als fände wirtschaftliches Handeln in erster Linie durch atomistisches Tauschhandeln statt. Vielmehr werden unsere Wirtschaftssysteme entscheidend dadurch geprägt, dass in ihnen große Organisationen tätig sind, die die Arbeitskraft von Tausenden, manchmal sogar von Millionen von Menschen zusammenführen: transnationale Unternehmen, inzwischen zunehmend im digitalen Bereich, deren Umsätze das BIP mittelgroßer Länder spielend übersteigen.
Derartige Organisationen haben weder Smith noch Hegel erlebt; am ehesten noch dürften die Diskussionen der East India Company, die sich bei Smith finden – und die höchst kritisch sind, weil er hier zu viel wirtschaftliche, politische und militärische Macht konzentriert sieht – in diese Richtung gehen. Und doch sind es diese Organisationen, die für eine Vielzahl der moralischen Schädigungen, die wir gemeinhin „den Märkten“ zuschreiben, verantwortlich sind. Damit sollen andere Akteure, gerade Konsumentinnen in reichen Ländern, nicht aus der Pflicht genommen werden – doch um moralische Verbesserungen herbeizuführen, scheint es unverzichtbar, dass sich auf der Ebene dieser transnationalen Organisationen etwas ändert.
Mein auf Inventing the Market folgendes Buchprojekt beschäftigte sich daher mit Ethik in komplexen Organisationen. Aufbauend auf der These, die sowohl Smith als auch Hegel teilen, dass Individuen von ihren sozialen Kontexten geprägt werden, ging ich der Frage nach, wie diese ganz spezifischen sozialen Kontexte, in denen durch Hierarchien und Regeln komplexe Formen der Arbeitsteilung und deren Integration ermöglicht werden, das menschliche Verhalten prägen und welche besonderen Herausforderungen an das moralische Handeln sich dabei ergeben. Um diese Fragen bearbeiten zu können, führte ich Interviews mit Praktikern, aus großen Unternehmen ebenso wie aus großen öffentlichen Institutionen. Die Ergebnisse flossen in Reclaiming the System. Moral Responsibility, Divided Labour, and the Role of Organizations in Society ein (die deutsche Übersetzung Das System zurückerobern wird 2021 erscheinen) – ein auf den ersten Blick komplett andersartiges Buch, das aber doch von meiner Beschäftigung mit Smith und Hegel geprägt ist.
Durch diese Untersuchung, aber auch durch die Beschäftigung mit transnationalen Märkten, kam ich zu dem Schluss, dass die erfolgversprechendste Richtung, in die wir aus Sicht einer von Smith und Hegel inspirierten Wirtschaftsphilosophie heute gehen können, die ist, nach den Potentialen für die Demokratisierung der Wirtschaft zu fragen – nicht nur durch eine Wiederbelebung und Stärkung des „Primats der Politik“, sondern auch durch die Einforderung demokratischer Praktiken in wirtschaftlichen Organisationen. Denn diese Organisationen sind eben gerade keine Märkte, und was auch immer man kritisch über Märkte sagen mag – immerhin fördern sie gewisse Formen von Feedback und Responsivität. Wenn die Kundinnen nicht zufrieden sind, können sie (zumindest in idealtypischen Märkten) zur Konkurrenz gehen – das zwingt Marktteilnehmer zu Wachsamkeit und Anpassung. Innerhalb von komplexen Organisationen dagegen fehlen oft effektive Rückkoppelungsmechanismen, weil die Macht von oben nach unten verteilt ist, während die Rückkoppelungen von unten nach oben erfolgen müssten. An der Spitze dieser Organisationen findet sich eine enorme Machtfülle, die sich unter anderem darin zeigt, dass die Gehälter keinerlei Obergrenze mehr zu kennen scheinen.
Im politischen Bereich ist es die demokratische accountability, die verhindern soll, dass Politikerinnen ihre Macht missbrauchen. Das funktioniert sicher nicht perfekt, und es gäbe viel darüber zu sagen, warum es derzeit besonders schlecht zu funktionieren scheint. Doch mit Winston Churchill gesprochen: Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, außer allen anderen, die schon probiert wurden. Das Prinzip, dass Macht demokratisch zur Verantwortung gezogen werden muss, lässt sich auch auf das Innere großer Organisationen anwenden – auch auf Wirtschaftsorganisationen! Das deutsche Prinzip der Mitbestimmung geht in diese Richtung, doch es könnte und sollte noch viel mehr passieren, um wirtschaftliche Machtkonzentration demokratisch einzuhegen. Sicherlich gibt es hier auch zahlreiche offene Fragen, z.B. zu den Rechten und Pflichten der Kapitalgeber, zu praktikablen Mechanismen demokratischer Entscheidungsfindung oder zum Verhältnis von innerorganisatorischer und politischer Demokratie. Doch ich denke, dass sich solche Antworten geben lassen, und dass dies eine Richtung ist, in die wir theoretisch und praktisch weiterdenken, -forschen und -experimentieren müssen.13
Wenn es die „unsichtbare Hand“ des Marktes nicht gibt, oder sie nur sehr eingeschränkt wirksam sein kann, dann müssen sichtbare Hände dafür sorgen, dass es nicht zu übermäßig großen Konzentrationen wirtschaftlicher Macht kommt. Auch wenn Smith und Hegel keine Demokraten im heutigen Sinne des Wortes waren: Wenn man ihre Aussagen zum gleichen moralischen Status aller Individuen ernst nimmt, scheint mir, dass sie kaum anders könnten, als heute welche zu sein. Sie wären wahrscheinlich kritische Stimmen, die mit viel Aufmerksamkeit für empirische Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen die Defizite der heutigen Institutionen kommentieren und Verbesserungsvorschläge unterbreiten würden. Und gäbe es die Gelegenheit, heute mit ihnen zu diskutieren, dann würde ich sie fragen wollen, ob nicht auch sie in Richtung einer weitergehenden Demokratisierung der Wirtschaftswelt argumentieren würden.
Lisa Herzog, im Mai 2020
1 In chronologischer Reihenfolge: bei Cambridge University Press 2006 (Hrsg. Haakonssen), bei Elgar 2009 (Hrsg. Young), bei Oxford University Press 2013 (Hrsg. Berry et al.), bei Prince ton University Press 2016 (Hrsg. Hanley).
2 Siehe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, z.B.: Ryan Patrick Hanley, „The ‚Wisdom of the State‘: Adam Smith on China and Tartary,“ American Political Science Review 108(2) (2014), S. 371–381; Lisa Herzog, “The Normative Stakes of Economic Growth. Why Adam Smith does not rely on ‘trickle down’”, Journal of Politics 78(1), S. 50–62; Daniel J. Kapust und Michelle A. Schwarze, “The Rhetoric of Sincerity: Cicero and Smith on Propriety and Political Context,” American Political Science Review 110(1) (2016), S. 100–111; Paul Sagar, “Beyond sympathy: Smith’s rejection of Hume’s moral theory,” British Journal for the History of Philosophy 25 (2017), S. 681–705.
3 https://aeon.co/essays/we-should-look-closely-at-what-adam-smith-actually-believed (letzter Zugriff Mai 2020).
4 https://aeon.co/ideas/how-adam-smith-became-a-surprising-hero-to-conservative-economists (letzter Zugriff Mai 2020).
5 Gerhard Streminger, Adam Smith. Wohlstand und Moral. Eine Biographie.München: C.H.Beck, 2017.
6 Jacob Viner, “Adam Smith and Laissez-faire”, The Journal of Political Economy 35(2) (1927), S. 198–232.
7 Zu Schlaglichtern auf Hegels Rezeptionsgeschichte siehe z.B. Lisa Herzog (Hrsg.), Hegel’s Thought in Europe: Currents, Crosscurrents, Countercurrents (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013). Eine vergleichbare Geschichte auch für Smith zusammenzustellen, ist ein Forschungsdesiderat, das meines Wissens noch offen ist.
8 Mark Reiff, „Two Theories of Economic Liberalism”, The Adam Smith Review 10 (2017), S. 189–214.
9 Siehe insbesondere George A. Akerlof und Rachel E. Kranton, Identity Economics. How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Princeton: Princeton University Press, 2010.
10 Lisa Herzog, „Professional ethics in banking and the logic of ‚integrated situations‘: aligning responsibilities, recognition, and incentives,“ Journal of Business Ethics 156(2) (2019), S. 531–543.
11 Siehe dazu Katya Assaf-Zhakarov und Lisa Herzog „Work, Identity, and the Regulation of Markets: A Study of Trademark Law in the U.S. and Germany“, Law and Social Inquiry 44(4) (2019), S. 1083–1112.
12 Siehe dazu auch Lisa Herzog, „Global trade with an epistemic upgrade.“ Moral Philosophy and Politics 5(2) (2018), S. 257–279.
13 Für einen Überblick über diese Debatte siehe Roberto Frega, Lisa Herzog und Chris Neuhäuser: „Workplace Democracy – the recent debate“, Philosophy Compass (2019), online first.