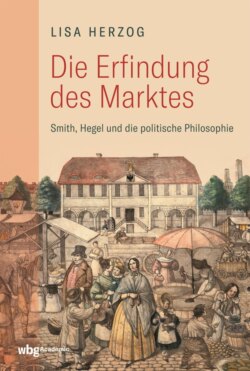Читать книгу Die Erfindung des Marktes - Lisa Herzog - Страница 8
Die kontingente Geschichte von Institutionen
ОглавлениеIn diesem Buch geht es um die Bilder des Marktes, die Smith und Hegel entworfen haben – der eine, der mit einer Lebensspanne zwischen 1723 und 1790 das Aufblühen des Überseehandels und die ersten zarten Anfänge der Industrialisierung in Großbritannien erlebte, der andere, der einige Jahrzehnte später, 1770 bis 1831, das Europa nach der Französischen Revolution erlebte, dessen feudale Vergangenheit noch stark nachwirkte. Obwohl ich versuche, beide Autoren in ihren ideengeschichtlichen Kontext einzubetten, könnte der Fokus auf ihre Texte den Eindruck erwecken, dass diese prägend waren für unterschiedliche Bilder, und damit auch Weisen der Institutionalisierung, von Märkten, dass also spätere Denker und Praktikerinnen sich auf genau diese Texte berufen hätten. Doch dies wäre eine recht gewagte These, auch und gerade angesichts der oben geschilderten verkürzten Rezeption beider Autoren, und sie würde eine eigene Studie zur Rezeptionsgeschichte in Theorie und Praxis erfordern.7 Vielmehr ging es mir darum, schlaglichtartig bestimmte weitreichende Vorstellung über Individuen, Märkte und Gesellschaften zu beleuchten. Im Fluss der Ideengeschichte sind es zwei Schnappschüsse; Smith und Hegel griffen zahlreiche Impulse aus den Tiefenschichten des Nachdenkens über Märkte auf und trieben diese weiter – in ihren jeweiligen Traditionen, der britischen und der deutschen, die zwar gemeinsame Referenzen und Überlappungen aufweisen, aber auch ganz eigene, charakteristische Muster zeigen.
Seit dem Erscheinen des Buches hat sich meine Überzeugung gefestigt, dass das Aufspüren und Analysieren der konzeptionellen und ideellen Grundlagen heutiger Institutionen eine wichtige Strategie ist, um gegen die weitverbreitete Essentialisierung von Institutionen anzugehen. Für viele Individuen, die sich noch nicht im Detail damit beschäftigt haben oder die ein paar grundlegende Vorlesungen in Volkswirtschaftslehre, aber keine weiterführenden Kurse besucht haben, scheint zu gelten: ein Markt ist ein Markt ist ein Markt. All die Variationen, all die unterschiedlichen Machtkonstellationen, all die unterschiedlichen kulturellen und sozialen Einbettungen werden damit übersehen. Die Rückkehr zu den ideengeschichtlichen Ursprüngen, und die Kontrastierung von Autoren, die aus unterschiedlichen Traditionen stammen, ist ein willkommenes Gegenmittel gegen die Annahme, dass man „schon wisse“, was ein Markt – oder eine andere vergleichbare Institution – „sei“. Lange fanden solche Vergleiche in der Ideengeschichte vor allem innerhalb der westlichen Tradition statt, und auch das vorliegende Buch beschränkt sich auf diese. Es ist längst überfällig, und höchst erfreulich, dass sich der Horizont inzwischen stärker weitet und auch nicht-westliche Denktraditionen stärker in den Blick genommen werden.
Was solche Studien leisten können, ist vor allem auch, die Kontingenz der konkreten Ausprägung von Institutionen aufzuzeigen, die wir heute sehen und mit denen wir leben. Sicherlich haben viele Institutionen einen gemeinsamen, quasi definitorischen Kern: ein Markt betrifft den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, die Ehe hat mit der rechtlichen Vereinigung sich liebender Menschen zu tun, etc. Doch jenseits dieses Kerns gibt es schwindelerregend viele Variationsmöglichkeiten und damit auch die Möglichkeit, dass sich Institutionen, ohne ihre Kernfunktionalität zu verlieren, weiterentwickeln können. Sie können sich unseren normativen Vorstellungen von Gerechtigkeit, Freiheit oder Nachhaltigkeit annähern, wenn eine hinreichend große Zahl von Menschen darauf hinarbeitet, sie zu verändern und an die normativen Erfordernisse der jeweiligen Zeit anzupassen. Sie können aber auch degenerieren, von Partialinteressen zerfressen werden oder zu bloß formalen Hüllen verkommen, in denen die Werte, die sie ursprünglich verwirklichen sollten, überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Doch auch darüber, ob eine Entwicklung eine Verbesserung oder eine Degenerierung darstellt, gibt es oft Uneinigkeit – je nach philosophischen, ethischen oder politischen Standpunkten ist es für eine Partei das eine, für eine andere Partei das andere. Auch hier kann die Geschichte des politischen Denkens Anhaltspunkte geben, auch wenn sie, für sich alleine genommen, über normative Fragen niemals entscheiden kann. Denn die Muster von Verteidigung und Anklage – z.B. über die befreiende, oder sozial zersetzende, Wirkung von Märkten – wiederholen sich. Heutige Diskussionen lassen sich besser einordnen und bewerten, wenn man ihre historischen Vorgänger kennt.